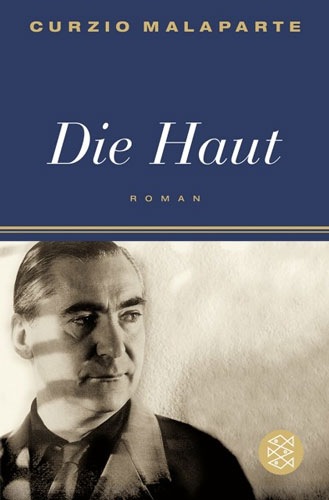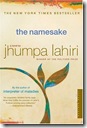Aber das ist keine verbreitete Auffassung.
Der Text scheint – so sagt es jedenfalls das Nachwort von Markus Gabriel – nach seiner „Veröffentlichung im Jahr 2006 in der philosophischen Fachwelt für großes Aufsehen gesorgt“ (S. 135) zu haben. Dass ich davon erst durch die Lektüre eben dieses Nachworts erfahre, nehme man als Hinweis darauf, dass ich nicht zu jener philosophischen Fachwelt gehöre und ordne die nachfolgenden Bemerkungen entsprechend ein.
Ziel des Autors ist es, in dem schmalen Bändchen die Positionen des rezenten philosophischen Relativismus und (sozialen) Konstruktivismus prinzipiell zu prüfen und zurückzuweisen. Dabei kommen verschiedene Philosophen unterschiedlich gut davon; am besten noch Richard Rorty, dessen relativistische Position am Ende aber auch verworfen wird. Selbst Kants erkenntnistheoretische Theorie – die nur sehr allgemein und zurückhaltend behandelt wird, da der Autor sie offensichtlich nicht aus einer Lektüre der Primärtexte kennt – findet keine Gnade vor den Augen des Herrn. Aber zum Glück kennt er anderswoher die eine und einzige Wahrheit® und „ihre segensreichen Wirkungen“ (S. 134). Wir kommen darauf zurück.
Das erstaunlichste an der von Boghossian vorgebrachten Kritik des Relativismus und Konstruktivismus ist, dass er die Absicht der von ihm bekämpften Positionen im Grunde gar nicht begreift. Ihm ist es tatsächlich unverständlich, dass jemand einen Standpunkt einnehmen und vertreten möchte, der nicht den Spielregeln gehorcht, die er (Boghossian) so erfolgreich anzuwenden gelernt hat. Und es ist doch auch offenbar und für jeden Gutwilligen immer einsichtig: Was Wahrheit® ist, bestimmt die Naturwissenschaft und ihre rationale Methode. Jeder, der eine andere Wahrheit für wahr hält, muss entweder akzeptieren, dass diese Wahrheit nur ein indirekter, mittelbarer Ausdruck der Wahrheit® ist oder dass sie schlicht falsch sein muss. Wie das zu beweisen ist? Ganz einfach: aufgrund der Wahrheit® und der einzig zu ihr führenden rationalen Methode.
Boghossian lässt sich herab, wenigstens drei konkrete Beispiele ausführlicher zu besprechen, in denen Relativisten auf Schwierigkeiten hinweisen, die Wahrheit® gegen alternative Auffassungen durchzusetzen:
- So zitiert er die Aussage eines Lakota-Indianers, die Lakota wüssten, sie seien „Nachfahren der Büffelleute. Sie kamen aus dem Inneren der Erde, nachdem übernatürliche Geister diese Welt für die Menschheit vorbereitet hatten. Wenn Nichtindianer glauben wollen, sie stammten von einem Affen ab, sei’s drum. Mir sind noch keine fünf Lakota begegnet, die an die Wissenschaft und die Evolution glauben.“ Boghossian wendet gegen diese – seiner Wahrheit® gegenüber ja immerhin tolerante – Haltung natürlich ein, dass eine solche Auffassung derjenigen, nach der die amerikanischen Ureinwohner „vor ungefähr 10 000 Jahren die Beringstraße überquerten“ (S. 9), allein deshalb unterlegen sein muss, weil es für sie keine Belege gebe. Warum das die Lakota nicht interessiert, wird klugerweise nicht erörtert.
- Etwas ausführlicher widmet er sich dem Konflikt zwischen Kardinal Bellarmin und Galileo. Bellarmin soll sich bekanntlich geweigert haben, sich von der Richtigkeit der Behauptungen Galileos durch Augenschein zu überzeugen, indem er nicht durch dessen Teleskop blickte. Bellarmin soll die Position vertreten haben, was auch immer er dort zu sehen bekäme, sei unerheblich, da er die Wahrheit über den Aufbau der Welt aus der Heiligen Schrift kenne. Dieses Beispiel spielt sowohl bei Thomas Kuhn als auch bei Richard Rorty eine prominente Rolle. Auch in diesem Fall verweigert Boghossian bereits vor dem Hindernis: Seine Analyse zeigt zuerst auf, dass in diesem Fall die Wahrheit® und die Wahrheit Bellarmins nicht als gleichwertig anzusehen seien, jedenfalls nicht, wenn man die Kriterien der Wahrheit® zugrunde legt. Dann bestreitet er, dass Bellarmin und Galileo tatsächlich prinzipiell unterschiedlichen Weltbildern anhingen – Kuhn spricht unvorsichtigerweise metaphorisch davon, dass sie in verschiedenen Welten gelebt hätte, was Boghossian souverän zu widerlegen weiß –, indem er Kuhns Aussage so allgemein wie möglich auffasst, wodurch sie absurd wird. Wie Galileo das Problem hätte lösen sollen, Kardinal Bellarmin, der in diesem Fall nicht nur über die Wahrheit, sondern auch über die oft mit ihr verbundene Macht verfügte, von der Wahrheit® zu überzeugen, wird klugerweise nicht erörtert.
- Schließlich setzt Boghossian dazu an, eine Passage aus Ludwig Wittgensteins „Über Gewißheit“ zu diskutieren, in der Wittgenstein den Konflikt einer Gesellschaft, die Orakel befragt, mit einer, die an die Physik glaubt, thematisiert. Allerdings vermeidet Boghossian schließlich doch die abstrakten Fragen Wittgensteins und ersetzt sie durch ein Beispiel aus Edward E. Evans-Pritchards „Hexerei, Orakel und Magie bei den Zande“, von dem er ohne weiteren Nachweis suggeriert, dass Wittgenstein es gekannt haben könnte. Das konkrete Beispiel betrifft die Vererbungslehre männlicher Hexer: Die Zande erzählten den Ethnologen, dass Hexer ihre Fähigkeiten einer Substanz im Magen verdanken, die vom Vater auf den Sohn vererbt werde. Diese Substanz lasse sich im Magen von Hexern nach deren Tod nachweisen. Die Frage der Ethnologen, ob denn aufgrund der Vererbung alle Söhne eines Hexers und wiederum auch deren Söhne usw. Hexer würden, verneinen die Zande. Dies bereitet nun sowohl Evans-Pritchard als auch Boghossian rationale Beschwerden, denn wie können die Zande nur zugleich der Auffassung sein, die Hexer-Substanz werde vom Vater auf den Sohn vererbt und nicht alle Söhne eines Hexer würden zu Hexern? Boghossian erwägt drei mögliche Lösungen für diesen rationalen Konflikt:
- Die Zande könnten einen logischen Fehler begehen.
- Wir könnten aufgrund mangelhafter Übersetzung falsch verstehen, was die Zande meinen.
- Die Zande sind an „den relevanten Sachverhalten nicht sonderlich interessiert“ (S.111).
Weitere Möglichkeiten kommen ihm beim besten Willen nicht in den Sinn. Wie wäre es aber zum Beispiel damit, dass die Zande durchaus dazu in der Lage sind, allgemeine Regeln zu bilden und zugleich im Sinn zu behalten, dass deren Allgemeinheit ein eher unbestimmtes Konzept darstellt. Ich kenne die Zande nun noch weniger als Boghossian, aber wenn es sich um Farmer handelt, so denken sie bei allgemeinen Regeln über die Vererbung der Hexerei-Substanz vielleicht ähnlich wie beim Herauszüchten bestimmter Eigenschaften in der Tierzucht: Die Eigenschaft wird allerdings vom Vater auf die Söhne übertragen, aber eben nicht immer zuverlässig; es sind immer auch Exemplare im Wurf, bei der die gewünschte Eigenschaft nicht auftaucht. Warum sollte das bei der Vererbung der Hexerei anders sein? Wonach fragen denn diese weißen Trottel eigentlich? Das versteht sich doch von selbst. Aufgrund dieser Sachlage ist es wahrscheinlich zu begrüßen, dass sich Boghossian gar keine Gedanken darüber macht, wie die Zande wohl von der Wahrheit® der westlichen Logik zu überzeugen wären.
Wie man leicht sieht, besteht das Hauptproblem an Boghossians Erörterungen, dass er sich auf den eigentlichen Konflikt, dem der Relativismus zu genügen versucht, gar nicht einlässt. In jedem einzelnen Fall steht ohnehin fest, dass die Wahrheit® der jeweils alternativen Position vorzuziehen und nur die Frage der Herleitung dieser Überlegenheit eventuell noch zu klären ist. Lässt sich der Opponent trotz der offenbaren Überlegenheit der Wahrheit® nicht von ihr überzeugen, kann das getrost auf sich beruhen, da er sich ja im Unrecht befindet, und das ist so ziemlich das schlimmste, was einem nach der Auffassung Boghossians geschehen kann.
Dabei will Boghossian aber durchaus nicht auf einer absoluten Überlegenheit der Wahrheit® bestehen. Er ist bereit, die Möglichkeit einzuräumen, man könne auf eine alternative Wahrheit2 stoßen, die der gerade gültigen Wahrheit® überlegen ist:
Es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass uns ein alternatives epistemisches System begegnet, das uns an der Korrektheit unserer eigenen epistemischen Prinzipien zweifeln lässt. Wie sollen wir uns so etwas vorstellen? Nun, wir könnten uns die Begegnung mit einer andersartigen Gesellschaft vorstellen, deren wissenschaftliche und technische Fähigkeiten deutlich fortgeschrittener als unsere wären, obwohl sie fundamentale Aspekte unseres epistemischen Systems ablehnt und alternative Prinzipien befürwortet.
Damit diese Begegnung den erwünschten Effekt haben könnte, müsste dieses alternative epistemische System klarerweise eines aus dem wirklichen Leben sein, mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz, und nicht nur eine theoretische Möglichkeit. Seine tatsächlichen Leistungen müssten hinreichend eindrucksvoll sein, um in uns legitime Zweifel an der Korrektheit unseres eigenen epistemischen Systems zu wecken. (S. 105 f.)
Dies ist der ironische Höhepunkt des Traktats: Boghossian rechnet nicht einmal damit, direkt durch die Wahrheit2 oder das ihr zugrunde liegende epistemische System der „andersartigen Gesellschaft“ überzeugt zu werden, sondern die „nachweisliche Erfolgsbilanz“ ihrer „technischen Fähigkeiten“ ist es, die den Ausschlag geben wird. Hier zeigt sich das vollkommene Unverständnis Boghossians für die von ihm tatsächlich vertretene Position: Die primitiven Wahrheiten sind der Wahrheit® deswegen unterlegen, weil die aus der Wahrheit® entspringende Erfolgsbilanz für sich spricht: fabrikmässiger und entmenschlichter Massenmord, 10.000-facher Overkill, Zerstörung der Welt und systematische Vernichtung des Lebens und der Lebensräume, die Menschheit als Pest des Planeten sind es, die für die Wahrheit® sprechen; und wer sich davon nicht überwältigt zeigt, befindet sich schlicht im Unrecht. Und wenn dann die Außerirdischen kommen, die uns en passant im Vollzug unserer Ausrottung nachweisen, dass wir höchstens Kinder in den Augen der Herrscher der Wahrheit2 sind, dann und erst dann ist es Zeit, der Wahrheit® abzuschwören und zu neuen Göttern zu beten, so lange man es noch kann.
Warum diese Angst vor der Wahrheit? Woher kommt dieses Bedürfnis, sich gegen ihre segensreichen Wirkungen schützen zu wollen? (S. 133 f.)
Ja, woher nur?
Paul Boghossian: Angst vor der Wahrheit. Aus dem Amerikanischen von Jens Rometsch. stw 2059. Berlin: Suhrkamp, 2013. Broschur, 164 Seiten. 14,– €.
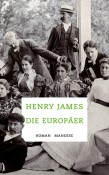 Bei „Die Europäer“ handelt es sich um einen kurzen, frühen Roman von Henry James (je nachdem, ob man „Watch and Ward“ als vollwertigen Roman gelten lässt, handelt es sich um seinen dritten oder vierten). Er ist 1878 erschienen, seine Handlung ist aber – wie die zahlreicher anderer Texte James’ auch – deutlich vor dem Amerikanischen Bürgerkrieg in Boston angesiedelt. Die Europäer des Romans sind zwei Geschwister, Baronin Eugenia Münster (im Original Munster, was akustisch deutlich näher bei Monster liegt) und ihr jüngerer Bruder Felix Young, ein immer gut gelaunter Liebhaber der Malerei. Die Baronin floh vom alten Kontinent, da ihre Ehe zum Bruder des regierenden Fürsten von Silberstadt-Schreckenstein in einer Krise steckt: Der Fürst möchte seinen Bruder gern standesgemäß verheiraten und daher dessen morganatische Ehe mit Eugenia lösen; da er aber nicht nur ein schreckensteinischer Herrscher, sondern auch ein Gentleman ist, macht er die Verwirklichung seiner Pläne von Eugenias Zustimmung abhängig.
Bei „Die Europäer“ handelt es sich um einen kurzen, frühen Roman von Henry James (je nachdem, ob man „Watch and Ward“ als vollwertigen Roman gelten lässt, handelt es sich um seinen dritten oder vierten). Er ist 1878 erschienen, seine Handlung ist aber – wie die zahlreicher anderer Texte James’ auch – deutlich vor dem Amerikanischen Bürgerkrieg in Boston angesiedelt. Die Europäer des Romans sind zwei Geschwister, Baronin Eugenia Münster (im Original Munster, was akustisch deutlich näher bei Monster liegt) und ihr jüngerer Bruder Felix Young, ein immer gut gelaunter Liebhaber der Malerei. Die Baronin floh vom alten Kontinent, da ihre Ehe zum Bruder des regierenden Fürsten von Silberstadt-Schreckenstein in einer Krise steckt: Der Fürst möchte seinen Bruder gern standesgemäß verheiraten und daher dessen morganatische Ehe mit Eugenia lösen; da er aber nicht nur ein schreckensteinischer Herrscher, sondern auch ein Gentleman ist, macht er die Verwirklichung seiner Pläne von Eugenias Zustimmung abhängig.