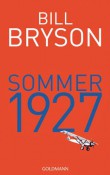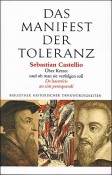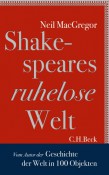Though it might be nice to imagine there once was a time when man lived in harmony with nature, it’s not clear that he ever realy did.
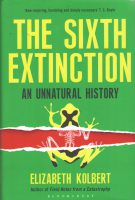 Ein verbreitetes paläontologisches Modell geht davon aus, dass es im Laufe der Geschichte des Lebens auf der Erde fünf Zeiten des großen Artensterbens gegeben hat, die jeweils die Voraussetzung für eine neue Richtung der evolutionären Entwicklung bildeten. Es gibt guten Gründe dafür anzunehmen, dass wir alle in der sechsten dieser Perioden leben und dass der Mensch eine der wesentlichen Ursachen für das beschleunigte Verschwinden von Tierarten auf dem gesamten Planeten darstellt.
Ein verbreitetes paläontologisches Modell geht davon aus, dass es im Laufe der Geschichte des Lebens auf der Erde fünf Zeiten des großen Artensterbens gegeben hat, die jeweils die Voraussetzung für eine neue Richtung der evolutionären Entwicklung bildeten. Es gibt guten Gründe dafür anzunehmen, dass wir alle in der sechsten dieser Perioden leben und dass der Mensch eine der wesentlichen Ursachen für das beschleunigte Verschwinden von Tierarten auf dem gesamten Planeten darstellt.
Dieses sechste Sterben (wie der deutsche Titel des Buches lautet) stellt Elizabeth Kolbert in groben Zügen dar; ergänzt werden die eher unsystematischen Erzählungen vom Artensterben hier und da und dann und wann von einer wissenschaftshistorischen Darstellung, wie das Konzept des Aussterbens überhaupt entwickelt wurde und sich durchsetzen konnte, da natürlich in der vollkommenen Schöpfung eines Gottes für den Gedanken daran, dass ganze Arten von Tieren ausgestorben seien, nur wenig Raum war. Inzwischen ist nicht nur das Konzept des Artensterbens jedem Kind geläufig, sondern man kann sich der Autorin ohne Probleme darin anschließen, dass das derzeitige Artensterben wahrscheinlich die dauerhafteste Auswirkung der Existenz der Menschheit auf den ihn umgebenden Kosmos darstellt.
Wenn man Kolberts journalistischen Ton und ihr zeitweiliges Abschweifen in Erlebnisaufsatz-Prosa einmal als populäre Elemente ihres Stils akzeptiert, so kann man dem Buch wohl nur vorhalten, dass es sich bei der von ihm gestellten Frage nach der Stellung des Menschen innerhalb oder außerhalb der Natur nicht entscheiden kann: Einerseits möchte die Autorin das vom Menschen verursachte Artensterben als eine moralisch verwerfliche und daher möglichst rasch zu unterbindende Handlung verurteilen, andererseits möchte sie evolutionär argumentieren und aus dieser Sicht ist der Mensch eine Art wie alle anderen Arten und sein zerstörerisches Verhalten eben das, was er tut. Ein Virus, der Wirtstiere tötet, ist moralisch vollständig neutral zu betrachten; er ist weder gut noch böse, sondern Teil eines natürlichen Prozesses, der selbst ohne Ziel oder Zweck abläuft. Es ist aus evolutionärer Sicht nicht gut einzusehen, warum der Mensch eine andere Position ein nehmen sollte. Jede Unterscheidung zwischen Natur und Zivilisation, zwischen menschlichem und natürlichem Verhalten etc. wird angesichts des blinden Prozesses der Evolution scheitern. Was immer die Menschen tun – von der Ausrottung der anderen Menschenarten auf diesem Planeten bis zur systematischen Vernichtung von Lebensraum und Artgenossen – muss aus der Sicht der Natur als sein artspezifisches Verhalten angesehen werden und ist, aus der neutralen Perspektive einer Paläontologie der Menschheit, nur eine Katastrophe mehr, die das Leben auf diesem Planeten überstehen wird.
Das Auftauchen und letztendliche Verschwinden der Menschheit ist nichts anderes als der Meteoriteneinschlag, der die Dinosaurier hat verschwinden lassen: eine Naturkatastrophe, der einige Arten zum Opfer fallen werden, die aber der Entwicklung des Lebens auf diesem Planeten wahrscheinlich nur eine neue Richtung geben wird. In einer oder zwei Millionen Jahren wird hoffentlich von uns keine Rede mehr sein. Manche mögen das bedauerlich finden, aber das tun einige Kinder auch mit Blick auf die Dinosaurier.
Elizabeth Kolbert: The Sixth Extinction. An Unnatural History. London u.a.: Bloomsbury, 2014. Kindle-Edition, 336 Seiten (Druckversion). 4,81 €.