Marius Fränzel
Die Schachstellen bei Arno Schmidt
Ein kommentierendes Verzeichnis
Vorbemerkung
Das nachfolgende Verzeichnis erhebt nicht den Anspruch, alle Textstellen bei Arno Schmidt zu erfassen, an denen das Wort Schach einzeln oder in Kombination mit anderen vorkommt. Weder wird „Schach Gebal“ angeführt, noch „Schachbrettlandschaften“ oder „schachbrettförmig“, noch gar die bei Schmidt häufig vorkommenden „Schachteln“. Angeführt werden nur solche Stellen, an denen sich mehr oder weniger sinnvoll ein schachlich orientierter Kommentar anbringen läßt. Halbfett gesetzter Text stammt von Arno Schmidt und wird, so nicht anders angegeben, nach der CD-ROM-Ausgabe der Bargfelder Ausgabe unter Angabe von Werkgruppe, Band und Seite bzw. nur der Seitenzahl in eckigen Klammern zitiert. Zettel’s Traum wird einstweilen noch nach der mit der Erstausgabe seiten- und zeilenidentischen 3. Auflage zitiert. Dabei können insbesondere die Zeichensetzung und die typographische Gestalt von den gedruckten Ausgaben abweichen, die bei Übernahme von Zitaten als eigentliche Referenz herangezogen werden müssen. Bei Wiederholungen des Textes im Kommentarteil, kann der Text syntaktisch oder grammatikalisch verändert erscheinen. Auslassungen werden grundsätzlich mit […] markiert.
Für alle gezeigten Diagramme gilt, daß Weiß von unten nach oben, Schwarz dementsprechend von oben nach unten spielt. Die senkrechten Linien sind von links nach rechts mit a bis h bezeichnet, die waagerechten Reihen von unten nach oben mit 1 bis 8. Die Züge setzen sich in der Regel aus einem Großbuchstaben, einem Kleinbuchstaben und einer Ziffer zusammen und bezeichnen die gezogene Figur (K: König; D: Dame; T: Turm; L: Läufer; S: Springer; ohne Großbuchstaben: Bauernzug) und das Feld, auf das die Figur gezogen wird. Können zwei Figuren der gleichen Art und Farbe auf ein bestimmtes Feld ziehen gibt ein zusätzlicher Kleinbuchstabe bzw. eine zusätzliche Ziffer die Linie oder Reihe auf der die Figur vor dem Zug stand. Ein x zeigt an, daß auf dem angegebenen Feld eine gegnerische Figur geschlagen wird. Direkt nach einer Ziffer zur Bezeichnung der Zugnummer folgt immer ein weißer Zug, dann ein schwarzer Zug. Zieht Schwarz in einer Stellung an, ist der Zug mit einer Ziffer und … gekennzeichnet. Zum Beispiel:
1.e4 (Weiß bewegt den Bauern vor seinem König zwei Felder
vorwärts.)
1… d5 (Schwarz bewegt seinen Bauern nach d5.)
2.exd5 Sf6 (Weiß schlägt mit seinem e-Bauern auf d5; Schwarz zieht
seinen Springer nach f6.)
Anmerkungen, Korrekturen oder Ergänzungen sind gerne willkommen; schreiben Sie mir einfach eine Mail. Allen, die zu dieser Seite beitragen werden oder bereits beigetragen haben, sei herzlich gedankt!
Einleitung
Doch einen wollen wir nicht vergessen:
Schmidt. Unbesiegt im Schachspiel und im Fressen.
Natürlich erscheint es dem ersten Nachdenken als ein merkwürdiges Projekt, gerade die Schachstellen im Werk Arno Schmidts zu dokumentieren und zu kommentieren: Gibt es nichts Wichtigeres in diesem doch umfangreichen Œuvre aufzufinden und zu kommentieren als gerade Bemerkungen über das Schachspiel? Sicherlich gibt es das, und es ist zu vermuten und zu hoffen, das all das Wichtigere im Laufe der Zeit auch gesammelt und kommentiert werden wird. Viele der Wirklichkeitsdetails in Schmidts daran so reichen Büchern sind schon heute jungen Lesern nurmehr mittels einer Kommentierung zugänglich und verständlich zu machen.
Zur Verteidigung des hier unternommenen und sicherlich gänzlich unnützen Kommentars habe ich allein zwei Dinge anzuführen: Zum ersten, daß es sich um ein seit langer Zeit oft scherzhaft erwähntes Projekt handelt, die Schachstellen einmal aufzulisten und zu kommentieren. Als sich dann die Notwendigkeit ergab, die ersten Gehversuche in HTML an irgendeinem konkreten Fall durchzuführen, erschien mir ein Kommentar der Schachstellen bei Arno Schmidt so gut wie irgendein anderer und immerhin noch besser als die allseits beliebte Hello-World-Seite. Zum zweiten wird es auf lange Sicht ziemlich gleichgültig sein, welche Motivgruppen in den Büchern Schmidts zuerst und welche zuletzt kommentiert worden sind. Und da ich der Illusion unterliege, zum Kommentieren der Motivgruppe der Schachstellen mindestens ebenso gut geeignet zu sein, wie jeder beliebige andere Leser Arno Schmidts, so muß dies Rechtfertigung genug sein für etwas, das als solches ja kaum von irgend einem Belang ist und schon vor daher kaum einer Rechtfertigung bedarf.
Bereits die Sichtung des vorhandenen Materials macht deutlich, daß es sich beim Motiv des Schachspiels zwar um ein Nebenmotiv des Werks handelt, aber um eines, das mit großer Konstanz durch alle Werkbereiche und -phasen hindurch auftaucht. Schmidts Selbstbeschreibung, er sei in seiner Zeit als als kaufmännischer Volontär und Angestellter […] dem Schachspiel erregt zugetan gewesen, verweist auf die biographische Ursache dieses Sachverhalts. Besonders die Stellen des Frühwerks machen deutlich, daß Schmidt in jungen Jahren das Schachspiel als Kulturgut hoch geschätzt und als der von ihm über alles verehrten Literatur beinahe gleichrangig geachtet hat. Diese Hochschätzung läßt dann im Laufe der Jahre nach, das Schachspiel sinkt bis zum wortlosen Künstlein herab, verschwindet aber bis zum Ende nicht aus dem Denken und Schreiben des Autors.
Nun sollte dies nicht überschätzt werden: Spätestens seit dem 18. Jahrhundert gibt es eine Reihe von Autoren – von denen einige wie Heinse, Jean Paul, Poe oder Carroll auch zu Schmidts Hausgöttern gehören – in deren Werk das Schachspiel eine mehr oder weniger prominente Rolle einnimmt. Schmidt nimmt in dieser Reihe weder als Verwender von Schachmotiven noch als Spieler eine besondere Position ein, ja, er kann sich mit jemandem wie etwa Vladimir Nabokov, der es auch als Komponist von Schachaufgaben zu einiger Bekanntheit gebracht hat, kaum messen. Aber Schmidt ist eben doch ein Glied dieser Kette schachspielender und -liebender Autoren und vielleicht nicht ihr schwächstes.
Überraschend ist für denjenigen, der selbst aktiv Schach spielt, Schmidts beinahe vollständige Ignoranz für die Entwicklung und die Geschichte des Spiels im 20. Jahrhundert. Zwar erwähnt er häufig die Eröffnung b2-b4, und einer seiner Protagonisten hat einst in einem Simultan gegen Aljechin oder Bogoljubow gespielt, auch fallen die Namen Botwinnik und Smyslow an einer Stelle, aber das ist auch beinahe schon alles, was sich vom Schachleben zu Schmidts Lebenszeit in seinen Büchern wiederfinden läßt. Einzig an einer Stelle von Das steinerne Herz geht er auf die Entwicklung der sowjetischen Schachschule ein; allerdings sind Schmidts Anmerkungen historisch schief und rein ideologischer Natur. Darüber hinaus gibt keinen Hinweis, daß Schmidt auch nur die Kämpfe um die Weltmeisterschaft aktiv mitverfolgt hätte, ja, der skandalumwitterte Wettkampf im Jahr 1972 zwischen Boris Spassky und Robert Fischer, in den Medien als ‚Kampf der Systeme‘ ausgeschrieen und jedes Hinweises auf die fiktive Weltmeisterschaft in Schmidts Gelehrtenrepublik wert, wird mit keinem einzigen Wort erwähnt. Fast scheint die Schachwelt des 19. Jahrhunderts in Schmidts Texten lebendiger zu sein als die der Moderne.
Das Gesamtbild, das sich ergibt, kann ungefähr wie folgt umrissen werden: Schmidt ist in jungen Jahren ein leidenschaftlicher Schachspieler, der vor dem Zweiten Weltkrieg das Spiel mit einiger Ernsthaftigkeit betrieben hat. Erlernt hat er das Spiel offenbar durch das Studium des weitverbreiteten Lehrbuch des Schachspiels von Dufresne und Mieses. Wie weit er es im Spiel gebracht hat, läßt sich nur vermuten, allerdings gibt es für seine Behauptung, er habe einmal den schlesischen Meister Gottlieb Machate geschlagen, keine unterstützenden Indizien. Die Partien jedenfalls, die durch das Tagebuch seiner Frau überliefert sind, lassen die dafür notwendige Spielstärke nicht erkennen. Nach 1945 scheint Schmidt in Sachen Schach hauptsächlich von seinem vor dem Krieg erworbenen Wissen zu zehren. Zwar pflegt er mit seiner Frau weiterhin das häusliche Spiel, hat aber seine frühere intensive Leidenschaft für das Spiel weitgehend verloren. Auch war er wohl, um eine Wendung Uwe Johnsons zu gebrauchen, „schon zu weit von der Welt entfernt, um einen Menschen wenigstens bis zum gemeinsamen Schachspiel zu befreunden.“
Dennoch bleibt das Schachspiel ein wichtiges und immer präsentes Motivfeld, das Schmidt überdurchschnittlich häufig benutzt. Einige der wiederkehrenden Motive sind am Ende des Einzelstellenkommentars zusammengefaßt und noch einmal im Zusammenhang kommentiert.
Die Insel. – 1. Teil: Das Schloß in
Böhmen
[Niederschrift 1937; BA I/4, S. 185–222.]
- Einmal hatte er den geheimnisvollen Brief auch gesehen: »Sir John Cochrane, Kalkutta« stand darauf. Diese letzte bemerkung interessierte mich aufs lebhafteste; Cochrane, ein name, der jedem schachspieler geläufig war, wie das alphabet; [193]
-
Der Schotte John Cochrane (1798–1878) war einer der stärksten Schachspieler seiner Zeit. Nach einer militärischen Karriere in der englischen Marine – Cochrane war Leutnant zur See auf dem Linienschiff Bellerophron, als dies Napoleon 1815 ins Exil nach St. Helena brachte –, lebte er als Barrister in London. Im Jahr 1821 reiste er zusammen mit William Lewis nach Paris und spielte dort eine Reihe von Partien gegen Deschapelles und La Bourdonnais. Ein Jahr später veröffentlichte er seinen Treatise on Chess. Er verließ England 1824 und lebte und arbeitete mit einer Unterbrechung Anfang der 40er Jahre bis 1869 in Indien. Da die Handlung von Die Insel genau 100 Jahre vor der Niederschrift in das Jahr 1837 datiert, stimmt die Anschrift auf dem Brief mit den historischen Tatsachen gut überein.
Cochrane ist weitgehend vergessen, auch wenn eine Variante des Königsgambits heute noch nach ihm benannt ist.
Eine kleine Koinzidenz ergibt sich in Verbindung mit der ersten der beiden Partien, die sich in Alice Schmidts Tagebuch gefunden haben. Die Eröffnung dieser Partie ist das Ghulam-Kassim-Gambit, eine Varianten des Königsgambits. Ghulam Kassim aber ist der Co-Autor der wahrscheinlich ersten Eröffnungsmonographie überhaupt, die 1829 in Madras veröffentlicht wurde. Der zweite Co-Autor ist ein James Cochrane, der öfter mit dem damals in Kalkutta lebenden John Cochrane verwechselt wird.
Links:
http://snow.prohosting.com/~batgrrl/PGN/Cochrane.htm
http://www.ballo.de/Partien/zettel_49-54.htm - ich sebst hatte vor einigen Jahren einigemale dem, wie ich glaube, auch jetzt noch besten spieler der welt, Charles de la Bourdonnais, in Paris gegenübergesessen […]. Zwar hatte ich viermal verloren, aber eine partie doch unentschieden halten können; [193 f.]
-
Louis-Charles Mahé de La Bourdonnais (1797–1840) gilt allgemein als der stärkste Spieler der 30er Jahre des 19. Jahrhunderts. Seinen Lehrmeister Deschapelles besiegte er 1821 in einem Wettkampf, und nach seinem Sieg im Zweikampf gegen Alexander MacDonnell im Jahr 1834 (+44 -30 =14) galt er unangefochten als der beste Spieler Europas. Im Jahr 1836 begründete La Bourdonnais in Paris die erste Schachzeitung der Welt, Le Palamède, die unter seiner Leitung bis 1839 erschien.
Der Ich-Erzähler zeigt sich hier von einer ungewöhnlichen Bescheidenheit, wenn er einräumt, vier Partien gegen La Bourdonnais verloren zu haben. Immerhin macht er seinen Rang als Spieler dadurch klar, daß er vorgibt, eine Partie Remis gehalten zu haben. Wir werden von den Schachkünsten des Erzählers noch genaueres erfahren.
- Ich schritt zum grafen und bot ihm höflich einen guten abend, als ich sah, dass er und der archivar ein schachbrett vor sich liegen hatten, auf dem augenscheinlich ein endspiel aufgebaut war. […] Ich setzte mich mit gespieltem zögern dem archivar gegenüber und sah, während wir die schönen grossen figuren aufstellten, wie der graf mich tollkühnen belustigt, wenn auch kaum merkbar, anlächelte. Ich hatte weiss gewählt, und also den ersten Zug zu tun. [199]
-
Die Konvention, daß Weiß die Partie beginnt, bestand übrigens 1837 durchaus noch nicht, sondern es wurde damals ausgelost, wer die Partie beginnt. Erst der Übergang von der beschreibenden zur algebraischen Notation machte eine größere Normierung in Sachen Anzug und Aufstellung der Steine (die weißen Steine stehen zu Anfang auf den Feldern der 1. und 2. Reihe, die schwarzen auf denen der 7. und 8.) sinnvoll.
Die nun im Text folgende Partie wurde 1841 in London zwischen John Cochrane (s.o.) und George Walker gespielt. Schmidt hat diese Partie aus dem Lehrbuch des Schachspiels von Dufresne und Mieses gekannt, das überhaupt die Hauptquelle seiner Schachkenntnisse zu sein scheint. Diese Partie läßt sich bis zur 7. Aufl. des Lehrbuchs von 1901 zurückverfolgen, der ersten Auflage, die Jacques Mieses betreut hat. Die Herkunft aus dieser Quelle läßt sich einigermaßen dadurch sichern, daß Schmidts Kommentar zum 11. Zug von Schwarz – Das war nicht sein bester zug; ich hätte Lf8 – c5 für eine stärkere spielweise gehalten – eine Paraphrase desselben Kommentars aus dem Lehrbuch ist. (Die Auflage, die Schmidt am wahrscheinlichsten wird in seiner Vorkriegsbibliothek besessen hat, dürfte die 11. Aufl. von 1926 gewesen sein. In seiner Nachlaßbibliothek findet sich die 18. Aufl. von 1950, die die verlorene Vorkriegsausgabe ersetzt hat [Bibliotheksverz. 968.1].)
Die 11. Aufl. des Lehrbuchs gibt zu dieser Partie übrigens über die Spielernamen hinaus keine weiteren Daten an. Es mag also sein, daß Schmidt bei der Niederschrift der Insel nicht gewußt hat, daß die reale Vorlage erst vier Jahre nach der fiktiven Partie auf Schloß Friedland gespielt wurde. Es wäre sonst von besonderer Bosheit, daß Cochrane, mit dem der Hausherr ja in brieflichem Kontakt steht, nur die Idee des Erzählers kopiert. Aber – wie gesagt – diese Pointe könnte sich eher zufällig ergeben haben.
- Diese Eröffnung, wurde erst einige jahre später genauer untersucht, anlässlich einiger wettkämpfe zwischen den schachgesellschaften von London und Edinburgh; ich hatte sie jedoch öfters mit bourdonnais durchgesprochen und kannte ihre varianten ziemlich gut. [200]
-
Diese Bemerkung bezieht sich auf die oben angeführte Partie, spricht also von der angewendeten Schottischen Eröffnung. Nun sind Formulierungen wie wurde erst einige jahre später genauer untersucht unbestimmt genug, um einen weiten Raum für Interpretationen zuzulassen. Das schon oben angeführte Lehrbuch des Schachspiels [11. Aufl., 1926] schreibt dazu richtig:
Diese Eröffnung […] verdankt ihren Namen einigen so beginnenden, zwischen den Schachgesellschaften von Edinburgh und London im Jahre 1824 gespielten Korrespondenzpartien, in denen das Spiel der Schotten durch Schönheit und Gedankentiefe sich auszeichnete.
Hier scheint sich der Erzähler also gründlich zu irren. Es war übrigens John Cochrane, der 1824 noch vor seiner Abreise nach Indien die Edinburgher Schachfreunde veranlaßte, die Schottische Eröffnung für den Wettkampf zu wählen. Wahrscheinlicher wäre es daher, daß der Erzähler diese Eröffnung bei seinen Partien gegen La Bourdonnais kennengelernt hätte, der sie wiederum 1821 beim Wettkampf mit John Cochrane gesehen haben würde.
Dichtergespräche im Elysium – 10. Gespräch.
Ein Zwischenspiel
[Niederschrift 1940/41; BA I/4, S. 289–292.]
- HERODOT: Gut, daß ihr die Universität erwähnt. Es sind diesen Winter wieder überaus treffliche Kollege zu hören; ich habe mich schon beim Morphy eingeschrieben. [291]
-
Paul Morphy (1837–1884) gilt nicht nur als der beste Schachspieler des 19. Jahrhunderts, sondern als einer der besten Schachspieler überhaupt. Morphy wurde in New Orleans geboren und erlernte das Schachspiel im Alter von 10 Jahren von seinem Vater und seinem Onkel, die beide begeisterte Schachspieler waren. Morphy entpuppte sich als das erste Schach-Wunderkind, von dem die Welt weiß: Innerhalb von zwei Jahren entwickelte sich sein schachliches Talent so weit, daß ihm kein lokaler Spieler mehr gewachsen war. 1850 schlug er den ungarischen, in Amerika lebenden Berufsschachspieler Löwenthal in drei Partien hintereinander; Morphy muß bereits zu diesem Zeitpunkt als ein Meisterspieler betrachtet werden. Nach dem erfolgreichen Abschluß eines Jura-Studiums widmete sich Morphy eine kurze Zeit lang ausschließlich dem Schachspiel: 1857 gewinnt er die amerikanische Schachmeisterschaft in New York und deklassierte dabei unter anderem mit Louis Paulsen einen der besten Spieler der Zeit. Im Juni 1858 begibt sich Morphy nach Europa, zuerst nach England, um sich mit dem damals besten englischen Spieler Howard Staunton zu messen, der einem Wettkampf aber sorgsam auswich, dann nach Paris, wo er im Dezember 1858 dem aus Breslau stammenden Adolf Anderssen, der nach seinem Sieg im Londoner Turnier von 1851 als bester europäischer Schachspieler galt, eine deutliche Niederlage zufügte (+7 -2 =2). Anderssen räumte die klare Überlegenheit seines Gegners unumwunden ein: „Der Mann spielt wie von einer anderen Welt.“
Nach seiner triumphalen Rückkehr nach Amerika versucht Morphy als Anwalt Fuß zu fassen, was ihm aber offenbar nicht gelingen will. Er verfällt in Depressionen, zieht sich immer mehr aus dem öffentlichen Leben zurück. Nach seinem Wettkampf gegen Anderssen hat Morphy kein Turnierschach mehr gespielt, ja er hat mit den Jahren wohl eine Abneigung gegen das Spiel entwicklelt. Sein glänzender Aufstieg und der sich anschließende vollständige Rückzug vom Spiel und schließlich vom gesellschaftlichen Leben überhaupt, haben einen Morphy-Mythos hervorgebracht, der bis heute nachwirkt.
In Arno Schmidts Nachlaßbibliothek findet sich als einziges Schachbuch neben dem Lehrbuch von Dufresne und Mieses die Morphy-Monographie von Geza Maróczy: Paul Morphy. Sammlung der von ihm gespielten Partien mit ausführlichen Erläuterungen. Berlin: de Gruyter. Reprint der Ausg. von 1909. [Bibliotheksverz. 968.2]
Zwei Dinge erscheinen an Morphys Anwesenheit im Schmidtschen Elysium bemerkenswert:
Zum einen, daß sich Morphy überhaupt im Elysium befindet: Mußte bei Schopenhauer dessen Anwesenheit noch besonders damit begründet werden, daß er ja auch Gedichte verfaßt habe – POE: […] du solltest dich freuen, daß du, wenn auch nur in deiner Jugend, Gedichte schriebst: das rettete dich hierher! (lächelnd) Selbst wenn du auch Harz und schwarz aufeinander reimtest [I/4, 242] –, entfällt eine solche Begründung bei Morphy schlicht. Offenbar sieht Schmidt zu dieser Zeit das Schachspiel als eine für das Elysium qualifizierende Kunstform an.
Zum anderen ist bemerkenswert, daß sich Morphy im Elysium offenbar wieder dem Schachspiel zugewandt hat, obwohl er in den späteren Jahren seines Lebens eine offensichtliche Abneigung dagegen entwickelt hatte. Dies ist nur dann wirklich bemerkenswert, wenn wir voraussetzen, daß Schmidt einige Kenntnis des Lebens von Paul Morphy besaß, was nicht ohne weiteres getan werden kann. Sollte Schmidt allerdings den Morphy-Mythos gekannt haben, so könnte – ich betone: könnte – Morphy ein Beispiel für einen Künstler sein, der an der Realität zerbricht, im Elysium aber geheilt wird, weil er sich dort unter seinesgleichen befindet.
- FISCHART: Ich weiß; ‹über die skandinavische Eröffnung, für die Jugend an abschreckenden Beispielen erläutert› – Ich weiß noch nicht, ob ich hingehe, ich habe doch erst von Philidor Schachspielen gelernt. Ob ich da mitkomme? [291]
-
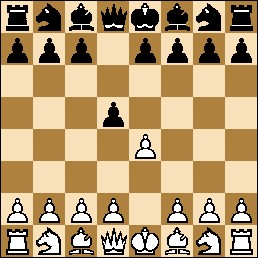
Bei der Skandinavischen Eröffnung oder besser: Skandinavischen Verteidigung handelt es sich um die Züge 1.e4 d5. Sie steht bei den allermeisten Schachspieler in keinem guten Ruf und kommt in der Turnierpraxis seltener vor. Allerdings gibt es auch für diese Eröffnung Spieler, die ihre Vorteile theoretisch zu demonstrieren und in der Praxis zu beweisen versuchen. So macht sich etwa der deutsche Großmeister Matthias Wahls seit vielen Jahren für Skandinavisch stark, das er als eine vollwertige Alternative zu den gebräuchlicheren Antworten auf 1.e4 ansieht. Der ironisch schillernde Titel von Morphys Kolleg könnte eine Anspielung auf den Kurzsieg sein, den Morphy 1858 in Paris gegen Anderssens Skandinavische Verteidigung erzielte.
François André Danican Philidor (1726–1795) gilt als bedeutendster Meister des 18. Jahrhunderts. Sein Buch L’Analyse du jeu des Echecs (1749) wird heute als wichtiger Schritt auf dem Weg zum modernen, positionellen Schach gewertet. Philidor war der erste Theoretiker, der die Bedeutung der Bauernstruktur für die Stellungsbewertung erkannte. Seine Einsicht „Die Bauern sind die Seele des Schachspiels“ wurde eigentlich erst 100 Jahre später von Steinitz völlig verstanden und weiterentwickelt. Philidors Anwesenheit im Elysium ist natürlich allein schon durch seine Tätigkeit als Opernkomponist begründet. Mag sein, daß er sich für die Aufnahme Morphys stark gemacht hat.
- MARCO POLO: 140 Jahre erst? Ts, ts – wenig! Aber versucht es nur; es ist zu interessant. Vor 3 Jahren hatte er mit Poe einen scharfen Zusammenstoß, der dahin ging, ob man, wenn einem nur die Züge des Weißen gegeben sind, die des Schwarzen, also das ganze Spiel, finden kann. Es dauerte eine ganze Zeit, bis wir nur die ungeheuerlichen Schwierigkeiten begriffen hatten; aber Poe hat’s gemacht. Sogar Morphy hat gestaunt, obwohl er natürlich besser spielt. [291]
-
Die 140 Jahre beziehen sich auf die Ankunft Philidors im Elysium nach seinem Tod 1795; das elysische Gespräch, dem wir hier folgen, findet also 1935 oder wenig später statt.
Edgar Allan Poe hegte, wenn wir seinen Schriften glauben dürfen, zu Lebzeiten keine besondere Vorliebe für das Schachspiel. Im einleitenden Teil seiner Erzählung The Murders in the Rue Morgue zieht er das Kartenspiel Whist dem Schach bei weitem vor: „Whist has long been known for its influence upon what is termed the calculating power; and men of the highest order of intellect have been known to take an apparently unaccountable delight in it, while eschewing chess as frivolous.“ Er vertritt die Auffassung, das Schachspiel beruhe nur auf Berechnung, aber nicht auf Analyse, die als Geistestätigkeit weit höher anzusetzen sei. Die unterschiedlichen und ‚bizarren‘ Gangarten der Figuren und daraus folgend ihr unterschiedlicher Wert erzeuge das Mißverständnis: „what is only complex, is mistaken (a not unusual error) for what is profound.“ Letztlich beruhe ein Sieg nur auf Konzentration, nicht auf der Fähigkeit, genau zu analysieren: „in nine cases out of ten, it is the more concentrative rather than the more acute player who conquers.“ Selbst das Damespiel zieht er dem Schach deutlich vor, weil hier die unterschiedliche Gangart der Steine nicht vorhanden ist. „The best chess-player in Christendom may be little more than the best player of chess“. Diese mangelnde Wertschätzung des Schachspiels dürfte Schmidt durchaus bekannt gewesen sein, als er die Dichtergespräche im Elysium schrieb.
Der Gegenstand des Streits zwischen Poe und Morphy gehört zu den in den Werken Schmidts immer wieder auftauchenden Schach-Motiven (eine Sammlung übergreifender Motive findet sich am Ende dieses Einzelstellenkommentars). Die Aufgabe, allein aus den Zügen der weißen Steine eine vollständige Partie zu rekonstruieren, ist allerdings von ungeheuerlicher Schwierigkeit. Doch braucht es wohl nicht sehr viel Einsicht in das Schachspiel, um dies zu begreifen.
Diese Frage ist eng verbunden mit einer anderen, die die Schachspieler späetstens seit dem 20. Jahrhundert beschäftigt: Gibt es einen notwendigen Ausgang einer Schachpartie, d.h.: genügt der Anzugvorteil dem Weißen, um die Partie notwendig zu gewinnen, oder gibt es einen objektiven Ausgleich, der ‚bei bestem Spiel beiderseits‘ die Partie remis enden läßt. Schach ist, mathematisch gesprochen, ein ‚endliches Spiel‘: 32 Figuren können auf 64 Felder nur eine endliche Anzahl von Stellungen erzeugen, von denen zudem ein großer Teil illegal ist, d.h. in einer nach den Schach-Regeln aus der Ausgangsstellung heraus gespielten Partie gar nicht vorkommen kann. Die legalen Stellungen haben durch die Regeln für das Ziehen und Schlagen der Figuren einen gesetzmäßigen Zusammenhang untereinander, so daß sich wenigstens theoretisch der Sachverhalt ergibt, daß sich sämtliche möglichen Endstellungen aus der Ausgangsstellung auf genau beschreibbare Weise herleiten lassen. In einem Satz: Schach ist grundsätzlich lösbar. Allerdings ist die Anzahl auch nur der legalen möglichen Stellungen ungeheuerlich groß: Der Mathematiker und Schach-Großmeister Dr. John Nunn hat eine Abschätzung vorgenommen, die zu dem Ergebnis kommt, daß wenn man in der Lage wäre, jeweils eine Schachstellung auf einem Elementarteilchen zu speichern, es bei Anwendung von sinnvollen Reduktionsverfahren theoretisch möglich wäre, die für die Lösung des Spiels relevanten Stellungen in der Materie mehrerer Galaxien abzuspeichern. Er gibt allerdings gleich selbst zu bedenken, daß es wahrscheinlich den Widerstand von Umweltschützern wachrufen würde, wenn man versuchte, Galaxien als Speichermedium für Schachstellungen zu benützen.
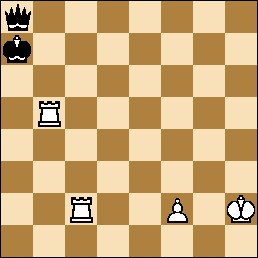
Solche Überlegungen nützen dennoch: Seit einigen Jahren arbeiten Programmierer an Datenbanken, die überschaubare Teilmengen dieser Datenflut enthalten. Zur Zeit sind alle Fünfsteiner berechnet (alle Stellungen mit den beiden Königen und drei zusätzlichen Steinen) und einige Sechssteiner. Auf die Fünfsteiner-Datenbanken können die leistungsfähigen, kommerziellen Schachprogramme heute problemlos zugreifen. Diese Programm spielen also alle Stellungen mit fünf oder weniger Figuren auf dem Brett wie Gott: Sie kennen zu jeder Stellung eine absolute Bewertung (remis, gewonnen für Weiß bzw. Schwarz) und den oder die richtigen Züge, um diese Bewertung zu realisieren. Bei den Sechssteinern sind dabei Stellungen entdeckt worden, deren Realisierung jede menschliche Vorstellungskraft übersteigt. In der scheinbar einfachen Stellung oben (Schwarz am Zug) bedarf es eines Lavierens von unvorstellbaren 166 Zügen, bis der weiße Bauer zum ersten Mal gezogen werden kann, und insgesamt 254 Zügen, bis Weiß die Stellung für sich entscheiden kann. Um es mit einem Satz von GM Dr. Robert Hübner zu sagen: „Viel zu schwierig ist das Schachspiel für das kleine Menschenhirn.“
Hieraus ergibt sich nun ein Rückschluß für das Problem, das Edgar Poe im Elysium angeblich gelöst hat. Eine Lösung des Problems, aus den weißen Zügen allein den kompletten Spielverlauf einer Partie zu ermitteln, setzt eine Art des Partieführung voraus, in der die Züge mit einer unausweichlichen Notwendigkeit einander folgen. Eine solche unabweisbare Notwendigkeit liegt dem Spiel aber nur auf einer sehr theoretischen Ebene zugrunde, während die menschliche Praxis des Spiels ganz anderen Gesetzen gehorcht. Nehmen wir ein einfaches Beispiel, ein Schäfermatt: 1.e4 2.Lc4 3.Df3 4.Dxf7# – wie um alles in der Welt sollte man in einer solchen Partie die schwarzen Züge erschließen? Schwarz könnte etwa zuerst den h-Bauern zweimal gezogen haben und dann den a-Bauern einmal; oder er hat die Züge e5, Sc6, und d6 gespielt, und selbst dann wäre ihre Reihenfolge vollständig unerfindlich.
Es soll hier nicht bestritten werden, daß es tatsächlich einzelne Spielverläufe geben mag, die man aus den weißen Züge allein erraten kann (um nicht von ‚erschließen‘ zu sprechen), besonders wenn sich beide Spieler an bekannte Eröffnungen und Pläne halten und die Partie nicht allzu lang ist. Aber eine allgemeine Lösung auch nur für die Mehrzahl der Spiele kann es nicht geben. Schon eher wäre es eine Aufgabe, überhaupt einen Partieverlauf zu finden, dessen vollständige Beschreibung aus den weißen Zügen allein mit Notwendigkeit folgen würde.
Der junge Herr Siebold
[Niederschrift 1940/41; BA I/4, S. 303–358.]
- Er hatte einst mit seinem Freunde Leubelfing in dessen angrenzendem Garten – zum Türken – beim Schachzabelspiele gesessen, und war mit ihm in einen scharfen Streit über eine wichtige Variante der sogenannten ‹spanischen Eröffnung› geraten. Friedrich hatte endlich ein Blatt aus seiner Brieftasche genommen, und auf der Rückseite Zug für Zug niedergeschrieben und mit Beispielen am Brett verteidigt, bis Leubelfing, obzwar nicht völlig gewonnen, doch allmählich von der Spielbarkeit des Zuges überzeugt, nachgegeben hatte. [330]
-
Der Name des angrenzenden Gartens – zum Türken – ist wahrscheinlich keine Anspielung auf den Kempelenschen Schachautomaten,
 der wegen der Ausstaffierung der menschlichen Figur, die in ihrer
rechten Hand eine lange Pfeife hielt und mit der linken Hand die Züge
ausführte, allgemein den Namen „Der Türke“ trägt.
Interessanterweise spielen Wolfgang von Kempelen (1734–1804) und
seine Schachmaschine bei Schmidt außerhalb von Zettel’s
Traum (und auch dort nur eine marginale) keinerlei Rolle, obwohl der
„Türke“ von den 1770er Jahren bis zu seiner Zerstörung
1854 bei einem Brand in Philadelphia zu den prominentesten Automaten seiner
Zeit gehörte. Schon bald nach den ersten öffentlichen Auftritten
wurde natürlich zu Recht vermutet, daß sich im Inneren des
Automaten ein kleinwüchsiger Schachmeister befände, der die
Züge ausführe. Trotz dieser Enttarnung machte der
„Türke“ großen Eindruck auf seine Zeitgenossen und
hinterließ im Werk E.T.A. Hoffmanns und Jean Pauls seine deutlichen
Spuren.
der wegen der Ausstaffierung der menschlichen Figur, die in ihrer
rechten Hand eine lange Pfeife hielt und mit der linken Hand die Züge
ausführte, allgemein den Namen „Der Türke“ trägt.
Interessanterweise spielen Wolfgang von Kempelen (1734–1804) und
seine Schachmaschine bei Schmidt außerhalb von Zettel’s
Traum (und auch dort nur eine marginale) keinerlei Rolle, obwohl der
„Türke“ von den 1770er Jahren bis zu seiner Zerstörung
1854 bei einem Brand in Philadelphia zu den prominentesten Automaten seiner
Zeit gehörte. Schon bald nach den ersten öffentlichen Auftritten
wurde natürlich zu Recht vermutet, daß sich im Inneren des
Automaten ein kleinwüchsiger Schachmeister befände, der die
Züge ausführe. Trotz dieser Enttarnung machte der
„Türke“ großen Eindruck auf seine Zeitgenossen und
hinterließ im Werk E.T.A. Hoffmanns und Jean Pauls seine deutlichen
Spuren.
Nach von Kempelens Tod ging der Automat über eine Zwischenstation in den Besitz des Schaustellers Johann Nepomuk Maelzel über, der sich nach Vorführungen in London, Paris und Amsterdam mit dem „Türken“ schließlich 1826 nach den U.S.A. einschiffte. Dort wird der Automat lange Jahre in Philadelphia und anderen Städten der Ostküste bis hinunter nach Kuba gezeigt. Ebenso wie schon in Europa erregt er auch hier großes Aufsehen. Edgar Allan Poe schreibt in seiner umfangreichen Studie Maelzel’s Chess-Player: „Perhaps no exhibition of the kind has ever elicited so general attention as the Chess-Player of Maelzel.“
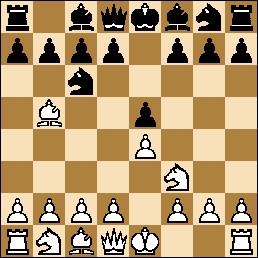
Trotz der Reflexe, die der „Türke“ bei so zahlreichen Schmidtschen Leib- und Magen-Autoren hinterlassen hat, und obwohl es sich um einen schachspielenden Automaten handelt, scheint sich Schmidt für dieses Phänomen nicht sonderlich interessiert zu haben. Eigentlich schade …
Links:
André Schulz: Der erste Schachcomputer war keiner
Vorstellung eines Replikats des „Türken“
Siegfried Schönle: Das Schachspiel in den Schriften Jean PaulsDas altertümelnde Wort Schachzabelspiel verwendet Schmidt nur in dieser einzigen Erzählung zweimal. Die Wortbildung ist nicht ganz glücklich, weil das mittelhochdeutsche ‚schachzabel‘ im engeren Sinne das Schachbrett bezeichnet, im weiteren Sinne aber auch das Spiel selbst, so daß es besser hieße, die Freunde hätten „beim Schachzabel“ gesessen.
Die spanische Eröffnung ist gekennzeichnet durch die Züge 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 (vgl. Diagramm). Sie gehört wie etwa auch die Italienische Eröffnung zu den alten Eröffnungssystemen, die bereits in frühen Lehrbüchern auftauchen. Ihren Namen verdankt sie ihrer prominenten Stellung im Libro del Axedrez (1561) des Spaniers Ruy Lopez de Segura. Sie gilt als eine der attraktivsten Eröffnungen für Weiß und erfreut sich, seit es Aufzeichnungen gibt, bei Schachspielern aller Spielstärken großer Beliebtheit.
Die Fremden.
[Niederschrift 1942; BA I/4, S. 497–575.]
- Der Blinde neigte langsam den Kopf, erwiderte aber nichts, bis der Andere, leicht verletzt durch das Schweigen, wie es schien, kurz vorschlug: »Schach?« »Ja, aber bitte nur Eine heut,« sagte Flick, »ich weiß nicht, ich bin an diesem Abend zerstreuter als sonst. – Der zweite Frühling, den ich nicht sehen werde. Das ist – – hart! – Die Linke –« unterbrach er sich wählend, »– Schwarz? – also ganz stilecht – Bitte!« Kauff, der unterdes die Figuren aufgestellt hatte, lehnte sich ein wenig zurück, hob mit gespitzten Fingern die schlanke Hand, hielt sie einen Augenblick über dem Brett und begann: »d2 – d4.« Der Blinde lachte ein wenig spöttisch: »immer tricksy and twisted, nur nicht den Königsbauern bewegen – aber wie Du willst.« Er stützte den Kopf in die Hand und entgegnete: »d 7 – d 5.« [510 f.]
-
Das Blindspiel muß zu der Zeit, in der Die Fremden spielt (aus der Stelle [I/4, 572, Zeile 39] geht hervor, daß es sich um das Jahr 1787 handelt), als höchst ungewöhnlich angesehen werden. Als Philidor (s.o.) 1734 zwei Blindpartien zugleich spielte, galt das in Paris als eine unerhörte Sensation. Auch ist gewöhnlich das Spiel eines Blinden kein Blindspiel im eigentlichen Sinne: Der Blinde spielt heute auf einem separaten Schachbrett, auf dem die Figuren ähnlich wie bei einem Reiseschachspiel mittels eines Zapfens am unteren Ende in dafür vorgesehene Löcher auf den Feldern plaziert werden. Die weißen Felder sind zur besseren Unterscheidung leicht erhöht; auch die Figuren tragen Markierungen, die ihre Farbe anzeigen. Blindenschachspiele werden aber überhaupt erst seit 1848 gefertigt [vgl. KARL. Das kulturelle Schachmagazin. Ausg. 2/2005. S. 35]. Arno Schmidts Blinder spielt also ohne solch ein Hilfsmittel.
Blindspielen einer einzelnen Partie dürfte eine Fähigkeit sein, über die heute nahezu alle Spieler von Meisterstärke und nicht wenige schwächere verfügen. Allein die Lektüre von Schachliteratur regt dazu an, die Züge nicht auf einem Brett auszuführen, sondern sich im Kopf von Diagramm zu Diagramm zu bewegen. Inzwischen gibt es mit den Melody Amber Turnieren in Monaco einen jährlichen Wettbewerb, bei dem hochklassige Spieler im Schnell- und Blindschach gegeneinander antreten.
Dieses Blindspiel ist bei Arno Schmidt in eine Passage eingearbeitet, die den Protagonisten des Textes als möglichst eindrucksvolle Geistesgröße präsentieren soll: Obwohl er seit zwei Jahren blind ist, spielt er weiterhin auf Meisterniveau Schach (s.u.), kennt seine Lieblingsbücher auswendig etc.
Warum die Eröffnung der Partie mit dem Damenbauern tricksy and twisted sein soll, bleibt unkar. Der Gegenzug 1... d5 ist jedenfalls die konventionellste Antwort der Damenbauerspiele.
- So begann der Kampf – einer von Vielen – und war lang und schwierig wie alle, denn beide spielten mit ungewöhnlicher Meisterschaft und kannten sich genau; doch konnte Kauff, dessen Angriff außerordentlich scharf erwidert wurde, heute nur mit großer Mühe das Spiel halten, und nach zwei Stunden, als sie die Partie abbrachen, hatte er bereits zwei Bauern verloren, und sah mit Schrecken einem neuen Vorstoß auf dem rechten Flügel, wohin sein König rochiert hatte, entgegen. Dennoch nahm er sich vor, die Stellung zu Haus auf’s Sorgfältigste durchzuarbeiten, um nicht eine weitere Partie in den Rückstand zu geraten; denn das Ergebnis dieses Jahres stand bereits wie 23½ zu 20½. [511]
-
Etwas merkwürdig erscheint es schon, daß sich der Blinde nach neun [510] Uhr nur Eine Partie ausbittet, diese dann aber lang und schwierig wie alle und nach zwei Stunden vertagt wird. Daß Partien sehr langwierig sein konnten, war für das 18. Jahrhundert allerdings nicht ungewöhnlich. Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann man, die Bedenkzeit der Spieler zu begrenzen, zuerst mit Sanduhren, später dann mit speziell enwickelten Schachuhren, die im Prinzip mit den heutigen identisch sind: Zwei getrennte Uhrwerke sind so miteinander verbunden, daß das Anhalten der einen Uhr die andere in Gang setzt. Solche Uhren werden aber bis heute zumeist nur bei Turnierpartien oder unter Vereinsspielern verwendet.
Die Betonung der ungewöhnlichen Meisterschaft beider Spieler gehört zu dem oben schon erwähnten Versuch, den Protagonisten als geistigen Übermenschen darzustellen. Dafür mußte wohl die Unwahrscheinlichkeit in Kauf genommen werden, gleich zwei unbekannte Meisterspieler auf dem engen Raum einer einzigen Erzählung zu vereinen.
- »So, Kauff!« sagte er verdrießlich, »na, für diese Heldentat wünsche ich Ihnen alles Schlechte – anstatt zuzuhören: denn Sie haben noch verwünscht viel zu lernen, mein Lieber! – Kant und Schachspielen allein genügen noch nicht – [529]
-
Die unmittelbare Verbindung von Kant und Schachspielen an dieser Stelle (und in der Figur Kauffs) ist insoweit bemerkenswert, als das Schachspielen – mit einer einzigen Ausnahme im Spätwerk – von den Figuren Arno Schmidts stets hoch geschätzt wird, während sich die Bewertung Kants mit den Jahren fundamental geändert hat: »Einer bei uns liest immer Kant!« berichtete sie ehrerbietig. »Dann muß er verrückt sein!« entschied ich: »Du glaubst es nicht?!: Paß auf: ....« (und ich machte sofort die alte Probe: welche Stelle steht im Kant, und was iss Mist?: a.) ‹Eine Einheit der Idee muß sogar als Bestimmungsgrund a priori eines Naturgesetzes der Kausalität einer (gewissen) Form des Zusammengesetzten dienen›; oder b.) ‹Die Kausalität einer (gewissen) Form des Zusammengesetzten muß einer Einheit der Idee sogar als Bestimmungsgrund a priori eines Naturgesetzes dienen›? Sie senkte die Stirn und antwortete nicht mehr). Seelandschaft mit Pocahontas [I/1, 413].
Brand’s Haide
[1951; BA I/1, S. 115–198.]
-
und irgendwie kamen wir aufs Schach.)
Also spielen wir: Er war der typische alte Remis-Fuchs, hatte leidliche Theoriekenntnis (ich kann ja nischt mehr!); wir trennten uns ½ : ½. Dennoch war er überrascht und proponierte zukünftige matches […]
Morphys Armen entrissen: - [138]
-
Das Schachspiel erscheint hier (wie auch an einer späteren Stelle: Hm, Hm. – Ein Schachbrett aus Feuersteinen, geschliffenen: das war allerdings schön! [I/1, 167]) als eines von vielen Wirklichkeitsdetails, die den Text motivisch anreichern, ohne enger mit dem Hauptstrang der Erzählung zusammenzuhängen. Fast könnten man vermuten, daß das Spiel des Erzählers mit dem Pfarrer nur erwähnt wird, um das Wortspiel von Morphys Armen anbringen zu können, das auf die bekannte Redensart vom Ruhen in ‚Morpheus Armen‘ rekurriert, auch wenn Morphys Spiel alles andere als einschläfernd war. Daß Morphy zu den schachlichen Vorbildern Schmidts gehört, kann nach seinem Auftauchen in den Dichtergesprächen im Elysium (s.o.) wohl angenommen werden. In Brand’s Haide ist Morphys Name nur einer unter vielen, die der Erzähler wie nebenbei nennt und die die intellektuelle Welt herbeizitieren, in der sich der Erzähler im Gegensatz zu seinen Mitmenschen bewegt. Nicht immer ist er bei diesem Name-dropping so freundlich wie hier, den motivischen Zusammenhang auffällig herauszustellen.
Eines der wichtigen übergreifenden Motive, das hier erstmals auftaucht, ist der Ausgang der Partie. Im Gegensatz zu den ‚Juvenilia‘ haben in den Nachkriegstexte die Erzähler offensichtliche Schwierigkeiten, ihre Gegner im Schach zu überwinden.
Biographische Skizze
[Niederschrift 1950; BA Suppl. I, S. 329 f.]
- Als kaufmännischer Volontär und Angestellter in einer Textilfabrik lebte er so, damals auch dem Schachspiel erregt zugetan, bis zum Ausbruch des Krieges: [329]
-
Die Formulierung erregt zugetan läßt erahnen, daß das Spiel für den jungen Arno Schmidt von großer Bedeutung gewesen sein muß.
Schwarze Spiegel
[1951; BA I/1, S. 199–260.]
- Wer hat die Kulturwerte geschaffen?! Nur Griechen, Romanen, Germanen; Inder in der Philosophie. – Die Slaven sind typisch kulturlos: mein Gott: Schach und n bissel Musik! [230]
-
Antislawisches Ressentiment ist eher selten bei Arno Schmidt, aber doch hier und da bei seinen Figuren anzutreffen. Der hier angeführte Ausfall kommt gänzlich unvorbereitet und scheint mehr die schlechte Laune des Erzählers angesichts anhaltend schlechten Wetters widerzuspiegeln als sonst irgendeine Funktion zu haben. Immerhin gilt es festzuhalten, daß Schach neben der Musik zu den Kulturwerten gerechnet wird.
Die Umsiedler
[1953; BA I/1, S. 261–297.]
- »Kannst Du Schachspielen?« – und ich erzählte ihr entrüstet, wie ich damals den schlesischen Provinzmeister umgelegt hatte, mit b2–b4: Jawoll! [284]
-
Diese Episode schreibt Arno Schmidt nicht nur seinem Erzähler, sondern auch sich selbst zu. In einem Brief an Hans Wollschläger vom 23. Oktober 1959 schreibt er mit Bezug auf den Schach-Großmeister und Karl-May-Verleger Lothar Schmid: (Dem Schachmeister Lothar Schmid dürfen Sie, bei Gelegenheit, einmal ins Ohr träufeln, daß auch ich früher viel Zeit mit dergleichen Possen verloren, und sogar einmal den breslauer Meister, Machate, schlug – ein Name, der Herrn Schmid geläufig sein wird – und zwar mit b2-b4, meiner Leib=Eröffnung. (Jetzt kann ich natürlich nichts mehr; aber immerhin wird er nachdenklich nicken, wenn er diesen seltenen Zug vernimmt.)) [Zitiert nach Guido Graf: Über den Briefwechsel zwischen Arno Schmidt und Hans Wollschläger. Wiesenbach: Bangert & Metzler, 1997. S. 138.] Über die wahre Spielstärke Arno Schmidts lassen sich natürlich nur Vermutungen anstellen. Die beiden im Tagebuch seiner Frau überlieferten Partien weisen allerdings nicht darauf hin, daß Schmidt in der Lage gewesen wäre, einen Meister wie Gottlieb Machate (1904–1974) zu schlagen. Vgl. dazu auch »Sie sind ›Schachspieler‹?«.
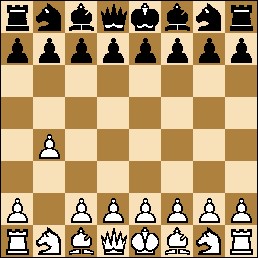
Die Eröffnung 1.b4 trägt unter Schachspielern den witzigen Namen ‚Orang-Utan‘. Der Legende nach soll der Schachmeister Savielly Tartakower (1887–1956), dem die Schachwelt einen schier unerschöpflichen Reichtum pointierter Bemerkungen verdankt, nach einem Zoobesuch, der 1924 im Rahmenprogramm eines Meisterturniers in New York stattfand, dem Eröffnungszug diesen Namen gegeben haben. Man findet ihn in der Literatur auch unter dem Namen ‚Sokolski-Eröffnung‘, da der ukrainische Meister Alexej Sokolski (1908–1969) die erste gründliche Untersuchung dieser Eröffnung veröffentlicht hat. Orang-Utan ist ein heute selten gespieltes System, das auf dem höchsten Niveau gar nicht mehr anzutreffen ist, allerdings unter Spielern auf Vereinsebene immer noch seine Anhänger hat und dann und wann für einen Überraschungssieg gut ist.
Zu der Zeit, als Schmidt das Schachspielen erlernt haben wird, gehörte Orang-Utan als hypermodernes Eröffnungssystem zu einem der Gravitationszentren, um die sich die Schachwelt bewegte. Die 11. Auflage des eher konservativen Lehrbuchs von Dufresne und Mieses von 1926 behandelt den Zug allerdings nur am Rande unter der Überschrift ‚Unregelmäßige Eröffnungen‘, wie übrigens auch die Englische Eröffnung 1.c4, die heute aus der Turnierpraxis nicht wegzudenken ist. Es wird zu 1.b4 auch keine Beispielpartie geliefert. Sollte Arno Schmidt also tatsächlich Orang-Utan in seinem Repertoire gehabt haben, so muß er seine Kenntnisse aus einer anderen Quelle bezogen haben.
Aus dem Lebens eines Fauns
[1953; BA I/1, S. 299–390.]
- »Na, Herr Singer, wie stehts Turnier?«; und er gab mir zurückhaltend und kammachern Auskunft. (War nämlich ein leidenschaftlicher Schachspieler, vieleckig und armselig, ‹Germania Walsrode›, und so entzückend fanatisch, daß er nicht rauchte, wenn er »trainierte«). [305]
-
Daß die Bezeichnung leidenschaftlicher Schachspieler nur bedingt etwas Positives meint, macht eine Stelle aus Brand’s Haide wahrscheinlich, an der es über eine der Figuren heißt: der hier tanzte; »leidenschaftlich«, wie ihm zu sagen beliebte: Du hast ne Ahnung von Leidenschaft! [I/1, 119]
Über die Zugehörigkeit dieses Schachspielers zum Verein ‹Germania Walsrode› schreibt Dieter Kuhn in seinem Handbuch zu Aus dem Lebens eines Fauns:
Den Mitgliedern des Ältestenrats der »›Germania‹ Walsrode von 1916 e. V.« ist nichts über eine Schachabteilung oder ein Schachturnier bekannt. In den Unterlagen des Vereins wird eine solche Abteilung nicht erwähnt. [Dieter Kuhn: Kommentierendes Handbuch zu Arno Schmidts Roman »Aus dem Leben eines Fauns«. München: edition text + kritik, 1986. S. 29.]
Ansonsten sind natürlich jedem Vereinspieler Schachfreunde der von Schmidt beschriebenen Art bestens bekannt. Sie kommen zumeist nicht über einen Einsatz in der Bezirksklasse hinaus, legen aber eine Ernsthaftigkeit und einen Fanatismus an den Tag, der sich nicht leicht bei Spielern höherer Klassen wiederfinden läßt. Heimlich hoffen die meisten Vereinsspieler beim Blick auf diese Schachfreunde, nicht auch zu ihnen zu gehören.
- Die neue Skala: Windstärke 6: wirft Schachfiguren um. (Den hatten wir gottlob; also gemütliches Beisammensein). [348]
-
Diese Bemerkung macht der Erzähler Heinrich Düring bei seinem Besuch beim Pfarrer von Kirchboitzen, dessen Garten einen Locus amoenus mitten in diesem vom Krieg umlagerten Text bildet. Auch dieser Pfarrer scheint, wie der in Brand’s Haide (s.o.), Schach zu spielen, was aber durch den zu starken Wind verhindert wird. Allerdings scheinen die Grade der neuen Skala nicht denen der Beaufort-Skala zu entsprechen, denn in ihr bezeichnet Windstärke 6 Windgeschwindigkeiten zwischen 10,8 und 13,8 m/s, was ausreicht, um starke Äste in Bewegung zu bringen und das Handhaben von Schirmen erheblich zu erschweren. Bei solchem Wind wäre ein gemütliches Beisammensein im Garten kaum möglich.
Seelandschaft mit Pocahontas
[1955; BA I/1, S. 391–437.]
- Schachspielen (mit Erich, ders im Kriege von mir gelernt hatte, dank seines hochentwickelten Geschäftssinns ein gefährlicher Gegner war) und sie verfolgte interessiert das gemächliche Gedränge der hölzernen Gestaltchen, wie sie dahinzogen, übereinander sprangen, sich entführten und verwandelten (und Erich erschöpft: »Äußerstmerkwürdich!«, als ich, trotz eines leichtsinnig geopferten Turmes weniger, eins der glanzvollsten Remis meiner Laufbahn machte: »Ein Alterfuchs!!«). [431]
-
Das Schachspielen mit Erich füllt leere Urlaubsstunden, während es draußen regnet. Angeregt ist es vielleicht durch das Durchblättern einer Illustrierten, in der sich auch Schachaufgaben [431] finden. Interessiert verfolgt wird die Partie wohl von der Urlaubsliebe des Erzählers Joachim, Selma, von Joachim liebevoll Pocahontas getauft. Auch hier endet die Partie, wie schon die in Brand’s Haide (s.o.) remis, und auch die dortige Formulierung vom alten Remis-Fuchs findet sich in ähnlicher Wendung wieder.
Erichs »Äußerstmerkwürdich!« greift eine frühere Stelle der Seelandschaft wieder auf:
Die breite Reichsstraße 51 wurde allerdings eben schwer ausgebessert, und rotweiße Hürden sperrten zehnmal Dreiviertel der Fahrbahn; brüllen: »Äu-ßerst-merkwürdich!!« (dazu hatte ihn nach eigenem Geständnis seine Frau erzogen: dies statt des ihm früher allzu geläufigen ‹Verfluchte Scheiße› zu sagen; aber Eingeweihte wußten, was er meinte!). [397]
Kosmas oder Vom Berge des Nordens
[1955; BA I/1, S. 439–502.]
- am schludrig geschnürten Schuh lehnte ein rundes Schachbrett mit dreieckigen Feldern, [467]
-
Diese Stelle aus der Beschreibung einer Statue ist einer der Anachronismen, die sich in Kosmas finden. Der Text spielt im Jahre 541 am Schwarzen Meer im heutigen Bulgarien. Da das Schachspiel aber erst um die Mitte des 6. Jahrhunderts in Indien erfunden wurde, konnte der Erzähler Lykophron das beschriebene Spielbrett nicht als Schachbrett bezeichnen.
Die Pflicht des Lesers
[Niederschrift 1955; BA III/3, S. 190 f.]
- Wer kennt wirklich auch nur die Hauptexponenten von »Sturm und Drang«?: Die Riesen=Romandekalogie Klingers; Heinses Kugelblitze aus Schach und Erotik; Moritzens »Anton Reiser«, diesen psychologischen Großmeister, dem kein Ausland Ähnliches gegenüberzustellen vermag?! [191]
-
Johann Jakob Wilhelm Heinse (1746–1803) ist bekannt als der Verfasser des Romans Ardinghello und die glückseligen Inseln, in dem Schach nur eine nebensächliche Rolle spielt. Allerdings war der ‚Verfasser des Ardinghello‘ auch Autor des zweibändigen Briefromans Anastasia und das Schachspiel, der 1803 erschien. In seinen Kernpassagen enthält dieses Buch eine Übersetzung des bedeutenden Schach-Lehrbuchs Osservazioni teorico-pratiche sopra il giuoco degli scacchi ossia il giuoco degli scacchi eposta nel suo miglior lume von Giambatista Lolli, das 1763 in Bologna erscheinen ist.
Links zu Wilhelm Heinse:
Johann Jacob Wilhelm Heinse
Heinse-Jahr 2003
Das steinerne Herz. Historischer Roman aus dem Jahre 1954
nach Christi
[1956; BA I/2, S. 7–163]
-
Ein Nachbar von links: Eisendecher junior. (Hatte
gegrüßt, mit dem, allen Westbesuchern gegenüber scheinbar
vorgeschriebenen Pli; und enterte dann – worauf ich, aus Rücksicht
auf Line, einging. Erst mal lud er mich zu einer Schachpartie, damit ich die
Überlegenheit des Ostens erführe; denn er war Jugendmeister in einem
FDJ=Bezirk.)
Schach: »Ach, ich hab 20 Jahre keine Figur mehr in Händen gehabt!« log ich die boshaftvorgeschriebene, für den Gegner in jedem Fall besonders fatale, Entschuldigung: wenn er gewann, wars nischt wert; verlor er, konnte er sich selbst nicht mehr achten! (Stimmte diesmal aber ausnahmsweise fast: 1935 hatte ich noch die ‹Slawische Ablehnung› von der ‹Meraner Variante› unterscheiden können.) Ich erloste mir sogar Weiß; zuckte scheinheilig bedrückt sämtliche Achseln, probierte erst in der Luft über zwei anderen Knöpfen – und zog dann fade murmelnd
b 2 – b 4: (mit anschließendem b 4 – b 5: meine Spezialeröffnung!): Der Kerl spielte wie Botwinnik & Smyslow zusammen; war aber in der Schnelligkeit nicht auf die korrekte Erwiderung geaicht; baute sich triumphierend ein Zentrum wie die Wartburg (immer unterstützt von meinem scheuen mißvergnügten Gesilbel: ein undisziplinierter Alter bin ich, gelt?!). Umging ich ihn also, wie vorgesehen, hinterwärts, und nagelte ihn auf seinen Mieses=Dufresne. (Dennoch langte es im abschließenden Endspiel nur zu einem so faulen Remis! – War auch viel zu nervös: einmal wegen Ringklib. Dann Lines Berichte!). [94 f.] -
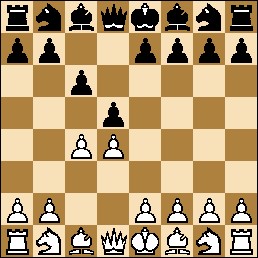
Die ‹Slawische Ablehnung› ist bekannter unter der Bezeichnung Slawische Verteidigung. Sie stellt eine der Hauptantworten des Schwarzen gegen das Damengambit dar: 1.d4 d5 2.c4 c6 (Diagramm rechts). Bei der Meraner Variante handelt es sich um eine Variante der sogenannten Halbslawischen Verteidigung: 1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3 e6 5.e3 Sbd7 6.Ld3 dxc4 7.Lxc4 b5 (Diagramm unten). Diese Zugfolge wurde nach einer zwischen Grünfeld und Rubinstein 1924 in Meran gespielten Partie benannt, obwohl sie auch schon zuvor erfolgreich von Schwarz angewandt worden war.
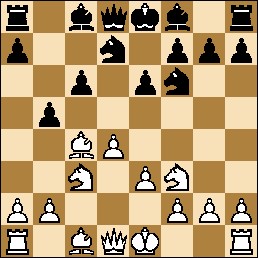
Auch Walter Eggers, der Erzähler von Das steinerne Herz, spielt Orang-Utan (s.o.). Es sind solche und zahlreiche ähnliche Details, die nicht nur die Redeweise vom ‚bekannten Erzähler‘ (Josef Huerkamp) provoziert, sondern auch bei vielen Lesern Arno Schmidts die Idee von der Identität von Erzählern und Autor erzeugt haben.
Bei Michail Botwinnik (1911–1995) handelt es sich um den beherrschenden Schachspieler der Nachkriegsepoche bis zu seinem endgültigen Verlust des Weltmeistertitels im Jahr 1963. Nachdem Alexander Aljechin 1946 als ungeschlagener Weltmeister gestorben war, organisierte der 1924 gegründete Weltschachbund FIDE 1948 ein Turnier um den Titel des Weltmeisters, mit dem der ‚Privatbesitz‘ des Weltmeistertitels vorerst beendet war. In Den Haag und Moskau spielten damals Michail Botwinnik, Wasilij Smyslow (1921–), Paul Keres, Samuel Reshevsky und Max Euwe jeweils fünf Partien gegen jeden anderen. Botwinnik ging mit 14/20 Punkten eindeutig als Sieger hervor, gefolgt von Smyslow mit 11/20. Die FIDE legte fest, daß der amtierende Weltmeister seinen Titel alle drei Jahre zu verteidigen habe. Der Herausforderer hatte sich dazu in einer Reihe von Turnieren zu qualifizieren. 1951 hieß dieser Herausforderer David Bronstein, dessen Sieg Botwinnik mit einem Ergebnis von 12:12 gerade noch verhindern konnte; bei Gleichstand am Ende der auf 24 Partien festgesetzten Wettkämpfe um die Schachweltmeisterschaft behielt der Weltmeister seinen Titel. Im nächsten Zyklus qualifizierte sich Smyslow, aber auch er kam bei diesem Versuch über ein 12:12 gegen Botwinnik nicht hinaus. Dieser WM-Kampf fand vom 16. März bis zum 13. Mai 1954 in Moskau statt, war also das schachliche Großereignis von internationalem Interesse, das der Niederschrift des Romans zwischen November 1954 und April 1955 unmittelbar vorausgegangen war. Da Schmidt eine Veröffentlichung des Romans noch im Jahr 1955 anstrebte, konnte er hoffen, daß vielen Lesern die Namen Botwinnik und Smyslow noch im Gedächtnis sein würden. Smyslow gelang es übrigens 1957, den Titel zu erringen, er verlor ihn allerdings im Jahr darauf in einem Revanchewettkampf wieder an Botwinnik.
Als Zentrum bezeichnen die Schachspieler die vier Felder in der Brettmitte (d4, e4, d5 und e5). Ihre Besetzung oder Beherrschung ist eines der wichtigen Ziele der Eröffnungsphase einer Partie. In diesem ‚oder‘ steckt der Streit zweier Schulen, um den richtigen Weg der Partieanlage, der die Schachwelt am Anfang des 20. Jahrhunderts entzweite. Während traditionelle Eröffnungssysteme das Ziel verfolgen, das Zentrum direkt mit Bauern zu besetzen, vertrat die ‚Hypermoderne Schule‘ (auch das ein Ausdruck Tartakowers) die Auffassung, es gelte vielmehr das Zentrum zu beherrschen als es zu besetzen. Sie entwickelten daher Eröffnungssysteme, in denen die Läufer fianchettiert (d.h. auf die Felder b2 und g2 bzw. b7 und g7 entwickelt) und die Mittelbauern lange Zeit zurückgehalten wurden. Auch die von Schmidt und seinen Erzählern bevorzugte Eröffnung 1.b4 ist ein Produkt der Hypermoderne Schule. Walter Eggers beschreibt das Vorgehen seines Gegners, der sich triumphierend ein Zentrum wie die Wartburg baut, ganz richtig mit der Phrase nagelte ihn auf seinen Mieses=Dufresne. Das nun schon öfter erwähnte Lehrbuch des Schachspiels vertrat hauptsächlich die Sache der Traditionalisten in der Nachfolge Tarraschs und behandelte die Eröffnungen der Hypermodernen wenn überhaupt nur am Rande. Heute ist der alte Streit einem gewissen Pragmatismus gewichen: Zwar werden auf höchstem Niveau hauptsächlich klassische Eröffnungssysteme behandelt, doch wurden diese Systeme durch die Ideen der Hypermodernen wesentlich beeinflußt und erweitert.
Auch die Partie dieses Romans endet, wie bis dahin alle Nachkriegspartie von Schmidtschen Erzählern, remis; diesmal allerdings ist es ein faules Remis. Es mag durchaus berechtigt sein, diesen Ausgang mit dem ‚Vergleich der Systeme‘ von BRD und DDR in Beziehung zu setzen, der eines der zentralen Themen von Das steinerne Herz darstellt, wie es auch die nächsten beiden Absätze nahelegen:
-
Immerhin: er war leicht geknickt; und berichtete,
abgesägten Blicks, zum Ausgleich hastig (und etwas zu offenherzig) von
dem hiesigen Schachbetrieb: – (und ich lauschte, immer bedenklicher sich
teilenden Mundes: das Entsetzliche wurde mir klar!)
: Die benützten hier im Osten das Schachspiel zur Abstumpfung der Geister!! Systematisch wurden die, trotz aller Aufbauschichten und Leistungswettbewerbe, noch vorhandenen Energien in dieses sterilste aller künstlichen Sackgäßchen abgelenkt!! Zum selben Zweck, wie in den Jesuitenschulen Sprachen und niedere Mathematik übermäßig gepflegt wurden: dadurch verhindert man Gedanken (und züchtet noch zusätzlich den grundlosesten starren Hochmut auf die herrliche eigene ‹Bildung›! Mensch, deswegen stellen natürlich auch die Russen sämtliche Weltmeister! Ich kriegte einen richtigen Widerwillen gegen das Spiel: also einen Spiegel an der Wand, und n Schachbrett uffm Tisch: dann ist die Kultur erreicht, was?! – Er merkte nichts; und begann schon mit il Selbstbewußtsein und la Weltanschauung.) -
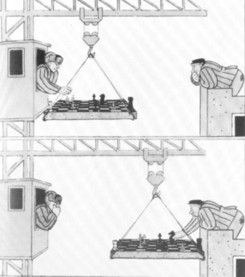
Was Schmidt hier seinen Erzähler vorbringen läßt, entspricht nur wenig der Realität der Schachspieler in der DDR und könnte noch eher als eine Kritik der Sowjetischen Schachschule durchgehen. Zwar war Schach in der DDR relativ bald als Sport angesehen, und es gab einige wenige Schachspieler, die als Staatssportler ihren Lebensunterhalt verdienten, aber es hat in der DDR niemals eine den Strukturen in der UdSSR vergleichbare staatliche Auslese und Förderung von Schachtalenten gegeben. Wie wenig Schach der politischen Führung galt, wurde nach 1972 deutlich, als die finanziellen Mittel zur Sportförderung auf medaillenträchtige olympische Kern-Sportarten konzetriert wurden, was für das DDR-Schach einem nahezu gänzlichen Rückzug aus der internationalen Arena gleichkam. Vgl.: Rainer Knaak: Schach in der DDR.
Im Gegensatz dazu hatte die UdSSR seit Mitte der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts mit dem systematischen Aufbau der Sowjetischen Schachschule begonnen, die in den Nachkriegsjahren zu einer Hegemonie sowjetischer Schachspieler im Weltschach führte, die bis heute nachwirkt. Mit Ausnahme der drei Jahre zwischen 1972 und 1975, in denen das us-amerikanische Ausnahmetalent Bobby Fischer den Titel innehatte, entstammten bis zum Jahr 2000 alle Nachkriegs-Weltmeister mehr oder weniger direkt der Sowjetischen Schachschule. Aber auch für die UdSSR ist kaum anzunehmen, daß das Schachspiel zur Abstumpfung der Geister eingesetzt werden sollte. Vielmehr war und ist das Schachspiel in Rußland und zahlreichen anderen Nachfolgestaaten der UdSSR ein Teil der Volkskultur, und die Erfolge der Schachmeister bilden in der Tat ein wichtiges Element des nationalen Selbstbewußtseins, ohne daß sich dieser Zustand nach dem Wegfall der Weltanschauung groß geändert hätte.
Das heulende Haus
[Niederschrift 1955; BA I/4, S. 20–22]
- Und in der lichtdicht verhangenen Bodenkammer saßen auf niedlichen Hockern zwei Männer: ein Landmesser, von der Konkurrenz Fallingbostel; und ein Herr in Lincolngrün, ein Forsteleve, wie wir uns vorstellten. Sie hatten zwischen sich ein Schachbrett und eine Flasche billigen Weines; den Wänden entlang waren schon zwei Deckenlager ausgerollt. Man vereidigte auch mich kurz, unser Gespensterhaus niemals zu verraten; und ich besiegte dann erst einmal die beiden Schachspieler, einen nach dem anderen. Später auch simultan.« [21]
-
Der Binnen-Erzähler der ‚Stürenburg-Geschichten‘, der Vermessungsrat a. D. Stürenburg, ist mit einer gewissen ‚allgemeinen Überlegenheit‘ ausgestattet. Es paßt zu ihm, daß er die schachlichen Schwierigkeiten anderer Figuren Schmidts nicht teilt und seine Schachgegner nicht nur einzeln, sondern auch simultan besiegt. Zum Begriff ‚simultan‘ vgl. unten die Anmerkung zu Zettel’s Traum.
Siebzehn sind zuviel! (James Fenimore Cooper)
[Niederschrift 1955; BA II/1, S. 105–127]
-
FRAU SUSAN AUGUSTA (sagt eifrig und hell:) Schach und –
(kleine Pause; dann triumphierend:) – Matt!!
COOPER (nachdenklich zwischen den Zähnen murmelnd:) Tatsächlich. – Hätte ich vorhin doch den Turm einschlagen sollen – (unzufrieden:) ts: also so was! – – Schade! [110]
[…]
- COOPER (mißtrauisch:) Wirklich, Du? – Na, laß gut sein, Susy. Ich bin ja schon wieder (er spricht das folgende Wort hohnvoll aus:) ‹zuversichtlich›! – Ach! – Laß uns lieber eine Partie Schach spielen. Du mußt allerdings für mich ziehen; ich kann die Hände noch nicht wieder recht bewegen. [126]
-
Das eheliche Schachspiel der Coopers ist für Arno Schmidt nicht nur an dieser Stelle ein bemerkenswertes biographisches Detail. Es ist derzeit nicht auszuschließen, daß die Lektüre von Coopers Tagebüchern das Ehepaar Schmidt dazu angeregt hat, eigene Partien in Alice Schmidts Tagebuch festzuhalten.
Berechnungen II
[Niederschrift 1955; BA III/3, S. 275–284]
- Diese reinen Typen des E II (bzw. E I) sind einer Schachpartie zu vergleichen, von der nur die schwarzen Züge (oder weißen, wie man will) notiert wurden. [278]
-
Bei den Typen des EII (bzw. EI) handelt es sich um ein erzähltheoretisches Konstrukt Arno Schmidts, das genuin nichts mit dem Schachspiel zu tun hat. Zur Erläuterung benutzt Schmidt das Motiv von der ‚halbierten‘ Schachpartie, das schon in den Dichtergesprächen vorgekommen war, die aber, als er dies 1955 schrieb, nicht veröffentlicht waren. Schmidt wird dies Motiv noch häufig verwenden. Für einen eingehenderen Kommentar vgl. oben die Anmerkung zu den Dichtergesprächen.
Dichter und ihre Gesellen.
[Niederschrift 1956; BA III/3, S. 285–291]
- Der Techniker seinerseits, der die Realität emaniert, steht vor der Gefahr, der z.B. ähnlich der hochintelligente Schachspieler unterliegt: der 5 Stunden lang, ohne 1 Wort zu benötigen, geisterhaft hochgezüchtete Spiel= (für ihn Lebens=!)regeln vollzieht! [286]
-
Der für diesen Text zentrale Gegensatz zwischen Dichter und Techniker soll hier nicht weiter betrachtet werden. Auch die schmidtsche These zu prüfen, schachliches Denken vollziehe sich ohne 1 Wort, wäre ein eher psychologisches Unterfangen und soll daher unterbleiben. Von genuin schachlichem Interesse sind eventuell zwei der in diesem einzigen Satz vesammelten zahlreichen Behauptungen: 1. Die Spielregeln seien geisterhaft hochgezüchtet und 2. seien sie dem Schachspieler Lebensregeln.
Gemeint sein könnte damit, daß das Schachspiel aufgrund seiner Grenzenlosigkeit, gemessen zumindest am Horizont menschlichen Denkens, als eine Welt für sich empfunden werden kann, in der die Figuren schicksalhaft miteinander in einem gemeinsamen Geschehen verknüpft erscheinen, das aus dem Wirken antagonistischer Kräfte hervorgeht. So betrachtet gerät das Schachspiel zu einer Allegorie des Lebens und die Regeln des Spiels könnten als Lebensregeln verstanden werden. In diesem Sinne könnte dann der eigentlich recht schlichte Regelsatz des Schachspiels als geisterhaft hochgezüchtet bezeichnet werden, da er die Existenz eines ganzen Universums begründet.
Der eine oder andere belesenere Schachfreund könnte sich bei der Parallelisierung von Schach- und Lebensregeln auch an die von der Universitätsphilosophie weitgehend ignorierten philosophischen Versuche Emanuel Laskers erinnert fühlen. Es gibt aber keinerlei Anhaltspunkte dafür, daß Schmidt Emanuel Laskers Bücher jemals zur Kenntnis genommen hätte. Es kann darüber hinaus festgestellt werden, daß bei Arno Schmidt kaum einer der großen Spieler der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auch nur genannt wird: Von den drei Weltmeistern Lasker, Capablanca und Aljechin wird einzig der letztere an einer einzigen Stelle in Zettel’s Traum zusammen mit dem deutschen Großmeister Bogoljubow erwähnt. Beschäftigt haben muß sich Schmidt wohl mit dem schachlichen Schaffen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, falls denn tatsächlich Orang-Utan seine Leib=Eröffnung (s.o.) gewesen sein sollte. Aber Spuren im Werk hat diese Beschäftigung kaum hinterlassen.
Goethe und einer seiner Bewunderer
[1957; BA I/2, S. 189–220]
- Mit Heinse könnte man ne solide Partie Schach spielen. [193]
-
(s.o.)
- »Goethe nich; nee.« (und zur Erklärung noch den höflichen Zusatz): »Ich fühle mich nicht reif dazu. – Ähnlich wie für d2 – d4 im Schach.« [202]
-
Der Erzähler erklärt an dieser Stelle dem für einige Stunden von den Toten zurückgekehrten Goethe, was ein Nachtprogramm ist (gemeint sind damit die von Schmidt verfaßten Rundfunk-Essays zur Literatur) und daß er keines über Goethe in Planung habe aus eben dem oben zitierten Grund. Mit d2 – d4 ist die Gruppe der geschlossenen oder Damenbauer-Eröffnungen im Schach bezeichnet, die normalerweise mit dem Zug 1.d4 beginnen. Im Gegensatz zu den offenen oder halboffenen Eröffnungen, die mit dem Zug 1.e4 anfangen, führen die geschlossenen Eröffnungen in vielen Fällen zu einem eher positionellen Spiel. Diese Einteilung darf man nicht zu streng nehmen, weil in beiden Eröffnungsgruppen in ungleicher Verteilung sowohl positionell als auch taktisch geprägte Stellungen erreicht werden können. Allerdings beginnt der Lernende in der Regel mit den offenen Eröffnungen, da deren Pläne für ihn zumeist leichter zu durchschauen und anzuwenden sind. Erst mit einer gewissen schachlichen Reife sollte er sich den Damenbauereröffnungen zuwenden.
- (Wie schade, daß ich kein verstecktes Tonbandgerät besaß! – Aber nachher hätte man wohl auch wieder nur meine Stimme gehört; wie ne Schachpartie, wo die weißen Züge fehlen). [205]
-
Vgl. oben die Anmerkungen zu den Dichtergesprächen und den Berechnungen II.
Literatur: Tradition oder Experiment?
[Niederschrift 1957; BA III/3, S. 338–341]
- der Goethe’sche ‹Werther›, so bewundernswert er immer sein mag, führt die Briefform, die immer wiederauftauchende Anrede an den ‹geliebten Freund›, völlig unnützlich! Man hört nämlich diesen fernen Partner überhaupt nicht; er bleibt der Schatten eines Traums: dergleichen aber ist wider den Geist eines ‹Briefromans›! Ist eine Schachpartie, von der wir nur die weißen Züge kennen – oder die schwarzen, wie man will.
-
Vgl. oben die Anmerkungen zu den Dichtergesprächen und den Berechnungen II.
Die Meisterdiebe. Von Sinn und Wert des
Plagiats
[Niederschrift 1957; BA II/1, S. 333–357]
- Leider erlaubt unsere Zeit nicht, die 250 Zeilen des Hauff’schen Märchens ganz vorzutragen; genug, zu berichten, daß Jude Abner, schachspielerhaft=scharfsinniger Kombinationsgabe voll, mit beweglichen Falkenaugen, denen nichts entgeht, Spuren zu lesen vermag, wie nur je ein Sherlock Holmes oder die Helden Karl Mays, die aus ein paar nichtswürdigen Eindrücken im Sand die ganze Geschichte eines komplizierten Verbrechens rekonstruieren, begabt mit der Assoziationsgabe eines Elektronengehirnes. [354]
-
Eigentlich keine schachlich gehaltvolle Stelle. Ich führe sie dennoch an, weil ihre Formulierungen so nett von der Zeit überholt wurden: Angesichts der Karriere, die die Computer auch im Schach gemacht haben, würde wohl heute kaum mehr jemand ein Elektronengehirn mit einer Assoziationsgabe ausstatten, während der Mensch im Besitz einer schachspielerhaft=scharfsinniger Kombinationsgabe verbliebe. Eher schon würde man mit einer umgekehrten Zuordnung versuchen, wenigstens noch eine kleine Überlegenheit der menschlichen Intelligenz festzuhalten.
- A. (schlau): Vielleicht gelingt es uns im Schachspiel besser; noch ist es nicht allzutief in der Nacht: opfern Sie noch eine Schaufel ‹Nuß 1›; und, falls ich Weiß wählen sollte, verspreche ich Ihnen ganz originell=böse zu beginnen: b2 – b4! [357]
-
Dies greift eine Stelle vom Anfang des Dialogs auf [vgl. II/1, 335] und schließt so einen thematischen Rahmen. Zur Eröffnung 1.b4 vgl. oben die Anmerkung zu Die Umsiedler.
Die Gelehrtenrepublik. Kurzroman aus den
Roßbreiten
[1957; BA I/2, S. 221–349]
- Oberstes Stockwerk; gleich gebot ein Schild Stille!: »Schach!« (Das Kandidatenturnier für die Weltmeisterschaft. Wir schlichen lautlos ein. Sie schrieb diesmal nur vor Ehrerbietung die Namen auf den Block, und zeigte dann mit der Bleistiftspitze auf den Betreffenden: !). / Und da saßen sie Alle: Galachow und Karejew; Fortunatoff und Weljaninoff=Sernoff; Spasowitsch und Slawatinski; eine Perlenschnur erlauchtester Namen! […] / Und hier der Stand: die ersten 34 Plätze belegten die Sowjetrussen. Dann 2 ehemalige Jugoslawen […] Dann folgten 1 Tscheche und 4 Argentinier. / Der einzige Amerikanski lag an 42. Stelle (und verlor eben wieder; er hatte schon 3 Bauern weniger. Ich schüttelte ihm stumm und mitleidig die Landsmannshand.) [327]
-
Die Gelehrtenrepulik ist nach Schwarze Spiegel der zweite utopische Roman Arno Schmidts. Er spielt im Jahr 2008 nach einem verheerenden atomaren Krieg, der ganz West- und Teile Südeuropas komplett entvölkert hat. Die verbleibenden Nationen haben sich auf ein Refugium für Ihre begabtesten Künstler und Wissenschaftler geeinigt, das sich auf einem riesigem Schiff, einer stählernen Insel befindet. Erzählt wird Die Gelehrtenrepublik von einem entfernten Verwandten Arno Schmidts, Charles Henry Winer, der als Reporter das seltene Recht bekommt, die IRAS (= International Republic for Artists and Scientists) [270] zu besuchen und über sie zu berichten. Auch hier ist wieder auffällig, daß Schachspieler ohne große weitere Begründung auf der Insel zu finden sind; ganz offenbar zählt man sie zu den schützenswerten Künstlern.
Wie viele Motive und Konstellationen in Die Gelehrtenrepublik ist auch das hier vorgeführte Kandidatenturnier zur Schachweltmeisterschaft eine karrikierende Überzeichnung der Wirklichkeit zur Zeit der Niederschrift des Romans. Aufgrund der oben in den Anmerkungen zu Das steinerne Herz schon erwähnten systematischen Auslese und Förderung von Schachtalenten, hatte die Sowjetunion nach dem zweiten Weltkrieg eine beherrschende Stellung im internationalen Schachbetrieb errungen. Die strenge Führung der sowjetischen Schachspieler durch sportliche und politische Funktionäre ermöglichte in einzelnen Fällen mannschaftsdienliche sportliche Ergebnisse. Daß es solche Absprachen gegeben hat, ist heute unbestritten; uneinig ist man sich immer noch, wie weit versucht wurde, auf einzelne Spieler Druck auszuüben und in welchen Fällen welche Ergebnisse manipuliert wurden. Dies muß eine schwierige Zeit für die sowjetischen Spieler gewesen sein. Außerdem trug ein weitgespanntes Netz schachlicher Theoretiker, die den Spitzenspielern zuarbeiteten, zu deren Überlegenheit bei. Westliche Spieler dagegen waren oft Einzelkämpfer, die sich ständig selbst um Sponsoren, Trainingsmöglichkeiten und Einladungen zu Turnieren kümmern mußten. Unter solchen Bedingungen stellte sich eine Überlegenheit der ja schachlich nicht minder begabten sowjetischen Spieler wie von selbst ein.
Als nahezu prophetisch erweist sich der 42. Platz des einzigen us-amerikanischen Teilnehmers am Kandidatenturnier: Im Jahr nach dem Erscheinen von Die Gelehrtenrepublik, 1958, begann der 15 Jahre alte US-Amerikaner Robert James Fischer seine internationale Schach-Karriere, in dem er beim Interzonenturnier in Portoroz den 5. Platz belegte, was ihm nicht nur als bis dahin jüngstem Spieler den Großmeister-Titel einbrachte, sondern ihn auch für das Kandidatenturnier zur Weltmeisterschaft qualifizierte. Es war das erste von zwei Kandidatenturnieren, in denen Bobby Fischer die überlegene Turniertaktik der sowjetischen Schachdelegation erfahren mußte, deren Teilnehmer gegeneinander kräfteschonende Kurzremisen spielten, um ihre nichtsowjetischen Gegner um so mehr unter Druck setzen zu können. Nach dem Kandidatenturnier 1962 in Curaçao erschien in der großen Sportzeitschrift Sports Illustrated ein Artikel, in dem Fischer die drei Erstplazierten des Turniers des Betrugs bezichtigte. Er selbst zog aus seinem Abschneiden als Vierter die Konsequenz, nicht mehr an einem Kandidatenturnier teilzunehmen, solange der Modus dieser Turniere nicht geändert würde. Dies geschah bereits im nächsten Weltmeisterschafts-Zyklus: Ab 1965 spielten die WM-Kandidaten paarweise K.O.-Wettkämpfe gegeneinander. Allerdings nahm Fischer erst 1971 wieder an den Kandidatenwettkämpfen teil, um dann aber gleich zwei Großmeister nacheinander, Mark Taimanow und Bent Larsen, mit einem Ergebnis von 6:0 deutlich zu distanzieren. In der Folge gewann Fischer 1972 in Reykjavik im Wettkampf gegen Boris Spassky den Weltmeistertitel, was zugleich das Ende seiner Karriere bedeutete. Fischer zog sich von der internationalen Schachszene konsequent zurück und lebte bis zu seinem Tod am 17. Januar 2008 an verschiedenen Orten der Welt seiner Paranoia und seinem Antisemitismus.
Fouqué und einige seiner Zeitgenossen
[1959; BA III/1]
- Landgraf Friedrich selbst war eine durchaus sympathische Gestalt mit gelehrten Ambitionen; er korrespondierte mit deutschen Dichtern, und war auch ein guter Schachspieler, der in Paris mit Philidor manche Partie erledigt hat. [345]
-
Zu Philidor vgl. oben die Anmerkung zu Dichtergespräche im Elysium.
Der Waldbrand. Vom Grinsen des Weisen
[Niederschrift 1959; BA II/2, S. 333–365]
- Einen, den er nie sah; der aber dennoch – ‹im Geist› ist dergleichen eben aufs Schönste möglich – sein genuiner Ahnherr ist: Wilhelm Heinse! in dessen ARDINGHELLO, HILDEGARD VON HOHENTHAL, ANASTASJA ODER DAS SCHACHSPIEL, glüht der gleiche, weltzugewandte Geist. [361]
-
Zu Wilhelm Heinse und seinem Buch Anastasia und das Schachspiel vgl. oben die Anmerkung zu Die Pflicht des Lesers.
Kaff auch Mare Crisium
[1960; BA I/3, S. 7–277]
- »Na und?! – Bring’s raus, Dschonn. Sonst laß ich Dich heut Abnd im Schach ma nich gewinn’.« [31]
-
Wie aus dieser Stelle hervorgeht, gehört auch das Schachspiel zu den Freizeitbeschäftigungen der Bewohner der us-amerikanischen Mondkolonie, die im Jahre 1980, durch einen vernichtenden atomaren Krieg von der Rückkehr zur Erde abgeschnitten, ihrem langsamen Ende entgegensieht. Merkwürdigerweise werden Schachturniere gegen die sehr viel vitalere russische Mondkolonie, zu der man sonst auf allen Gebieten in Konkurrenz steht, an keiner Stelle erwähnt.
- Sam Reshevsky, der Dollmetscher [70]
-
Samuel Reshevsky (1911–1992) war ein polnischstämmiger us-amerikanischer Großmeister. Reshewsky war ein Schach-Wunderkind, das bereits im Alter von sechs Jahren Simultanvorstellungen gab. Als Elfjähriger hatte er Meisterstärke erreicht, was er mit einem Sieg gegen David Janowski, damals einer der besten Angriffsspieler der Welt, unter Beweis stellte. Anfang der 50er Jahre galt er als ernsthafter Kandidat für einen Kampf gegen Botwinnik um die Weltmeisterschaft; dies wußte der sowjetische Kader 1953 geschickt zu verhindern. Da sich seine Hoffnungen auf den Platz an der Weltspitze nie realisierten, bekam Reshevsky den mißgünstigen Spitznamen »das ewige Wunderkind« angehängt.
Die Namensübereinstimmung mit dem Dolmetscher auf dem Mond könnte rein zufälliger Natur sein, denn nichts weist darauf hin, Schmidt habe den Schachspieler Reshevsky hier als Dolmetscher auftreten lassen wollen. Es ist allerdings im Umfeld der Namensnennung viel von Spielen die Rede, auch tauchen wenige Zeilen später die Begriffe Läufer (für Bote) und Brett im Text auf, aber dies sind auch schon die einzigen Hinweise darauf, daß Schmidt bei der Niederschrift an den Schachspieler gedacht haben könnte.
Passen würde der Schachspieler Sam Reshevsky schon in das allgemeine Bild, das sich von Schmidts Schachinteresse ergibt, denn er ist zu der Zeit, als Schmidt sich intensiv mit dem Spiel auseinandersetzte, als Wunderkind bekannt gewesen und könnte allein deshalb Schmidts Aufmerksamkeit erregt haben, weil sich dadurch Parallelen zur Biographie Paul Morphys ergeben.
- »Iss Dir bekannt, Hertha: daß alte Leute hierzulande die Bauern im Schach noch heute ‹Wenden› nennen? [90 f.]
-
Der Ausdruck Wenden bezeichnet in Deutschland lebende Slawen. Einen Beleg für die Verwendungen des Wortes in Norddeutschland für die Schachfigur des Bauern konnte ich nicht finden; für Hinweise bin ich dankbar.
- Scheiß ‹Citoyen du Globe›: auf’m Lant müßte man leebm! / Schachfiegurn aus Eiche drexeln: gans schtille werdn. [207]
-
Dies kann als ein Schritt zum Rückzug vom zwischenmenschlichen Umgang gelesen werden, ohne sich doch ganz vom Schachspiel zu trennen, zu dem ja zumindest noch ein Gegner benötigt wird. Schmidts Protagonisten geraten ab dem Anfang der 60er Jahre in eine immer weiter zunehmende Isolation, die schließlich in einer weitgehend weltabgewandten Haltung gipfeln wird. Auch in solch kleinen Details wird diese Entwicklung sichtbar.
Windmühlen.
[Niederschrift 1960; BA I/3, S. 279–292]
- »Voriges Jahr komm’ich mit mei’m Koffer in die Gaststube rein – da sitzen an den Tischen 10 Herren in schwarzen Anzügen, still wie Geister. Ich hab’ auf die Uhr gekuckt: in der Viertelstunde, wo ich mit dem Wirt verhandelte, hat Keiner auch nur 1 Sterbenswörtchen gesprochen; kein Laut nichts; ich dachte, ich wär’ schon tot!« »Schachspieler?«, erkundigte der Gestreifte sich träge. [289]
-
Dies ist eines einer ganzen Reihe traumartiger Motive, die sich in Windmühlen aneinanderreihen und jeweils vom einem der Zuhörer des erzählenden Bademeisters in ähnlicher Weise ‚entschlüsselt‘ werden wie hier die zehn stummen Herren. Ganz leicht erinnert diese Stelle vielleicht an die von den Schach- und Lebensregeln in Dichter und ihre Gesellen.
‹Gesammelte Werke in 70 Bänden›.
Startschuß zum Beginn der Karl=May=Forschung.
[Niederschrift 1961; BA III/4, S. 55–64]
- […] aber in jener ‹Epoche seines Schaffens› hätte May jedwedem anderen Autor getrost beide Türme auf dem Brett der Verkitschtheit vorgeben können, und ihn dennoch mühelos geschlagen; [57]
-
Die Vorgabe beider Türme ist eine noch ein wenig höhere Vorgabe als die der Dame. Meisterspieler geben in freien Partien starken Spielern höchstens einmal einen Bauern und den Anzug vor, selten aber mehr. Daß May nach Schmidts Auffassung dennoch auf dem Brett der Verkitschtheit jedweden anderen Autor mühelos geschlagen hätte, ist ein Urteil, wie es vernichtender nicht ausfallen kann.
Das Bild von der Vorgabe beider Türme ist geborgt aus Wilhelms Raabes Roman Der Lar (1889).
Nebenbei bemerkt: Das schöne Wort Verkitschtheit findet sich bei Schmidt nur im Zusammenhang mit May.
Die Geschichte vom Riesen Jermak.
[Niederschrift 1961; BA III/4, S. 98–107]
- […] nur ein Narr oder ein Böswilliger kann ja behaupten, daß, was etwa die Kunst der Literatur anbelangt, Namen wie TURGENJEW, DOSTOJEWSKI, TOLSTOJ, GORKI, BRECHT nicht auch eine ausgesprochene Modell=Serie europäischer Literatur bildeten. Das ‹IGORLIED› ist von dem der ‹NIBELUNGEN› so verschieden nicht; auch die ‹KORSSUNSCHEN› PFORTEN halten den Vergleich mit Ghiberti oder Peter Vischer aus; was bedarfs noch der Erwähnung von MUSIK, SCHACHSPIEL oder WELTRAUMFAHRT? [99]
-
Ich habe diese Stelle etwas ausführlicher zitiert, um die kleine, boshafte Pointe zu präsentieren, daß Brecht bei Schmidt in die Reihe russischer Autoren gehört. Seit der kurzen Äußerung in Schwarze Spiegel hat sich an der Einschätzung der slawischen Kultur nicht so sehr viel geändert. Immerhin wird jetzt auch eine literarische Tradition genannt und die Weltraumfahrt an die Seite der anderen Kulturleistungen gestellt, aber der Kern des Ressentiments scheint sich nicht wirklich verändert zu haben: mein Gott: Schach und n bissel Musik! [I/1, 230] Der Verdacht liegt nahe, daß Schmidt von der russischen Kultur auch nicht sehr viel mehr kannte als das, was die Schlagwörter hier bezeichnen.
Die 10 Kammern des Blaubart.
[Niederschrift 1961; BA III/4, S. 108–114]
- Denn ob auch die GESELLSCHAFT IN DER VILLA eine nur bedingt gültige Gleichung zwischen Repetition und Höllengefühl herzustellen versucht, das HUNEKER GAMBIT ist wieder ausgesprochen gut: ein präsumtiv=bedeutender Mann, von einer nörgeligen Nichtganz=Zanktippe frustriert, ‹befreit› sich durch die Flucht ins Schachspiel – und einmal mehr frappiert der Kontrast zwischen der schmierig=normalen und einer gefährlich künstlich=künstlerischen Welt; die jedoch einwandfrei die geistvollere, ‹gerechtere›, also vielleicht bessere ist. [112]
-
Bei Die 10 Kammern des Blaubart handelt es sich um eine Schrift quasi pro domo: Es ist eine Besprechung des schmalen Erzählbändchens Sanfter Schrecken von Stanley Ellin, den Schmidt für den Goverts Verlag übersetzt hatte. Eine der zehn Erzählungen des Bandes ist Das Huneker-Gambit, eine Variation der Schachnovelle Stefan Zweigs. Der Protagonist George Huneker ist in seiner privaten Misere gefangen, die er hauptsächlich seiner herrschsüchtigen und stets schlechtgelauten Ehefrau zu danken hat. Ein älterer Arbeitskollege, den Huneker ein einziges Mal zu einem Abendessen eingeladen hatte, schenkt ihm als Gegengabe für eine berufliche Gefälligkeit ein Schachspiel, begleitet von der Bemerkung: „es gäbe gewisse Menschen auf der Welt, die Schach brauchten“. Huneker gerät nun – ganz ähnlich wie sein fernes Vorbild Dr. B. bei Stefan Zweig – ganz in den Bann des Spiel, das sich als Fluchtwelt vor seiner Ehe als ausreichend komplex erweist. Nur fehlt eben auch Huneker ein Gegner, da seine Frau sich weigert, das Spiel zu erlernen, und ebensowenig erlaubt, daß George Huneker ausgeht oder etwa seinen alten Kollegen zu sich einlädt. Huneker erschafft sich daher in sich selbst einen Gegner, der in sich alle die aktiven und weltzugewandten Eigenschaften Hunekers versammelt, die er in seiner Ehe nicht ausleben kann. Als seine Frau schließlich voll Eifersucht und Zorn darangeht, ihm das Spiel zu verbieten, erschlägt die neu in Huneker erstandene Persönlichkeit, die den Namen ‚Weiß‘ trägt, die Ehefrau mit dem Schürhaken. Der bald darauf eintreffenden Polizei gegenüber stellt sich Huneker mit dem Namen ‚Weiß‘ vor.
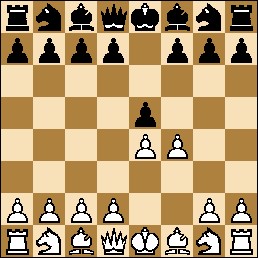
Es ist nicht verwunderlich, daß Schmidt diese Erzählung schätzte, da sie das Thema einer Flucht- bzw. Alternativwelt zur Wirklichkeit thematisiert, das in Schmidts Schreiben und Denken eine zentrale Stellung einnimmt. Schmidt selbst hatte die Eignung des Schachs als Fluchtwelt schon in Dichter und ihre Gesellen angedeutet.
Vielleicht ist es an dieser Stelle einmal sinnvoll, den bereits öfter verwendeten Begriff Gambit zu erläutern: Als Gambit bezeichnet man eine Eröffnung, in der eine Seite kurz- oder auch langfristigere materielle Nachteile in Kauf nimmt (zumeist handelt es sich um das frühe Opfern eines Bauern), um dafür positionelle Vorteile zu erhalten. So bietet sowohl im Damen- als auch im Königsgambit (Diagramm) Weiß einen ungedeckten Bauern zum Schlagen an, um die eigene Figuren-Entwicklung zu beschleunigen; Schwarz entscheidet in diesen Eröffnungen dann darüber, ob daraus ein angenommenes oder ein abgelehntes Gambit entsteht. Im Fall George Hunekers etwa könnte man annehmen, daß er einen Teil seiner Persönlichkeit geopfert hat, um in den Genuß eines Heims und einer Familie zu gelangen. Offenbar erwies sich dieses Opfer als kritisch, wenn auch nicht ganz auszumachen ist, ob George Huneker die Partie seines Lebens am Ende gewonnen oder verloren hat. Seine Frau aber hat mit Sicherheit verloren.
Nachwort zu Coopers »Conanchet«
[Niederschrift 1961; BA III/4, S. 130–169]
- Nun kam der, sorgsam benützte siebenjährige Europa=Kursus; wo [Cooper] nicht nur Französisch und Italienisch lernte – aber wirklich ‹fließend›! – (sogar ein paar Brocken Deutsch; wenn er, schon im hohen Alter, von seiner Frau im Schach geschlagen wurde, und ihre Freude merkt, schreibt er, obwohl er selbst auch gern gewonnen hätte, hinter die Tagebuchnotiz noch ein »Besser so.«); [146]
-
Vgl. oben die Anmerkung zu Siebzehn sind zuviel!
Sitara und der Weg dorthin. Eine Studie über Wesen,
Werk & Wirkung KARL MAY’s
[1963; BA III/2]
- »Nacht« muß es sein, ja dreimal »Mitternacht« im Lande der »Merd=es=Scheitan« (‹merde› und ‹Schei›) wenn man die ‹Kerze› in die ‹Mündung› der ‹Höhle› der Schachmeisterin stellt – eines ‹Spieles›, bei dem man, wenn ich mich recht erinnere, ganz leicht ‹matt› werden kann, (in B & B wird gar ein »Schach geritten«: MD gegen den Chef der Analer; das müßte ’ne Partie geworden sein; übrigens ist MD in diesem Spiel so stark, daß sie nicht zu schlagen ist) – imgrunde alles recht krasse Ausdrückungen & recht raffinierte Anekdötchen. [193]
-
Hier sind zuerst zwei Abkürzungen aufzulösen:
- MD: Marah Durimeh, eine Figur aus dem Spätwerk Mays.
- B & B: Babel und Bibel, ein Theaterstück aus dem Spätwerk Mays.
Dies ist die erste Stelle des Spätwerks, an der Schmidt versucht, aus Begriffen des Schachspiels sexuell konnotierte Pointen zu gewinnen. Es würde hier zu weit gehen, die von Schmidt entwickelte ‚Theorie‘ zu erläutern, die diese Assoziationsarbeit in den Status einer Erkenntnis heben soll. Die Stelle wird hier nur angeführt, weil sie einen Umbruch in der Darstellung des Schachspiels markiert. Von hier an wird Schach zunehmend profaniert und verliert den Status einer Kunst oder eines besonderen Kulturgutes.
Unsterblichkeit für Amateure
[Niederschrift 1963; BA III/4, S. 322–328]
- (Und ich möchte jedem Menschen, als reine Scharfsinnsübung, einmal dies empfohlen haben: sich von einem Freund die der Länge nach in der Mitte durchgeschnittene Seite eines ihm unbekannten Buches geben zu lassen; und nun zu versuchen, das Fehlende zu ergänzen. Oder, wenn er das lieber mag, eine Schachpartie, von der man die weißen Züge hat, zu komplettieren.) [325]
-
Erstaunlich, daß Schmidt dies jedem Menschen empfiehlt, während dies in den Dichtergesprächen noch, ob der damit verbundenen ungeheuerlichen Schwierigkeiten [I/4, 291], nur vom vorzüglichsten analytischen Kopf des Elysiums, Edgar Allan Poe, gelöst werden konnte. Das Problem scheint sich mit den Jahren in Schmidts Vorstellung immer mehr abgeschliffen zu haben und immer mehr zu einer Phrase geworden zu sein.
Vgl. dazu auch die Anmerkungen zu den Dichtergesprächen und den Berechnungen II.
Eines Hähers »: Tué!« und 1014
fallend.
[Niederschrift 1964; BA III/4, S. 389–400]
- Oder wie steht nicht für Kenner – tja; wo sind sie? – mit 1 Zuge der ganze Mann da, wenn ich bei COOPER lese: »18. 1. 48, Dienstag. Apostelgeschichte. Schlechte Nacht gehabt, weil Zwieback aus Boston gegessen: Yankee=Ware bekommt mir nie! Gegen Morgen leichtes Schneetreiben; aber nicht genug, um die abgetauten Stellen wieder zu bedecken. Spaziergang ‹Großer Fauler Mann›: hat man doch tatsächlich den Hain verhunzt! Ist nunmehr angeblich ein Mahnmal von des Volkes ‹Freiheitssinn & Ehrlichkeit›: ich kenn’ die Brüder; eher würd’ ich mich auf Sträflinge verlassen! 10. Kapitel von ‹Openings› beendet: dies Buch ist wahrlich keine Liebesmüh, man bloß Müh. Abends Schach mit Frau. Beim 2. Mal eines ihrer Blitz=Matts, Ruck=Zuck! (1 solcher Sieg versetzt sie für den ganzen Abend in gute Laune; ich seh’ das zu gern. – Wird übrigens merklich fetter; ist aber reiner Mangel an Bewegung in frischer Luft.« [390]
-
Dieses ‚Zitat‘ ist tatsächlich eine Kompilation von sieben Einträgen aus James Fenimore Coopers Tagebuch vom Anfang des Jahres 1848. Das von Schmidt gewählte Datum findet sich zwar auch unter den kompilierten Einträgen, ist aber natürlich auch durch Schmidts eigenen Geburtstag determiniert. Zur Erwähnung des ehelichen Schachspiels bei den Coopers vgl. auch oben Siebzehn sind zuviel! und Nachwort zu Coopers »Conanchet«.
Zettel’s Traum
[1970]
- Das 'Schloß in Ungarn';(in dem die Schach=Varianten vorkomm';die zur Eröffnunc 'b2 = b4');...(?) [am rechten Rand:] ((:mit 'b4 -b5' als Fortsetzunc... [ZT 11]
-
Dies ist offensichtlich eine Anspielung auf den ersten Teil des Fragments Die Insel, der Das Schloß in Böhmen überschrieben ist, in dem allerdings keine Varianten zu Orang-Utan (s.o.) zu finden sind. Schmidt schreibt in Zettel’s Traum die Erzählung Das Schloß in Ungarn einem Alter ego des Erzählers Daniel Pagenstecher zu, einem Schriftsteller, der angeblich um 1850 von ortsansässigen Bauern ermordet worden sei und seitdem die Gegend als Geist unsicher mache. Diese Schauergeschichte, die zudem auch noch auf einem Grundstück mit dem Namen ‚Schauerfeld‘ erzählt wird, ist aus mehreren Gründen recht fadenscheinig, nicht zuletzt deshalb, weil Orang-Utan als Eröffnung 1850 kaum schon erfunden war.
- (& 1 Seite davor erscheint 'das geheime TriebWerck d berühmten hölzernen Schachspielers...' -also POE's VAN KEMPELEN...)) [ZT 417, linke Spalte]
-
Zum ‚Türken‘ vgl. oben die Anmerkung zu Der junge Herr Siebold.
- :"HasDe Ihr übrijns SchachSpieln beigebracht,Paul ? - 's gehört ja ganz einfach zur geistig'n Garnitur eines Menschen.")) [ZT 476, rechte Spalte]
-
In der Hauptspalte geht es an dieser Stelle um Franziska Jacobis schulische Leistungen, und dem Erzähler Daniel Pagenstecher fällt diese Frage en passant ein. Obwohl wir die Antwort von Franziskas Vater Paul nicht zu lesen bekommen, können wir aus dem ja des zweiten Satzes wohl entnehmen, daß er es getan hat. Zwar erscheint hier das Schachspiel noch als Teil der vollständigen Bildung eines Menschen, aber die besondere Hochschätzung als ‚Kunst‘, die das Spiel in den ‚Juvenilia‘ und dem Frühwerk genießt, wird nicht mehr erwähnt. Wie wir gleich lesen werden, ist das Schachspielen inzwischen zum Künstlein degradiert worden.
Nebenbei sei hier angemerkt, daß diese Stelle die von Klaus Pauler vorgenommene Zuordnung des Rösselsprungquadrats auf S. 234 zur Figur Franziskas in Frage stellt, da Daniel Pagenstecher dann auf S. 476 wüßte, daß Franziska Schach spielen kann. [Vgl. Klaus Pauler: Roessel- und andere Spruenge in ZETTELS TRAUM. In: Zettelkasten 3. Hg. v. Karl-Keinz Brücher. Frankfurt/M.: Bangert & Metzler, 1984. S. 11–32.]
- : in den 'Ostblockstâttn' dürfn gewisse 'wortlose Künstlein' blühen - so Tanz, Eislauf, Musik, Mathematik & Schach. [ZT 532]
-
Eine ähnliches Ressentiment war schon in Schwarze Spiegel aufgetaucht und hatte sich in Die Geschichte vom Riesen Jermak positiv gewendet wiederholt. Die Nennung des Schachspiels zusammen mit Eis[kunst]lauf – die ‚Kunst‘ wird hier wohl absichtlich weggelassen worden sein – und Tanz (vgl. oben die Anmerkung zu Aus dem Leben eines Fauns) lassen den Grad erahnen, in dem das Schachspiel in der Wertschätzung des Autors gefallen ist. An dieser Stelle wird als Grund für die Abwertung die Wortlosigkeit dieser Künstlein angeführt, obwohl dann später gerade die Bezeichnungen des Schachs dazu dienen, das Schachspiel und seine Spieler zu psychoanalysieren. (Vgl. auch unten.)
- dasheißt : früher,so vor 30 Jahren, wär'Ich ooch n paar Kilometer gereist, um Mich von Aljechin schlagn zu lassn;(oder war's Bogoljuboff gewesn ? Der hatte gegn uns 20 simultan=gespielt - natürlich mit dem (ihm wohl vertraglich=auferlegten ?) Ergebnis : also 17 schlagn; mit 2 Remis machn; 1 gewinn'n lassn;(Ich war bei den 17 gewesn) [ZT 547]
-
Alexander Aljechin (1892–1946), russischer Schachspieler, war, nachdem er 1927 Raoul Capablanca geschlagen hatte, mit einer Unterbrechung zwischen 1935 und 1937 bis zu seinem Tod Schachweltmeister. Aljechin entstammte einer wohlhabenden Familie, verlor aber durch die Oktoberrevolution all seinen Besitz und lebte ab 1920 im Exil, hauptsächlich in Frankreich, hat aber bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs immer auch am aktiven Schachleben in Deutschland regen Anteil genommen. Für 1936 läßt sich eine Simultanveranstaltung in Dresden nachweisen, die etwa für eine biographische Unterfütterung dieser Textstelle in Frage käme. Die Merkwürdigkeit, daß diese Erwähnung Aljechins überhaupt die einzige Nennung eines der vier ersten Schachweltmeister ist, wurde oben bereits einmal festgestellt.
Efim Bogoljubow (1889–1952), geboren in der Ukraine, war seit 1927 deutscher Staatsbürger. Er spielte 1929 und 1934 mit Aljechin um den Weltmeistertitel, verlor beide Wettkämpfe aber deutlich. Von Mitte der 20er bis zum Anfang der 30er Jahre war Bogoljubow einer der führenden Spieler der Welt, was zahlreiche Turniererfolge belegen. Sein Einfluß auf das Schach im Vorkriegs-Deutschland muß als bedeutend angesehen werden. Bogoljubow käme als ein Kandidat für eine biographische Verankerung der Textstelle weit eher in Frage als Aljechin, da er in den 30er Jahren unzählige Simultanveranstaltungen in ganz Deutschland gespielt haben dürfte.
Beim Simultanspiel spielt ein einzelner Spieler gleichzeitig gegen mehrere Gegner. Dies ist eine populäre Gelegenheit für Amateure, einmal gegen einen Großmeister spielen zu können. In der Regel hat der Meisterspieler an allen Brettern die weißen Figuren und bewegt sich in einem Ring aus Tischen von Brett zu Brett. Seine Gegner sind gehalten, ihren Zug zu machen, wenn der Meister an ihr Brett tritt; dies führt, nachdem schon etliche Partien beendet sind, zu immer kürzeren Bedenkzeiten, wobei erfahrungsgemäß die Spielstärke von Amateuren deutlicher nachläßt als die von Meistern. (Vgl. auch: GM Anand bei einer Simultanveranstaltung)
- (Er, B., hatte ein RiesenBierglas an den Mund geführt, es ,ohne abzusetzen,geleert;& angemerkt:'Das war auch ein starker Zug.-' [ZT 547, rechte Spalte]
-
Dies mag als ungesicherte Anekdote über Bogoljubow hier einfach ohne weiteren Kommentar so stehen bleiben.
- ('Schach=spielen':och so'ne Beschwichtijung des Ich & ÜI durch Vorgauk'lung einer sauberern'gerechteren',klein=höllzernen Welt) [ZT 776, rechte Spalte]
-
Auch dies nimmt negativ gewendet ein Motiv wieder auf, das wir schon in Dichter und ihre Gesellen und Die 10 Kammern des Blaubart angespielt fanden: Das Schachspiel als Fluchtwelt, die aufgrund ihrer ausreichenden Komplexität als Surrogat für die Wirklichkeit dient. Nur wird dieser Gedanke in Zettel’s Traum vom Protagonisten negativ bewertet: Im Schach werden Ich & ÜI (Schmidts Abkürzung für das Freudsche Über-Ich) durch eine Vorgaukelung beschwichtigt, während der wahre Künstler sich mittels sprachspielerischem Humor aus der Misere der Wirklichkeit befreit und lachend den Forderungen der ‚Realität‘ begegnet. Spätestens mit Zettel’s Traum wird die Bandbreite der möglichen Fluchtwege radikal eingeschränkt: Von hier kann allein die Literatur noch eine vollwertige Gegenwelt bieten, und auch das nur in ihrer höchsten Ausprägung gemäß dem Schmidtschen Kanon. Die anderen Wege, auf die der Erzähler des Leviathan noch hoffte [vgl. I/1, 54], sind alle der feindlichen ‚Realität‘ zugeschlagen. Rettung liegt von hier an einzig noch im Wort.
-
('in Zeitnot',wie man beim Schach sagt) [ZT
896]

-
Eine von zwei Stellen, an denen Schmidt von der Zeitbegrenzung beim Schach durch Schachuhren spricht. Wie bereits erwähnt wurde seit der Mitte des 19. Jahrhunderts im Wettkampfschach die Bedenkzeit für die beiden Spieler begrenzt. Dies geschieht mittels Schachuhren, klassischer Weise zwei über eine Mechanik miteinander verbundene Uhren, von denen die eine in Gang gesetzt wird, wenn man die andere anhält. Zur Zeit ist in deutsche Ligen eine Bedenkzeit von zwei Stunden für die ersten 40 Züge und einer weiteren Stunde für den Rest der Partie üblich, so daß eine Partie spätestens nach sechs Stunden beendet ist. Verbraucht ein Spieler seine Bedenkzeit bevor er die erforderliche Anzahl von Zügen gemacht hat bzw. verbraucht er seine gesamte Bedenkzeit eher als sein Gegner, verliert er die Partie. Die Annäherung an die Zweistunden- und die Dreistundenmarke nennen Schachspieler ‚Zeitkontrolle‘. In ‚Zeitnot‘ ist ein Spieler traditionell dann, wenn ihm weniger als 15 Minuten Bedenkzeit bis zur Zeitkontrolle verbleiben und er zugleich für jeden Zug, den er innerhalb der verbleibenden Zeit machen muß, durchschnittlich weniger als eine Minute zur Verfügung hat.
- :spielt Ihr eigntlich noch 'Schach' zusamm' ? -";('höchstenS zu Feiertagn'?;schade):" 's'ss eins der gu-/besten Mittl, um eheliche AggressionsGelüste abzureagier'n...? [ZT 927]
-
Auch dies ein Motiv, das Schmidt schon mehrfach thematisiert hat, allerdings bis dahin immer im Zusammenhang mit Cooper (vgl. Siebzehn sind zuviel!, Nachwort zu Coopers »Conanchet« und Eines Hähers »: Tué!« und 1014 fallend.)
-
dâ;nebm'm Go=Spiel;"
(und Er säufzDe. Dann,auf Meine Frage)) : "I=wo. Son japanischer
Bluff; - pure SchlachtNachahmung,wie alle diese Brettspiele,(und wenn's
'Dame' iss). - Mir hat's ma n Verleger beibringen wolln,('ch
nenn keene Nam');und ich hab''m zugehört,weil ich den Ufftrag
brauchte. So das übliche Asiatische Gefâsl : da soll's
'unvergleichlich=viel=schwerer' sein als Schach,(die Meister teilen
sich in 88 Grade ein : kein Europäer hat auch nur den 3.=von=untn
erreicht !);:vom 8.=an darfsDe bloß noch im Steh'n fikkn; jenseits
des 16. genießDe keene irdischn Speisn mehr; und so geht'as weiter :
die arschnackte Sektiererei ! [ZT 976]
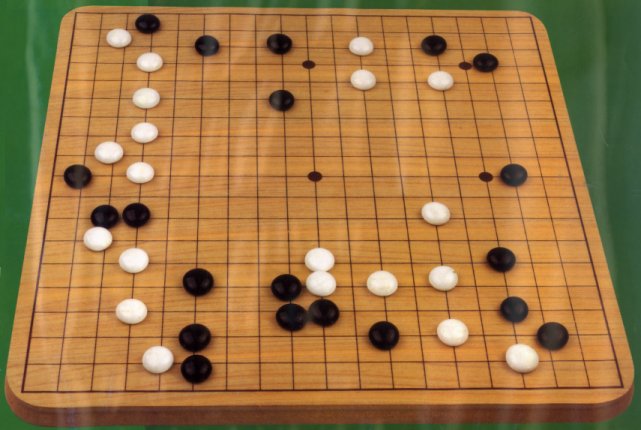
-
Die einzige Stelle im Schmidtschen Werk, an der das Go-Spiel erwähnt wird. Das Go (das Wort ‚Go‘ ist japanisch; auf Chinesisch heißt das Spiel Wei-Chi) hat seinen Ursprung in China und ist der Legende nach 4000 Jahre alt. Spielbrett und Spielsteine sind jedenfalls in einer sehr frühen Epoche der chinesischen Kultur entstanden und dienten ursprünglich wahrscheinlich astronomisch-astrologischen Zwecken. Das Spiel in seiner heutigen Form manifestierte sich wohl im 8. Jahrhundert v.u.Z. und existiert seitdem prinzipiell unverändert fort.
Go wird auf einem zu Anfang leeren, mit 19 horizontalen und 19 vertikalen Linien versehenen Spielfeld gespielt. Die Spieler setzen abwechselnd Steine auf einen der 361 Schnittpunkte dieser Linien, der eine Spieler die weißen, der andere die schwarzen Steine, wobei der Spieler mit den schwarzen Steinen beginnt. Ziel des Spieles ist es, auf dem Brett mit den eigenen Steinen Gebiete abzugrenzen und so zu sichern, daß es dem Gegner nicht möglich ist, innerhalb dieser Gebiete Steine abzulegen, ohne daß diese geschlagen werden können. Wer sich am Ende der Partie das größere Gebiet gesichert hat, gewinnt das Spiel.
Go hat einen deutlich anderen Charakter als das Schachspiel, da das strategische Element gegenüber dem taktischen ein deutliches Übergewicht hat. Dem Schlagen von Steinen kommt ein sehr viel geringere Bedeutung zu als im Schach, wo etwa der Gewinn eines Läufers oder Springers bereits spielentscheidend sein kann. Wie schwierig dieses Spiel ist, läßt sich vielleicht auch daran ablesen, daß Schachprogramme inzwischen eine Stärke erreicht haben, die mit der der besten menschlichen Spieler zu vergleichen ist, während Go-Programme trotz Auslobung lukrativer Preise bislang höchstens auf dem Niveau eines mittleren Amateurs spielen. Der Internationale Schachmeister und Vize-Europameister im Go Jürgen Dueball sagte mir zu diesem Thema einmal: „Es gibt nur zwei Arten von Spielen: Die eine ist Go, und der Rest ist Quatsch!“
Die Go-Spieler kennen zum Vergleich ihrer Spielstärke ein System von Rangstufen, in dem der Anfänger etwa den 30. Kyu einnimmt. Bei wachsender Spielstärke nimmt die Zahl erst ab, bis der Schüler den 1. Kyu erreicht. Danach kann er den ersten Meistergrad, den 1. Dan erlangen. Das System findet seine Grenze beim 9. Dan; allerdings werden die Amateur-Grade nochmals von den Profi-Dans übertroffen (ähnliche Einteilungen finden sich auch in den asiatischen Kampfsportarten). Die Rangstufen sollen immer in etwa einem Unterschied von 10 Punkten bei der Endabrechnung einer Partie entsprechen, d.h. ein Spieler, der den 2. Kyu inne hat, sollte gegen einen 1. Dan mit ca. 20 Punkten verlieren. Um das Spiel unterschiedlich starker Spieler interessanter zu machen, kann dem schwächeren Spieler auch eine Vorgabe eingeräumt werden, die sich an der Differenz im Rangsystem orientiert.
Arno Schmidt hat das Go-Spiel durch seinen Greiffenberger Vorgesetzten Johannes Schmidt kennengelernt:
Verwunderlich – und für mich enttäuschend – war, daß ich Arno Schmidt nicht für das (japanische bzw. chinesische) Go gewinnen konnte. Zwar hatte er in einigen Minuten die so genial-einfachen Grundregeln begriffen, und er schenkte auch der Demonstration einer Spiel-Eröffnungsphase […] gnädige Aufmerksamkeit; aber dabei blieb es. [Johannes Schmidt: »…jene dunklen Greiffenberger Jahre«. In: »Wu Hi?« Arno Schmidt in Görlitz Lauban Greiffenberg. Hg. v. Jan Philipp Reemtsma und Bernd Rauschenbach. Zürich: Haffmans, 1986. S. 136]
Daß sich Schmidt für Zettel’s Traum dieser alten Einführung in das Spiel erinnerte, dürfte seinen Grund in dem zentralen Gesprächsgegenstand der Figuren des Romans haben: dem Werk Edgar Allan Poes. Schmidt liefert mit dieser Passage eine Parallele zu jener oben bereits teilweise zitierten Stelle gegen das Schachspiel am Anfang von Poes Erzählung The Murders in the Rue Morgue. Ähnlich ver-, an- und umgewandelt finden sich viele Poe-Motive in Zettel’s Traum wieder.
-
(Du,vo''m 'Japanischen
SchachMeister' hab Ich aber Mein Lebtag noch nischt gehört
!) [ZT 976, rechte Spalte]

-
Daß Daniel Pagenstecher, der Erzähler von Zettel’s Traum, noch von keinem japanischen Schachmeister gehört hat, ist für die 60er Jahre nicht weiter verwunderlich. Bis heute führt die internationale Schachorganisation FIDE keinen japanischen Schach-Großmeister in ihren Listen. Das rührt nun nicht etwa daher, daß die Japaner von Natur aus zum Schach nicht befähigt wären, sondern liegt schlicht daran, daß sie mit dem Shogi eine eigene Schachvariante besitzen, die wahrscheinlich denselben Ursprung hat wie das europäische Schach und in etwa gleich alt sein wird. Shogi wird auf einem 9×9-Brett gespielt; alle Spielsteine haben die gleiche Farbe und zeigen nur durch ihre Form an, welchem Spieler sie gehören. Dies hat den Grund, daß im Shogi die Spieler ersatzweise für das Ziehen eines Steins einen geschlagenen gegnerischen Stein auf einem freien Feld wieder einsetzen können. Außerdem hat das Shogi andere Promotionsregeln als das europäische Schach: Jeweils die letzten drei Reihen stellen die Festung des Spielers dar. Ein Stein, der in die gegnerische Festung zieht, wird zu einem höheren Rang promoviert, wobei dieser Rang nicht vom Spieler frei gewählt wird, sondern vom Ausgangswert der Figur abhängig ist. Jeder Spielstein trägt daher auf seiner Unterseite den höheren Rang, so daß der Stein beim Betreten der gegnerischen Festung einfach herumgedreht werden kann. Shogi ist in Japan neben Go weit verbreitet und sehr beliebt. Angesichts der Tatsache, daß die Japaner gleich über zwei große Traditionen strategischer Spiele verfügen, die dem Schach an Komplexität zumindest gleichwertig, wenn nicht gar überlegen sind, ist es nicht verwunderlich, daß das europäische Schach dort nur auf wenig Interesse trifft.
-
Mit Thränen im Auge
hab'Ich Se,(wie oft !),beschworen, doch der
Unsterb/& endlichkeit zu gedenkn - wàs
ha'm Se erwidert ?:dá=für sey das Ihn'n geläufichsde
Symbol 'Remis durch Dauerschach';(Se war'n grade dabei,
zusamm'n MIESES=DUFRESNE durchzuarbeitn - [ZT 1280]
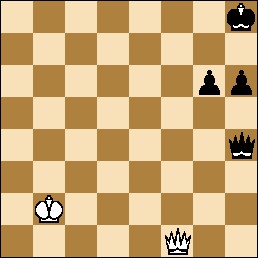
-
Daß das weit verbreitete Lehrbuch des Schachspiels von Dufresne und Mieses eine Hauptquelle für Schmidts Schachwissen darstellte, wurde bereits mehrfach erwähnt.
Remis durch Dauerschach oder das ‚ewige Schach‘ erläutert die 11. Auflage (1926) des Lehrbuchs an der nebenstehenden Stellung wie folgt:
In [dieser] Stellung z. B. kann ein ewiges Schach herbeigeführt werden. [Diagramm] Weiß bietet mit Dame auf f 8 Schach. Der schwarze König muß auf h 7 gehen, alsdann bietet Weiß mit der Dame auf f 7 Schach und zwingt den König, nach h 8 zurückzukehren, dann bietet Weiß wiederum auf f 8 Schach usw.
Weiß macht also das Spiel durch ewiges Schach unentschieden, während es sonst verloren wäre; [S. 30 f.]Über diesen letzten Satz sollte man vielleicht im Zusammenhang von Unsterblichkeit & Unendlichkeit, in den dies in Zettel’s Traum doch immerhin eingestellt ist, noch einmal ausführlicher nachdenken.
Die Schule der Atheisten
[1972; BA IV/2]
- Nu zum Exempel das ›SchachSpielen‹; dem viele Schriftsteller zugetan sind; (anschein’nd ohne es als Aufbau=, als KonstruktionsÜbung zu erKennan – !) [150]
-
Dies erinnert wieder an die Redeweise von der klein=höllzernen Welt des Schachspiels in Zettel’s Traum (s.o.) und den damit verbundenen Gedanken des Schachs als eigenständige Gegenwelt zur Wirklichkeit (vgl. auch Dichter und ihre Gesellen und Die 10 Kammern des Blaubart). Dieses Motiv erscheint hier sozusagen in handwerklicher Anverwandlung. Wie so viele poetologische Einfälle Schmidts, bleibt auch dies recht abstrakt, und es erscheint recht schwierig, sich diese Idee im konkreten Prozeß vorzustellen, falls denn der Satz mehr besagen soll, als daß sich Roman- und Schachfiguren nach je eigenen Regeln umeinanderbewegen.
-
BUTT: »Was?! –: Wie!? –: –: ›Das
Ballett‹: keine=Kunst!? –«
SCHWEIGHÄUSER: »Genau so=wenich wie ›EiskunstLauf‹; ›SchachSpiel‹; oder ›GewichtHebm‹ … [165] -
Auch dies war ähnlich schon in Zettel’s Traum zu lesen gewesen.
- »Sie sind ›Schachspieler‹?« (Nadda wer’n Se sich ja wundern über Ihr ›Ludes Latrinculorum‹): »Ich mache Mich anheischich: lediglich aus der LieblingsEröffnung eines Mensch’n seine TriebAusrichtung zu erkenn’! [174]
-
Beim Ludus latrunculorum, dem ‚Söldner-Spiel‘. handelt es sich um ein römisches Brettspiel von dem wir nur wenig wissen. Ziel des Spieles war wohl, alle gegnerischen Spielsteine, die ‚latrones‘, ‚latrunculi‘ (beides von lat. ‚latro‘, der Söldner) oder ‚milites‘ (lat., Soldat), zu schlagen. Geschlagen wurden gegnerische Steine wohl dadurch, daß sie zwischen zwei eigenen Steinen eingeschlossen wurden. Als Spielbrett diente ein schachähnliches Brett von 8×8, 9×9 oder auch 11×14 Feldern, wobei die Spielsteine die Linien, nicht die Felder besetzten. Schmidt Verschreibung des Spielnamens zu latrinculorum deutet schon an, in welche Richtung die nachfolgende lange Passage geht. Zur Ermittlung der Triebausrichtung eines Menschen werden übrigens im weiteren nicht Charakteristika der entstehenden Stellungen herangezogen, sondern sie erfolgt ausschließlich durch ‚Analyse‘ der Namen, die die Eröffnungen tragen; erstaunlich bei einem angeblich wortlosen Künstlein (s.o.).
Da es sich bei der Figur Butt, die dies und das weitere vorträgt, um eine Art philosophischen ‚Hanswurst‘ handelt, sollte es nicht zu ernst genommen werden. Ich beschränke mich daher auf sachliche Erläuterungen und überlasse tiefer reichende Kommentare Berufeneren.
- BUTT (also Ich seh ma ganz von den gröberen Erwägungin, à la ABRAHAM, ab; aber): »Sämtliche EheLeute solltn, von=standesamtswegn, zum mit=einander (richt’jer ›gegen=‹einander) Schachspiel’n, verpflichtet werdn: bezwecks Abreagieren der schlimmstn sadistischn Agression’n!; (1 Beispiel für=Alle: COOPER & seine – (Ich will Ihr’n AschenKrug gar nich unnötich rüttln) – hyper=Victorianische ›Augusta‹!)«; (so; und jetz wappnen Se sich, mon Signore!« –: ? –: [174]
-
Äußerungen des Psychoanalytikers Karl Abraham zum Schachspiel sind mir nicht bekannt; für Hinweise bin ich dankbar. Mag sein, Schmidt spielt damit nur auf das von ihm gern zitierte ‹there is something in names› an, in dessen Zusammenhag er auch Karl Abraham einmal erwähnt [vgl. BA III/4, 434].
Zum Schachspiel unter Eheleuten vgl. oben: Siebzehn sind zuviel!, Nachwort zu Coopers »Conanchet«, Eines Hähers »: Tué!« und 1014 fallend und Zettel’s Traum.
- (1.) Eröffnungin: = ›Öffnung = Ø‹, und deren ›Öffnin‹: das KÄSE=RITZKI=Gambit. (Kann auch ›Müttel=Gambit‹ sein; (&=immer plus ›dar il gambetto‹ (+ ›Bett‹) ›ein Bein=stellen‹). /: ›Caro, (= der Geliebte), kann!; (CARO=Cann). / Wenn SIE nicht=mag, ist’s ein ›abgelehntes DamenGambit‹; (’S gibt aber auch ein ›angenommenis‹; das nicht=selt’n, in einer ›Hänge‹=Partie endit.). – Gibt ein Cunny(ng)=Ham=Gambit. / Das ›KönigsSpringerSpiel‹ verweist auf den ›KönigsSprunc‹. / Das ›EVA(n)S=Gambit. / Po/unziani’s ErÖffnunc. / DamenBauer gegn KönigsBauer. / Oder ziehen Sie ›Indisch‹ vor?; (= ›es war doch schön, ›französisch‹!‹. / phil’i’d’Ors=Gambit. – [174]
-
Beim Kieseritzky-Gambit handelt es sich um eine Variante des Königsgambits, benannt nach Lionel Kieseritzky (1806–1853), der dadurch im Gedächtnis der Schachspieler geblieben ist, daß er Adolf Anderssens Gegner in der ‚Unsterblichen‘ war.
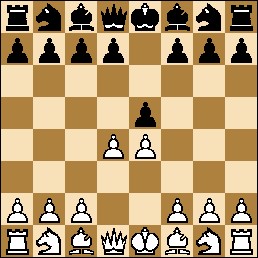
Das Mittelgambit ist gekennzeichnet durch die Stellung, die nach 1.e4 e5 2.d4 entsteht (Diagramm rechts). Zu dem von Schmidt richtig mit ›ein Bein stellen‹ übersetzten Begriff Gambit vgl. oben den Kommentar zu Die 10 Kammern des Blaubart. Die Caro-Kann-Eröffnung, die nach den Zügen 1.e4 c6 entsteht (Diagramm unten), wurde von dem Wiener Schachspieler Markus Kann in der 80er Jahren des 19. Jahrhunderts erfunden und später unter Federführung des englischen Spielers Horation Caro in die Turnierpraxis eingeführt. Sie wird auch heute noch auf höchstem Niveau gespielt. Beim Damengambit handelt es sich um die Züge 1.d4 d5 2.c4, wobei das angenommene durch den Zug 2… dxc4 entsteht, während das abgelehnte Damengambit eine ganze Reihe von Verteidigungssystemen umfaßt. Auch das Damengambit gehört zu den ältesten Eröffnungen, die schon in den frühen Schachlehrbüchern worden beschrieben sind. Die meisten der möglichen Verteidigungssysteme werden in der heutigen Turnierpraxis auf allen Niveaus gespielt.
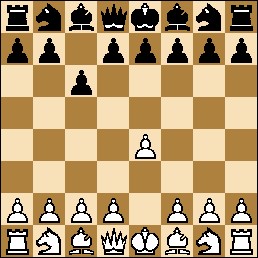
Bei einer Hängepartie handelte es sich um ein Verfahren, das heute aus der Turnierpraxis gänzlich verschwunden ist. Bis vor einigen Jahren war die Bedenkzeit für eine Schachpartie in der Regel nicht absolut begrenzt, sondern richtete sich auschließlich nach der Anzahl der gespielten Züge. So war eine Bedenkzeitregelung von zwei Stunden für die ersten 40 Züge und danach jeweils einer Stunde für weitere 20 Züge durchaus üblich. Partien, die 80 Züge oder mehr aufwiesen, konnten sich daher beachtlich in die Länge ziehen. War nach einer bestimmten Gesamtspielzeit (z. B. sechs oder acht Stunden) die Partie immer noch nicht beendet, so wurde sie unterbrochen. Der am Zug befindliche Spieler führte seinen nächsten Zug nicht auf dem Brett aus, sondern notierte ihn auf einem Formular, das in einem Umschlag verschlossen wurde. Auf dem Umschlag wurden die Abbruchstellung, die verbrauchte Zeit beider Spieler etc. notiert und der Umschlag wurde vom Schiedsrichter in Verwahrung genommen. Beide Spieler hatten nun das Recht, bis zur vereinbarten Wiederaufnahme der Partie die entstandene Stellung zu analysieren, auch mit der Unterstützung von Trainern, Vereinskollegen, Büchern etc. In einzelnen Fällen ergab eine solche Analyse einen eindeutigen Gewinnweg für eine Seite, so daß die Hängepartie nicht wieder aufgenommen wurde, bzw. gleich nach dem Ausspielen des in den Umschlag gegebenen Zuges beendet war. Es gibt aber auch Beispiele für Partien, die durch gleich zwei Hängephasen gegangen sind. Mit dem Anwachsen der Spielstärke der Computerprogramme und der Möglichkeit, solche Programme auch auf Laptops einzusetzen, wurde die Idee der Hängepartie zunehmend obsolet, da man in den meisten Fällen faktisch zwei Rechner den Ausgang der Partie hätte entscheiden lassen. Es wurde daher dazu übergegangen, die Bedenkzeit für eine Partie absolut zu begrenzen. Zur Zeit wird in den deutschen Ligen mit folgender Bedenkzeitregelung gespielt: Zwei Stunden für die ersten 40 Züge, eine Stunde für die folgenden 20 und eine halbe Stunde für den Rest der Partie, so daß ein Spiel spätestens nach sieben Stunden beendet ist. Sollte ein Spieler die Zeit überschreiten, bevor er die nötige Anzahl von Zügen gemacht hat oder die Partie anderweitig beendet wurde, verliert er das Spiel. Natürlich kann aus jeder Eröffnung heraus eine Hängepartie entstehen, nicht nur aus dem Angenommenen Damengambit.
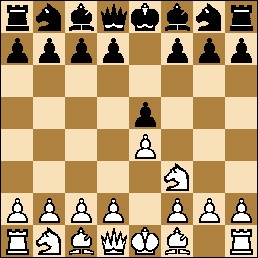
Auch das Cunninham-Gambit, benannt nach dem Schotten Alexander Cunningham, ist eine Variante des Königsgambits. Der Begriff Königsspringerspiele bezeichnet eine ganze Gruppe von Eröffnungen nach 1.e4 e5 2.Sf3 (Diagramm rechts),darunter auch das Evans-Gambit, eine Variante der Italienischen Eröffnung, benannt nach dem englischen Captain W.D. Evans. Das Evans-Gambit ist in letzter Zeit wieder häufiger in der Turnierpraxis zu finden. Die Ponziani-Eröffnung gehört zu den ältesten Eröffnungssysteme, wird aber in der heutigen Praxis kaum mehr gespielt. Sie ist benannt nach Domenico Lorenzo Ponziani,
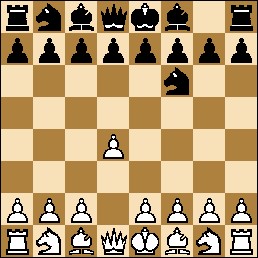 einem Vertreter der Schachschule
von Modena, der mit seinem Buch Il giuoco incomparabile degli
scacchi (1769) einen wichtigen Beitrag zur Schachtheorie seiner Zeit
leistete. Damenbauer gegen Königsbauer ist die in
älteren Auflagen des Lehrbuch des Schachspiels von Dufresne
und Mieses gebrauchte Umschreibung für die Skandinavische
Verteidigung; vgl. dazu oben die Anmerkung zu Dichtergespräche im Elysium. Mit
Indisch bezeichnen Schachspieler eine ganze Gruppe von
Eröffnungen gegen 1.d4. Zur groben Einordnung mag genügen,
daß diese Systeme darauf verzichten, dem weißen Damenbauern auf
d4 den eigenen Damenbauern direkt entgegenzusetzen, sondern versuchen, mit
dem Zug 1… Sf6 Einfluß auf das Zentrum zu gewinnen (Diagramm
oben). Französisch, das heißt die
Französische Verteidigung, ist eines der Hauptsysteme von Schwarz
gegen 1.e4. Auch dieser Partieanfang wurde schon früh erwähnt,
erhielt seinen heutigen Namen aber erst Mitte des 19. Jahrhunderts nach
einer Fernpartie
zwischen Westminster und Paris. Das Philidor-Gambit schließlich ist
einmal mehr eine Variante des Königsgambits.
einem Vertreter der Schachschule
von Modena, der mit seinem Buch Il giuoco incomparabile degli
scacchi (1769) einen wichtigen Beitrag zur Schachtheorie seiner Zeit
leistete. Damenbauer gegen Königsbauer ist die in
älteren Auflagen des Lehrbuch des Schachspiels von Dufresne
und Mieses gebrauchte Umschreibung für die Skandinavische
Verteidigung; vgl. dazu oben die Anmerkung zu Dichtergespräche im Elysium. Mit
Indisch bezeichnen Schachspieler eine ganze Gruppe von
Eröffnungen gegen 1.d4. Zur groben Einordnung mag genügen,
daß diese Systeme darauf verzichten, dem weißen Damenbauern auf
d4 den eigenen Damenbauern direkt entgegenzusetzen, sondern versuchen, mit
dem Zug 1… Sf6 Einfluß auf das Zentrum zu gewinnen (Diagramm
oben). Französisch, das heißt die
Französische Verteidigung, ist eines der Hauptsysteme von Schwarz
gegen 1.e4. Auch dieser Partieanfang wurde schon früh erwähnt,
erhielt seinen heutigen Namen aber erst Mitte des 19. Jahrhunderts nach
einer Fernpartie
zwischen Westminster und Paris. Das Philidor-Gambit schließlich ist
einmal mehr eine Variante des Königsgambits.
- 2.) das verw(r)igglte MittelSpiel! um den BeSitz des scent=Trumms; (die Weiße, die Schwarze Dame!: oh ZeitNot & ZuckZwang!; (aber ›die einmal berührte Figur muß gezogn werdn!‹; [174]
-
Mittelspiel wird jene Partiephase genannt, die sich unmittelbar an die Eröffnung anschließt. Hat die Eröffnung das Ziel die Figuren aus der Grundstellung heraus zu entwickeln, den König durch die Rochade in eine sichere Position zu bringen und eventuell schon Schwächen in der gegnerischen Stellung zu provozieren, so wird im Mittelspiel versucht, über den Gegner einen positionellen oder materiellen Vorteil zu erlangen, oder auch, wenn es der Gegner erlaubt, ihn in einem Angriff matt zu setzen, bzw. im Gegenzug alle diese Schwächungen und den Partieverlust zu vermeiden. Während in der Eröffnung die Kenntnis der Theorie von entscheidender Bedeutung ist, dominieren im Mittelspiel strategische und taktische Kreativität und Phantasie. Das Mittelspiel ist jene Partiephase, die sich am wenigsten systematisieren läßt.
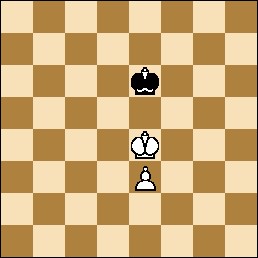
Zum Begriff des Zentrums vgl. oben die Anmerkung zu Das steinerne Herz, zur Zeitnot oben die Anmerkung zu Zettel’s Traum.
In Zugzwang befindet sich ein Spieler dann, wenn er seine Stellung durch jeden möglichen Zug zum Verlust verdirbt, während er in derselben Stellung nicht besiegt werden könnte, wäre er nicht am Zug. Die einfachste Zugzwangstellung zeigt das nebenstehende Diagramm: Befindet sich Schwarz in dieser Stellung am Zug, so verliert er, da Weiß gleichgültig, wie Schwarz spielt die Umwandlung des Bauern erzwingen kann. Wäre dagegen Weiß am Zug, so gäbe es keinen Weg zum Gewinn, da der schwarze König stets die Opposition der Könige erzwingen kann und so den Vormarsch von König und Bauern neutralisiert. Schwarz am Zug befindet sich daher hier in Zugzwang. Das Phänomen des Zugzwangs tritt allerdings weit häufiger im End- als im Mittelspiel auf. Nebenbei bemerkt: ‚Zugzwang‘ und ‚Zeitnot‘ sind aus dem Deutschen in andere Sprachen übernommen worden: Sowohl englische als auch französische und italienische Schachspieler sprechen vom ‚Zugzwang‘ oder ‚Zeitnot‘; die Amerikaner erlauben sich sogar, ein Verb aus dem Substantiv Zugzwang abzuleiten, wie der hübsche Buchtitel To Zugzwang the Zugzwanger zeigt.Daß die einmal berührte Figur gezogen werden muß, lernt der junge Schachspieler als eine der ersten Verhaltensregeln am Brett über die eigentlichen Bewegungen der Figuren hinaus, indem ihm jedesmal der Merksatz „Berührt, geführt!“ vorgesagt wird, wenn er wieder einmal unschlüssig zwischen den möglichen Zügen umherirrt und sich immer, wenn er sich gerade entschließen will, der Partie eine überraschende Wendung zu geben, ein neuer Aspekt und Gedanke zwischen den Plan und seine Verwirklichung schiebt. Alle Schachspieler neigen zur nachträglichen Idealisierung ihres Spiels: Man hätte nur an der und jener Stelle dies oder jenes spielen müssen, dann hätte man die Partie unmöglich verlieren können. Niemand denkt bei diesem Satz mit, daß dieser oder jener andere Zug ja mindestens ebensoviele Möglichkeiten geboten hätte, die Partie im weiteren Verlauf noch zu verderben, wie der tatsächlich geschehene. Und die Analyse post mortem ist ein sehr weites Feld. Um die phantastischen Möglichkeiten des Anderen wenigstens im Verlauf einer konkreten Partie im Zaum, das heißt in den Köpfen der Spieler zu halten, gilt eben jene alte Regel: „Berührt, geführt!“, oder wie es der Bergische Schachspieler kürzest auf den Punkt bringt: „Anjepackt!“
- 3.) das EndSpiel, (= am Ende spielen: dàs kann auch den GroßMastur zum SelbstMatt führin! – was ›Onan‹ wäre). / Denn=nun komm’ Ausdrükkungn, wie: ›die Dame macht den Könich matt‹! (= ist die stärkere Figur!) / ein ›Bauern=Opfer‹! / Jemandem einen Doppl=Bauern machn. / Ein lu/üstich ›erstikktis Matt‹; (durch’n geschikktn Springer herbeigeführt: ›unter dem Anschein größter Einfachheit lauern hier, Mitt=unter, die verstecktestin Feinheitn‹, MIESES=DUFRESNE. [174 f.]
-
Ins Endspiel geht eine Partie dann über, wenn das Material beider Seiten soweit abgetauscht ist, daß die beste Aussicht zum Gewinn der Partie in dem Versuch besteht, einen Bauer etwa in eine Dame umzuwandeln. Trotz reduziertem Material erweist sich das Endspiel nicht als minder komplex als das Mittelspiel oder die Eröffnung. Bei der Behandlung von Endspielen kommt es sehr häufig auf die sogenannte Technik an, also das Wissen, wie sich bestimmte Stellungstypen grundsätzlich gewinnen bzw. verteidigen lassen. Im Endspiel trennt sich endgültig die schachspielerische Spreu vom Weizen; niemand kann heute hoffen, in die Weltelite der Schachspieler aufzusteigen, der nicht über eine weit überdurchschnittliche Endspieltechnik verfügt.
Der Titel Großmeister für Schachspieler existiert seit dem Internationalen Turnier in St. Petersburg 1914. Für dieses Turnier hatte Zar Nikolaus II. die Schirmherrschaft übernommen und die bedeutende Summe von 1000 Rubeln zum Preisfonds beigesteuert. Das Turnier wurde vom Weltmeister Emanuel Lasker vor Raoul Capablanca, Alexander Aljechin, Siegbert Tarrasch und Frank Marshall gewonnen. Auf dem Abschlußbankett verlieh der Zar diesen fünf ersten Spielern offiziell den Titel ‚Großmeister des Schach‘, der sich seitdem für die Spieler der Weltelite gehalten hat. Heute verleiht die Weltschachorganisation FIDE drei Titel: den des ‚FIDE-Meister‘ (FM), den höheren des ‚Internationalen Meister‘ (IM) und als höchsten den des ‚Internationalen Großmeisters‘ (GM). Die Erlangung der Titel ist an genau definierte Bedingungen geknüpft, was allerdings nicht wirklich dazu geführt hat, die Titel vor inflationären Tendenzen zu bewahren. Aber auch heute noch gilt die Erlangung des Großmeister-Titels in jungen Jahren als bestes Indiz für ein hoffnungsvolles Talent.
Beim Selbstmatt handelt es sich um eine Variante des Märchenschachs, worunter man alle Schachprobleme zusammenfaßt, die mit einem erweiterten Figurensatz oder unter Variation der Regeln arbeiten. Bei Selbstmatt-Aufgaben zieht Weiß an und zwingt Schwarz, ihn in der geforderten Anzahl von Zügen matt zu setzen. Als Selbstmatt wird scherzhaft auch das Übersehen eines einzügen Matts bezeichnet.
Ausdrücke, wie: ›die Dame macht den König matt‹ kommen zumeist gar nicht vor, da es nicht ‚matt machen‘, sondern ‚matt setzen‘ heißt. Daß die Dame allerdings eine stärkere Figur als der König ist, gilt nicht nur fürs Endspiel, sondern für die ganze Partie schlechthin, ja im Endspiel eher weniger, da in ihm der König aufgrund der eingeschränkten Möglichkeiten, matt gesetzt zu werden, eher an Kraft gewinnt. Auch der Ausdruck Bauernopfer ist nicht für das Endspiel spezifisch, beruhen doch alle Gambits auf Bauernopfern in der Eröffnung. Ebenso ist der Ausdruck Doppelbauer nur indirekt mit dem Endspiel verbunden: Bei Doppelbauern handelt es sich um zwei Bauern, die auf der gleichen Linie stehen. Dies hat den offensichtlichen Nachteil, daß sie einander nicht decken können und daher beide der Unterstützung durch andere Figuren bedürfen. Oft erweist sich ein in der Eröffnung oder dem Mittelspiel entstandener Doppelbauer im Endspiel dann als die entscheidende Schwäche, dennoch ist die Einreihung des Wortes unter das Endspiel eher willkürlich. Das erstickte Matt ist ein besonderes taktisches Motiv, das auf der Eigenschaft des Springers beruht, seine Wirkung auch über andere Figuren hinweg ausüben zu können.
Der aus dem Lehrbuch von Dufresne und Mieses zitierte Satz findet sich dort in dem Abschnitt über die reinen Bauernendspiele, der ‚Bauern gegen Bauern‘ überschrieben ist (11. Aufl., 1926, S. 614). Die Ressentiments Schmidts gegenüber der Landbevölkerung gehören aber in einen anderen Kommentar.
- 4.) (?) –: Nu seh’n Se, jetz fängt’s Ihn’n selber an uffzuphall’n: auch beim ›blind=Spieln‹ weiß mann, daß man ›in 3 Zügn matt‹ sein werde. / ›Turnier‹: von ›Lanzn brechn‹. / Oder eine GroßMeisterin, die ›simultan‹ gegn 25 antritt – (der Traum jeder beginnenden Spielerin) – siegesgewiß von B(r)ett zu B(r)ett hüpft; 22 Mann ›matt‹ macht; (und selbst nur dreimal håucht: ›Ch geb åuf!‹ ...) [175]
-
Dies ist eigentlich nur der Vollständigkeit der Stelle halber zitiert; s(ch)achlich läßt sich hier kaum etwas anmerken. Zum Begriff simultan vgl. oben die Anmerkung zu Zettel’s Traum.
- FRAU DIREKTOR (munter & irden): »Mir iss – (Ich sag’s offm) – ›Musik‹ immer etwas entwertit erschien’n: durch die Mögl/Häufichkeit von ›WunderKindern‹. Musik & Schachspiel: meiner Erfahrung als Pädagogin nach, sind die grundsätzlich unzulänglich im Menschlich’n – da hilft der netteste Bakel nichts. –: ?«; (Sie sieht sich rundlichum: ? –) [245]
-
Eine weitere Abwertung des Schachspiels, wieder im Zusammenhang mit der Musik (vgl. oben die Stellen aus Schwarze Spiegel, Die Geschichte vom Riesen Jermak und Zettel’s Traum). Was hier als vorgebliches Urteil einer Pädagogin präsentiert wird, erweist sich bei näherer Überlegung als kaum mehr als ein Vorurteil. Das Phänomen der Wunderkinder ist natürlich nicht nur auf den Gebieten Schach und Musik existent: Auch in der Malerei und unter den Schriftstellern gibt es Beispiele dafür, daß bereits sehr früh das entsprechende Talent entdeckt wurde. Es könnte sein, daß die öffentliche Aufmerksamkeit bei außerordentlichen musikalischen oder schachlichen Begabungen größer ist, wodurch das Phänomen der Wunderkinder hier massiert aufzutreten scheint. Sollte die Bemerkung dahin zielen, daß die Wunderkinder gerade dieser Disziplinen grundsätzlich unzulänglich im Menschlichen bleiben, so kann ich mich der Beobachtung nicht erwehren, daß überhaupt sehr viele Menschen unzulänglich im Menschlichen bleiben und der Prozentsatz unter den Künstlern nicht höher oder niedriger zu sein scheint als unter allen anderen Menschen auch.
Die Schachwelt hat sich in den letzten Jahren mehr und mehr an das regelmäßige Auftauchen von sehr jungen Großmeistern gewöhnt. Das jüngste Beispiel: Der Ukrainer Sergej Karjakin, geboren am 12. Januar 1990, wurde im Alter von 12 Jahren und sieben Monaten Schachgroßmeister. Offensichtlich trägt der Einsatz von Computern für Spiel und Training dazu bei, die Talente immer früher und effektiver zu fördern, so daß diese heute deutlich schneller an Spielstärke gewinnen. Es ist zu erwarten, daß in Zukunft noch häufiger von sehr jungen Großmeistern zu hören sein wird.
Abend mit Goldrand
[1975; BA IV/3]
- ANN’EV’: »[…] Spielt Einer von Euch, daheim, etwa Schach? (Ja?): dann iss Uns geholfn. –« [23]
-
Diese kryptische Frage wird im weiteren Text, soweit ich sehe, nicht wieder aufgenommen. Offensichtlich nimmt das Geistwesen Ann’Ev’ an, daß ein Schachspieler eine offenere und verständigere Einstellung zur Gruppe der Weltflüchtlinge, die sie anführt, haben wird. Warum dies so sein sollte, wird nicht weiter erläutert. Eine Spekulation sei gewagt: Abend mit Goldrand ist das Werk, in dem Schmidt zu seinen eigenen Anfängen und zu seinem damals unveröffentlichten Frühwerk zurückkehrt, es wieder aufnimmt und erfolgreich in das Spätwerk einflicht. Mag sein, daß auch diese Stelle ein Reflex ist, der auf die damalige Hochschätzung des Schachs rekurriert und es wieder in seinen Status als künstliche Gegenwelt einsetzt. Einen Beleg für diese Lesart vermag ich aber nicht anzuführen.
- mit sich selber Schach spielen? Sie [d.i. Ann’Ev’] zieht das kleine SteckSchach zu sich her; legt d gekrümmt’n li ZeigeFinger ans Kinn – ? – langsam wird ihr re Arm lang, und das FingerBündelchen schwebt überm Brett – ? – spitzt sich zu? (zum Läufer auf f 1?) – und tut dann einen schwarzen Zug: – (ihren König, den König, zu schützen) [59]
-
Günter Jürgensmeier hat an diese Stelle die Spekulation geknüpft, daß Abend mit Goldrand die ‚Unsterbliche‘ von Anderssen und Kieseritzky als ein strukturierendes Element unter anderen zugrunde liege. Jürgensmeier selbst betont, daß sich diese Vermutung „auf schwache Indizien“ stütze. [Vgl. Günter Jürgensmeier: Verlarvte Arten der Mathematik. In: Bargfelder Bote, Lfg. 204–206 (März 1996). S. 21–45; bes. S. 40–42.] Der einzige konkrete Hinweis ist eben jener Läufer auf f1, mit dem sich aber wenigstens in der ‚Unsterblichen‘ kein schwarzer Zug ausführen läßt, weshalb Jürgensmeier das schwarz in ‚unglücklich‘ umdeuten muß. Auch ist gar nicht sicher, ob sich das dann im Text nicht schon auf den nächsten Zug bezieht. Das alles ist mehr als undeutlich und unsicher.
Mit sich selber Schach zu spielen ist allerdings eine Kunst, die nur ganz wenige wirklich beherrschen. Vgl. dazu oben die Anmerkung zu Die zehn Kammern des Blaubart.
Ihren König, den König, zu schützen ist natürlich nur indirekt eine Schachstelle. Direkt ist es eine Anspielung auf Heinrich Heines Ballade Die Grenadiere, die dem Protagonisten A&O wahrscheinlich deshalb in den Sinn kommt, weil es in ihr eine Verszeile zuvor heißt „dann steig ich gewaffnet hervor aus dem Grab –“, was sich sehr gut in die Lebens- und Gedankenwelt dieser Figur einpaßt.
- Was hab’ich sonst noch in L. profitiert? – Ahja: ›SchachSpieln‹ hab ich mir gelernt; wir hattn im Hause ein’n jungn ›Töpfer & Ofensetzer‹ wohn’n, Kurt Leubner – (der 1. einer (kurzn) Reihe ›Intelligenter Handwerker‹, die ich ›achtn‹ gelernt habe; (dh as far as it goes)) – Wir habm zusamm’m den ganzen ›MIESES=DUFRESNE‹ durchgearbeitet. –
-
Die Erinnerungen, die Schmidt hier seiner Figur Olmers zuschreibt, dürften weitgehend autobiographisch fundiert sein, wobei sich der genaue Anteil von Fiktion und Erinnerung derzeit nicht bestimmen läßt. Man könnte sich die Freiheit nehmen anzusetzen, daß auch Schmidt das Schachspiel in seiner Laubaner Zeit – das L. im Text steht für die schlesische Stadt Lauban, heute Luban –, also nach 1928 gelernt hat, wenn auch Olmers laut seiner Erinnerung schon 1919, aber in ungefähr demselben Alter wie Schmidt nach Lauban gekommen ist. Das Lehrbuch des Schachspiels von Dufresne und Miese als eine der Hauptquellen für Schmidts Schachwissen wurde ja inzwischen ausreichend oft erwähnt.
Julia, oder die Gemälde
[Fragment; Niederschrift 1979; BA IV/4]
- Moritz RETZSCH, ›Schachspieler‹ (geistvoll!) [31]
-
Das gemeinte Bild existiert in zahlreichen Varianten, die alle auf seitenverkehrte Stiche nach einer Bleistiftzeichnung von Retzsch zurückgehen. Das Motiv gehört in das weitere Umfeld der Retzschen Illustrationen zum Faust, die ihn über Deutschland hinaus bekannt machten. [Vgl. Barbara u. Hans Holländer: Schadows Schachclub. Ein Spiel der Vernunft in Berlin 1803–1850. Katalog zur Ausstellung, Berlin 5. Oktober bis 16. November 2003. Berlin: Staatliche Museen zu Berlin Stiftung Preußischer Kulturbesitz, 2003. S. 72.] Schmidt kannte das Bild von einer Reproduktion eines der Stiche im Pfennig-Magazin, Bd.5 (1837), S. 357. Dort findet sich auch ein Text, der in etwa dem Schmidtschen Epitheton geistvoll entspricht.
- Gleich befiehlt ihm sein ÜberIch, die danebmstehende Schachaufgabe zu lösen: !. – Er iss aber doch auch stark genug, das Blättchen, da drüber steht ›Weiß zieht und gewinnt‹, sofort wieder weg zu leg’n – wenn’s noch gelautet hätte ›Matt in 2 Zügn‹; aber so – nee! [67]
-
Gewöhnlich unterscheidet man zwischen Schachaufgaben und -studien: Während Schachaufgaben im engeren Sinne komplexe oder scheinbar einfache Stellungen sind, in denen Weiß am Zug ist und in einer geforderten Anzahl von Zügen matt setzt, präsentieren Studien Endspiel-Stellungen, die mit einer allgemein formulierten, oft auf den ersten Blick zum Charakter der Stellung scheinbar widersprüchlichen Stellungseinschätzung verbunden sind wie z. B. ›Weiß zieht und gewinnt‹. Warum der Studienrat Ekkehard Rauch, dem diese Gedanken zugeschrieben sind, Schachstudien nicht schätzt, verrät uns der Roman leider nicht.
Übergreifende Motive
Einige Leser Arno Schmidts werden doch vielleicht über die Menge des hier aufgelisteten Materials überrascht sein. Das Schachspiel bleibt sicherlich auch nach diesem Durchgang ein wenig relevantes Nebenmotiv, ist in der Textmasse aber ähnlich präsent wie etwa Schmidts Geschimpfe über Bauern oder Rechtsanwälte und dürfte in der Menge ungefähr den mathematischen Motiven und Bemerkungen die Waage halten. Wie sich beim chronologischen Durchgang durch die Einzelstellenkommentare zeigt, verändert sich Schmidts Einschätzung des Schachspiels zwischen den ‚Juvenilia‘ und dem Spätwerke deutlich: Während die Dichtergespräche im Elysium kommentarlos das Schachspiel in den Rang anderer Künste, besonders aber der Literatur zu erheben scheinen, sinkt es im Spätwerk zum wortlosen Künstlein (s.o.) herab; nur in Abend mit Goldrand, das ja überhaupt auch ein Buch der Rückwendung zu den eigenen Anfängen ist, könnte so sich so etwas wie eine Ehrenrettung des Schachspiels andeuten.
Insgesamt schälen sich wohl drei immer wiederkehrende schachliche Motive heraus, von denen zwei andeutend zu poetologischen Gedanken überleiten, ohne daß diese poetologischen Fragmente weiter ausgeführt würden:
-
Dasjenige Motiv, das sich konsequent durch das gesamt Werk zieht, eigentlich aber harmlos und wesentlich unvermittelt bleibt, ist das eheliche Schachspiel. Das Motiv scheint bei Schmidt eng mit seinem Bild vom Eheleben James Fenimore Coopers verbunden zu sein (vgl. Siebzehn sind zuviel!, Nachwort zu Coopers »Conanchet« und Eines Hähers »: Tué!). Wie wir aus dem Tagebuch Alice Schmidts wissen, spielten auch Schmidts gegeneinander Schach, wobei Alice kein adäquater Gegner ihres Mannes gewesen zu sein scheint. Inwieweit die Aufnahme häuslicher Partien in ein Tagebuch durch Coopers Berichte von Spielen gegen seine Frau angeregt wurde, wird sich schwerlich klären lassen.
Erst spät, in Zettel’s Traum und Die Schule der Atheisten, gibt Schmidt eine explizite Begründung dafür, warum ihm das eheliche Schach so wichtig erscheint: Es diene dem Aggressionsabbau zwischen den Ehepartnern. Wie so viele thetischen Sätze bei Schmidt bleibt auch dies unvermittelt, und es ist unklar, wie ernst man einen solchen Gedanken nehmen und wieweit man sich mit ihm ernsthaft auseinandersetzen sollte. Da eine solche Auseinandersetzung den hier gesetzten thematischen Rahmen sprengen würde, bleibt er dem Interpreten und den Rezipienten zum Glück erspart.

-
Das zweite wichtige Motiv, das in verschiedenen Brechungen aufscheint, ist das Schachspiel als Gegen- oder Fluchtwelt. In Dichter und ihre Gesellen werden die Spielregeln des Schachspiels als Lebensregeln bezeichnet, was sich natürlich vorerst einmal harmlos dahin deuten läßt, daß die Schachregeln dem ernsthaften Schachspieler eben auch einen Teil seiner Lebenszeit reglementieren. Beachtet man jedoch die Beifügung geisterhaft hochgezüchtet, so muß man Schmidt wohl doch einen tiefer reichenden Gedanken zugestehen.
Gegen- oder Fluchtwelten sind bei Schmidt durch das ganze Werk hindurch eines der zentralen Themen, ganz gleichgültig wie gewendet sie erscheinen: Von der angedeuteten unterirdischen Vorwelt der Insel und der Insel Felsenburg der Fremden über die IRAS der Gelehrtenrepublik und die Unterwelt der Tina bis zur Wolkeninsel in Abend mit Goldrand (die direkt aus den ‚Juvenilia‘ in dieses Spätwerk hineinschwebt) – pars pro toto – findet sich beinahe in jedem längeren Prosatext eine positive oder negative Parallel- oder Gegenwelt. Als die Gegen- und Fluchtwelt schlechthin aber erscheint die Literatur selbst, die ein Pendant zur ungeliebten und ungelebten Realität bildet: ›Wir‹?): Wir lebm hier einträchtich wie die Zoophyt’n: lesn gute Bücher; (eine BuchGestalt ist ja fast schon ein Beinah=Lebendes) […]. Merks: Wir sind doch keine Naturalistn!): »Nur die Phantasielosn flüchtn in die Realität; (und zerschellen dann, wie billich, daran.)« [BA IV/3, 188] Auch dem Schachspiel scheint wenigstens ein Teil dieser Zweitwelten stiftenden Kraft zugestanden zu werden, wenn dieser andere Weg [vgl. BA I/1, 54] später auch oft kleingeredet zu werden scheint (s.o.). Am deutlichsten ausgeführt findet sich dieser Gedanke nun leider nicht in einem eigenen Text von Arno Schmidt, sondern in einer seiner Übersetzungen. Jedoch hat Schmidt zum Glück eine Selbstrezension dieser Übersetzung geliefert, und so wissen wir, daß er diese Variation auf die Zweigsche Schachnovelle wenigstens für ein herausragendes Stück der Sammlung hielt (vgl. Die 10 Kammern des Blaubart).
An den nicht wirklich ausgeführten Gedanken vom Schachspiel als Fluchtwelt knüpft sich wahrscheinlich auch noch der poetologische Einfall, das Schachspiel könne dem Schriftsteller als handwerkliches Hilfsmittel nützlich sein: das ›SchachSpielen‹; dem viele Schriftsteller zugetan sind; (anschein’nd ohne es als Aufbau=, als KonstruktionsÜbung zu erKennan – !) (Die Schule der Atheisten) Auch dies bleibt im Einfall stecken, ohne weiter ausgeführt zu werden. Natürlich läßt sich spekulieren, hier sei gemeint, daß der Autor seine Romanfiguren ähnlich miteinander interagieren läßt wie der Schachspieler seine Schachfiguren: Sie erscheinen gelenkt von einem fremden Willen, der versucht, die verschiedenen Kräfte der Figuren zu einem Gesamtbild zusammenwirken zu lassen, um einen bestimmten Endzustand zu erreichen. Sowohl die charakterliche Identität als auch die letztliche Abhängigkeit der Figuren von einem über sie waltenden Geschick fänden in diesem Bild ihre schöne Entsprechung. Selbst das Gegenspiel des schachlichen Opponenten könnte als Widerständigkeit des Stoffes gegen seine Formung begriffen werden. Doch muß all das Spekulation bleiben, da Schmidt auch diesen Einfall unvermittelt stehen läßt.
-
Am auffälligsten und originellsten von allen schachlichen Motiven bei Schmidt ist aber wahrscheinlich das Bild von der ‚halbierten Schachpartie‘, also einer Partie von der nur die weißen, respektive die schwarzen Züge mitgeteilt werden und die Figuren so gegen unsichtbare Kräfte und Zwänge anzukämpfen scheinen. Das Motiv wird in den Dichtergesprächen im Elysium als Rätsel-Aufgabe geboren, als ein fiktiver Wettkampf zwischen Paul Morphy und Edgar Allan Poe; zu dieser konkretesten Variante des Motivs ist im Einzelstellenkommentar das nötige gesagt worden, das hier nicht wiederholt werden muß.
Als Gleichnis taucht das Motiv zum ersten Mal 1955 in den Berechnungen II auf. Schmidt beschreibt mit diesem Bild das, was er ein halbiertes LG [= Längeres Gedankenspiel; vgl. BA III/3, 277] nennt. Dem liegt der Gedanke zugrunde, daß sich eine bestimmte Sorte von Literatur dadurch aufschlüsseln lasse, daß man mit der Fiktion die zugehörige Realitätsebene im Leben des Autors parallelisiere. Der fiktionale Text wird auf diese Weise als eine Hälfte einer imaginierten Totalität von Welt und Literatur, doch liefert er eben nur die eine Seite dieses Spiels: Nur die weißen respektive schwarzen Züge. Interessant an diesem Gedanken ist, daß er im Grunde ein mechanistisches Modell der Literaturentstehung widerspiegelt: Wirklichkeit und Fiktion hängen über ein strenges, sie vermittelndes Regelwerk miteinander zusammen, wobei eine Seite immer nur soviele Freiheiten aufweist, wie die andere Seite zugesteht. Das räumt aber auch zugleich die Möglichkeit ein, daß die Fiktion auf die Wirklichkeit zurück wirkt, was ihr – streng genommen – nur dann gelingen kann, wenn diese Wirklichkeit selbst eine Fiktion ist. In seinem Roman Kaff auch Mare Crisium wird dieses komplexe Modell von fiktiver Wirklichkeit und überbauender Fiktion schließlich in die Schreibpraxis umgesetzt.
Nachdem Schmidt das Motiv 1957 gleich in zwei Texten und beides Mal im Zusammehang mit Goethe verwendet (vgl. Goethe und einer seiner Bewunderer und Literatur: Tradition oder Experiment?), taucht es erst sechs Jahre später noch ein letztes Mal auf, allerdings offenbar inzwischen zu einer Phrase verschliffen: In Unsterblichkeit für Amateure rät Schmidt jedem Menschen, als reine Scharfsinnsübung zu versuchen, diese Aufgabe von einstmals ungeheuerlicher Schwierigkeit zu lösen.
Schließlich möchte ich keinem, der bis hierhin vorgedrungen ist, einen Reflex vorenthalten, den dieses Motiv bei einem jüngeren deutschen Autor ausgelöst hat. Im dem Roman Dehli von Marcus Braun (Berlin: Berlin Verlag, 1999) findet sich neben vielen anderen Anspielungen, die deutlich machen, daß Marcus Braun unter anderem ein Kenner des Werks von Arno Schmidt ist, auch folgende Passage (S. 168 f.):
Der Fluginsektenforscher erzählte, er sei ein großer Liebhaber des Schachspiels und außerdem – dies sei eine Folge seiner Beschäftigung mit den Naturwissenschaften – erstelle er Schachaufgaben. Allerdings nicht im herkömmlichen Sinne. Seine Methode bestehe darin, nur die Züge des einen Spielers mitzuteilen, und das bis zum Ende einer Partie; die mutmaßlichen Züge des anderen seien sinnvoll zu ergänzen.
Eine noch schwierigere, von vielen aber auch für einfacher gehaltene Aufgabe wäre so formuliert: Von einem Schachbrett denke man sich die Hälfte weg; zum Beispiel die schwarzen oder die weißen Felder oder die Reihe 1–4 oder a–d, egal; die unsichtbaren Stellungen und Bewegungen seien zu ergänzen.
»Goester, was halten Sie für schwieriger?«
In Wirklichkeit existierten diese Aufgaben nicht, es handelte sich bloß um Ideen des Fluginsektenforschers, von denen er gern sprach, aber nichts verstand.