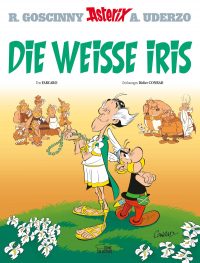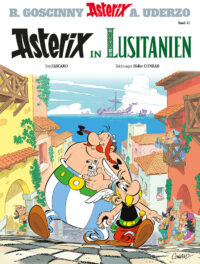
Pünktlich nach zwei Jahren legt die holzverarbeitende Industrie den nächsten Asterix-Band vor. Es handelt sich um ein weiteres, seriell produziertes Produkt der Reihe nach dem Strickmuster, wie es auch in früheren Bänden „Asterix in …“ schon verwendet wurde. Der Anlass ist diesmal noch nebensächlicher als sonst: Einer der portugiesischen Gastarbeiter aus „Die Trabantenstadt“ kommt mit dem Händler Epidemais („Asterix als Gladiator“) zum gallischen Dorf, um die Gallier um Hilfe zu bitten. Sein Freund ist lokaler Garum-Hersteller, dessen Produkt Cäsars bevorzugte Marke ist. Nun will ihn ein industrieller Garum-Produzent aus dem Geschäft drängen und nutzte seine Verwandtschaft mit dem Präfekten Olisipos (Lissabons), um ihn unter dem Verdacht verhaften zu lassen, er habe mit seinem Garum versucht, Cäsar zu vergiften. Asterix und Obelix sollen ihn aus dem Gefängnis befreien.
Um den Band zu füllen, wird das nicht nach dem beliebten Muster „Wir gehen da rein und schlagen alles kurz und klein“ gelöst, sondern es wird eine recht gekünstelte Detektiv-Handlung konstruiert, um die Unschuld des Verhafteten zu beweisen. Die meisten auf dem Weg benutzten Motive sind altbekannt: Obelix als schüchterner Verliebter, ein wenig Satire – diesmal gegen Konzerne und die Wohlhabenden –, ein lustiger Dialekt der Portugiesen, ein Prominenter zur Wiedererkennung – warum ausgerechnet Silvio Berlusconi als Industrieller herhalten muss, bleibt eher unerfindlich –, natürlich verprügelte Römer und Piraten – der Schwarze im Ausguck spricht jetzt politisch korrekt! – und inzwischen wirklich einmal zu oft Cäsar als Deus ex calamo. Noch ein oder zwei Bände und die Fabel wird von der KI besser erfunden werden als von Fabcaro.
Da capo al fine!
Fabcaro / Didier Conrad: Asterix in Lusitanien. Asterix Bd. 41. Aus dem Französischen von Klaus Jöken. Berlin: Egmont Ehapa, 2025. Bedruckter Pappband, Fadenheftung, 48 Seiten (28,8 × 22,4 cm). 13,50 €.