Sogar die dem Menschen unmittelbar nahegehenden Fragen wie die edle Einfachheit Griechenlands oder der Sinn der Propheten lösten sich, wenn man mit Kennern sprach, in eine unüberblickbare Vielfältigkeit von Zweifeln und Möglichkeiten auf.
Robert Musil
Anatol Stefanowitsch ist mit seinem Bremer Sprachblog einer der bekanntesten Blogger der Republik; er hat Anglistik studiert und ist heute Professor für Sprachwissenschaft am Institut für Englische Philologie der FU Berlin. In der Reihe von kleinen Büchlein der Duden-Redaktion ist gerade ein Statement von ihm zur Frage der Political Correctness erschienen, das gleich im Titel die Frage benennt, mit der sich Stefanowitsch auseinandersetzen will. Nun sind moralische Fragen in aller Regel von einer Komplexität, die nicht nur widerstreitende Antworten auf ein und die selbe Frage erlaubt, sondern seit deutlich mehr als 2500 Jahren in Theologie und Philosophie ganze Scharen von Theorien und Theorie-Ansätzen geliefert hat. Es ist daher etwas merkwürdig, dass im 21. Jahrhundert ein wissenschaftlich gebildeter Mensch versucht, auf eine moralische Frage auf weniger als 60 kleinen Seiten eine Antwort zu geben.
Dass es mit dem ethischen Wissen von Anatol Stefanowitsch nicht sehr weit her ist, findet sich auf Seite 23:
Fast jede praktische Moralphilosophie von Konfuzius bis Kant beruht mehr oder weniger direkt auf der sogenannten goldenen Regel. Als Sprachwissenschaftler und moralphilosophischer Außenseiter werde ich diesen Vorbildern folgen und es ebenso halten.
Zu Konfuzius kann ich nichts sagen, aber Kants Kategorischer Imperativ beruht weder mehr noch weniger auf der sogenannten Goldenen Regel (groß geschrieben, weil die Regel nicht goldfarben, sondern ‚Goldene Regel‘ ein Eigenname ist). Wer das Gegenteil glaubt, kennt den Kategorischen Imperativ, wenn überhaupt, nur als isolierten Satz, nicht aber seine Position innerhalb der Kantischen Ethik. Ist aber alles nicht schlimm, da im weiteren weder Konfuzius noch Kant irgendeine Rolle spielen, sondern Stefanowitsch sie ausschließlich dazu gebraucht, seiner Version der Goldenen Regel Autorität zu verleihen; und das hat sie auch dringend nötig.
Stefanowitsch erkennt rasch, dass mit der Goldenen Regel („Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem andern zu“; im folgenden GR) allein kein Land zu gewinnen ist. Doch zuerst einmal stellt er fest, dass sich die GR positiv oder negativ formulieren lässt. Positive Fassungen der GR können zu Schwierigkeiten führen: Ich erinnere mich an eine Zeichnung von F. K. Waechter, die einen Mann zeigt, der auf die Kacheln eines Badezimmers eine exotische Strandlandschaft malt, während an der Tür des Bads heftig geklopft wird. Auf einem Schild im Bad liest man: „Bitte verlassen Sie das Badezimmer so, wie Sie es vorzufinden wünschen!“ Auch Stefanowitsch hegt Bedenken gegen die positive Formulierung der GR und hält die negative Formulierung für „robuster“, was wohl „weniger anfällig für gewollte und ungewollte Missverständnisse“ bedeuten soll. Seine spezifisch für sprachliche moralische Probleme formulierte GR lautet also:
Stelle andere sprachlich nicht so dar, wie du nicht wollen würdest, dass man dich an ihrer Stelle darstellt. [Auch in diesem Buch herrscht die Unsitte, vorgeblich wichtige Passagen durch halbfetten Druck herauszuheben, als könne der Leser nicht selbst entscheiden, was er für bedeutend hält.]
Nun versteht auch Stefanowitsch, dass diese Regel nicht viel taugt, wenn man sie nicht um weitere Vorschriften ergänzt, was denn einer wollen darf, und wie einer an die Stelle eines anderen kommt. Er versucht diese Probleme anekdotisch zu lösen, was naturgemäß zu kurz greift. Das eine Problem ist, dass sich der Anwender der GR mit dem jeweiligen Gegenüber identifizieren muss, damit die Anwendung nicht fehl geht. Gelingt diese Identifikation nicht („Schimpansen sind von grundsätzlich anderer Art, also kann ich gar nicht in die Lage kommen, an ihrer Stelle zu sein. Von daher ist ihre Benutzung für pharmazeutische Experimente völlig in Ordnung und kein moralisches Problem.“), scheitert die Anwendung der GR. Dies Problem der Empathie ist nicht einfach zu lösen, da etwa der Rassist gerade deshalb Rassist ist, weil er sich mit der von ihm verachteten Gruppe von Menschen nicht identifiziert. Wie der Dichter schreibt:
Den Neger? Nein, den haß’ ich nicht,
den dummen schwarzen Mohr.
Ich haß’ doch keinen Stinkemann,
wie komm’ ich mir da vor?
Das andere Problem liegt offenbar darin, wie ich jemandem vorschreibe, was er wollen darf bzw. wollen soll. Die bewährtesten Methoden, die wir dafür kennen, sind Zivilisation, Erziehung und Gruppenzwang; allen dreien haben wir im 20. Jahrhundert bei ihrem grandiosen Versagen in Sachen der Moral zuschauen dürfen. Es steht daher zu befürchten, dass die GR das eigentliche Problem der Begründung moralischen Verhaltens nur um eine Drehung der dialektischen Schraube verschiebt, und wir uns, sobald wir ernsthaft versuchen, sie anzuwenden, erst vor die eigentlichen Probleme gestellt sehen.
Lassen wir also das Problem der Identifikation moralischen Handelns bei Stefanowitsch auf sich beruhen, denn wir können uns auch ohne die GR darauf einigen, dass es unerwünscht ist, andere Menschen zu beleidigen und in ihren Gefühlen zu verletzen. Auch können wir einer allgemeinen Regel zustimmen, dass eine ethnische Gruppe selbst bestimmt, wie sie genannt werden möchte, und dass es Bezeichnungen für ethnische Gruppen gibt, deren Bedeutung aus der Geschichte des Umgangs mit dieser Gruppe mit deren Herabsetzung fest verbunden ist. Ich selbst bin ein halber „Spaghettifresser“ und weiß wenigstens annähernd, was das bedeutet. Es lässt sich unter den Wohlgesinnten darüber leicht Einigkeit erzielen; die anderen erreicht man leider weder durch Appelle an ihre Menschlichkeit noch durch Mahnung an die GR.
Und genau hier haben wir einen Punkt, der leider bei Stefanowitsch nicht vorkommt: Es kann wohl bei der Betrachtung der meisten Kulturen festgestellt werden, dass sie eine mehr oder weniger ausgeprägte Tendenz haben, sich gegen andere Gruppe abzugrenzen. Dies geschieht wohl in den meisten Fällen auch sprachlich: Für die Chinesen sind Europäer Langnasen und ob die nordamerikanische Urbevölkerung wirklich von uns als „Bleichgesichtern“ gesprochen hat, möchte ich ohne neutrale Belege lieber nicht behaupten. Ich bin ganz sicher, dass Deutsche nicht nur Krauts und Schweinefresser sind, sondern sie weltweit unter zahlreichen anderen farbigen Ausdrücken geführt werden. Weiße US-Amerikaner sind fett und dumm, Mexikaner faul und illegal eingereist … na, ich höre mal auf, bevor ich noch Ärger bekomme. Die Abgrenzung der eigenen Gruppe und die Verächtlichmachung anderer ist offensichtlich ein weltweites und durch die Geschichte konstantes Phänomen. Hier wäre, bevor man versucht, dies Phänomen als ein moralisches Problem zu behandeln, ethnologisch und psychologisch zu prüfen, ob es sich dabei nicht um ein notwendiges und unter gewissen Aspekten evolutionär nützliches Verhalten der Spezies Homo sapiens handelt. Dies öffnet ein weites Feld der Forschung, die dann von anderen Wissenschaftlern erfolgreich ignoriert werden kann.
Neben der von einer Lösung weit entfernten moralischen Frage sind da noch zumindest eine historische und eine ästhetische, die sich nicht nur untereinander, sondern auch mit der moralischen überschneiden. Was etwa ist mit Kants Ansichten über die Neger?
§. 2.
Einige Merkwürdigkeiten von der schwarzen Farbe der Menschen.1. Die Neger werden weiß geboren außer ihren Zeugungsgliedern und einem Ringe um den Nabel, die schwarz sind. Von diesen Theilen aus zieht sich die Schwärze im ersten Monate über den ganzen Körper.
2. Wenn ein Neger sich verbrennt, so wird die Stelle weiß. Auch lange anhaltende Krankheiten machen die Neger ziemlich weiß; aber ein solcher durch Krankheit weiß gewordener Körper wird nach dem Tode noch viel schwärzer, als er es ehedeß war.
3. Die Europäer, die in dem heißen Erdgürtel wohnen, werden nach vielen Generationen nicht Neger, sondern behalten ihre europäische Gestalt und Farbe. Die Portugiesen am Capo Verde, die in 200 Jahren in Neger verwandelt sein sollen, sind Mulatten.
4. Die Neger, wenn sie sich nur nicht mit weißfarbigen Menschen vermischen, bleiben selbst in Virginien durch viele Generationen Neger.
Niemand kann einen oder zahlreiche Menschen auf der Welt daran hindern, sich durch diese Darstellung von Afrikanern zu Recht beleidigt und verletzt zu fühlen. Was sollen wir nun tun? Kants Schriften an allen Stellen, an denen das N-Wort und wahrscheinlich noch zahlreiche andere Wörter zu finden sind, ändern und damit einen historischen Stand des ethnischen Vorurteils auslöschen? Oder die entsprechenden Schriften in den bibliothekarischen Giftschrank sperren und nur noch bei berechtigtem Forschungsinteresse herausgeben? Und was geschieht mit all den Tausenden von Kopien in privaten Bücherschränken? (Nun gut, die liest keiner, aber immerhin …) Und was ist mit wirklichen Rassisten?
Diejenigen Menschen aber, die ihre Ich-Wesenheit zu wenig entwickelt hatten, die den Sonneneinwirkungen zu sehr ausgesetzt waren, sie waren wie Pflanzen: Sie setzten unter ihrer Haut zu viele kohlenstoffartige Bestandteile ab und wurden schwarz. Daher sind die Neger schwarz.
Hieße das Umschreiben solcher Schriften nicht, einen Dummkopf wie Rudolf Steiner und das gesamte Ausmaß seiner Blödheit zu verharmlosen? Und wie ist es hier um unsere wissenschaftliche Pflicht zur Wahrhaftigkeit bestellt? Wer soll und wie diese beiden Güter gegeneinander abwägen?
Und was ist mit dem Neger bei Kafka, der noch dazu aus der Zeitung zitiert ist? Und was mit all den Negern, auf die gereimt wurde:
»Wenn Sie ein Dichter sind, bin ich ein Neger.«
Das alles sagte ich dem Herrn Verleger.
Muss jetzt die deutsche Literatur großräumig durchforstet und umgeschrieben werden? All diese Probleme tauchen bei Stefanowitsch nur ganz am Rande an den Beispielen von Ottfried Preußlers „Die kleine Hexe“ (Negerlein wurden vom Autor zu Messerwerfern geändert) und Astrid Lindgrens „Pippi Langstrumpf“ (Negerkönig wird durch Eingriff des Verlags zu Südseekönig) behandelt, bei denen sich leicht mit der Schulter zucken lässt. (Nun gut, andere zucken bei Kant mit der Schulter, als ob es bei dem alten Zausel drauf ankäme, ob da nun Neger steht oder nicht.) Aber gelöst sind alle diese Probleme, die sich ebenso um die Frage der Wahrhaftigkeit drehen wie die Frage nach politisch korrekter Sprache, nicht; nicht einmal ernsthaft in Erwägung gezogen.
Wenn wir über Moral und Wahrhaftigkeit sprechen, wie Stefanowitsch das tut, dann müssen wir es auch moralisch und wahrhaftig tun. Und das beginnt wahrscheinlich mit dem Eingeständnis, dass man auf 63 kleinen Seiten die Komplexität des gesamten Feldes nicht einmal ankratzen kann. Anatol Stefanowitsch ist herzlich und aufrichtig zuzustimmen, dass man all diejenigen, die anders genannt werden wollen, unbedingt und jederzeit so nennen soll, wie sie sich das wünschen. Niemand soll beleidigt und verletzt werden, wenn es sich irgend vermeiden lässt. Aber wir wollen auch nicht die Geschichte unserer und der meisten anderen Kulturen umschreiben, weil eine bestimmte ethnische Gruppe berechtigte Einwände gegen ihre Darstellung in dieser Geschichte vorbringen kann. Hier setzten die Verpflichtungen der Erziehung, der Zivilisation und des Gruppenzwangs ein, zu denen ja oben schon eine grundsätzliche Einschätzung abgegeben wurde.
In guter Absicht leider reichlich zu kurz gesprungen.
Anatol Stefanowitsch: Eine Frage der Moral. Warum wir politisch korrekte Sprache brauchen. Berlin: Dudenverlag, 2018. Broschur, 63 Seiten. 8,– €.
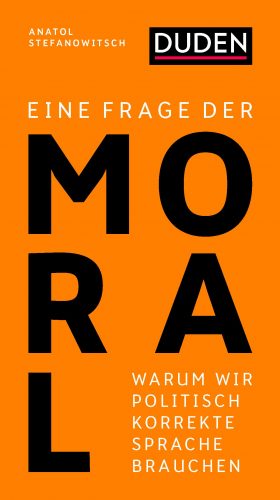
Verehrter Bonaventura,
wer anderen am Rechtschreib-Zeug flickt,
muss drauf achten, dass er selbst fleckenlos rumläuft, also bitte diesen Satz korrigieren:
„Was du nicht willst, das man dir tu, das für auch keinem andern zu“.
Ihre Kritik an der Fettschreibung eines Satzes find ich kleinkariert.
Der Autor wollte doch nicht sagen, dass dieser Satz dem BONAVENTURA wichtig ist oder wichtig sein muss, sondern dass er zunächst mal dem AUTOR wichtig ist………..
Also, bitte Ihren Text an mindestens zwei Stellen korrigieren! :: -) Der böse Veit F. :-))
Also, wie es in den Wald ruft: Ich weiß nicht, was Sie lesen, aber der von Ihnen angekreidete Fehler war schon 3½ Stunden vor Ihrem Kommentar korrigiert. Und es ist nicht ein Satz halbfett ausgezeichnet, sondern auf jeder Seite mindestens einer. Daher auch der Plural „Passagen“. Diese Bevormundung ist eine der Reihe, nicht des Autors, wie Sie hier nachlesen können, wenn Sie wollen: http://www.bonaventura.blog/2018/warum-es-angeblich-nicht-egal-ist-wie-wir-schreiben/ Daher die Formulierung „Auch in diesem Buch“. Ich hoffe, ich habe den Ton getroffen.
Inwiefern handelt es sich denn bei der Goldenen Regel um einen Eigennamen?
Die Begründung der Großschreibung damit, dass die Regel nicht goldfarben ist, erscheint mir unsinnig. Beim Schwarzen Brett oder der (metaphorischen) Gelben Karte spielt die tatsächliche Farbe ja auch keine Rolle, und man könnte die Adjektive jeweils kleinschreiben, oder?
Das ist eine ausgezeichnete Frage, die wahrscheinlich Herr Stefanowitsch weit besser beantworten kann als ich. Tatsache ist, dass , soweit ich sehe, der überwiegende Teil der Literatur (populär und wissenschaftlich) „die Goldene Regel“ schreibt, die Bezeichnung also als Eigennamen für den bezeichneten Satz benutzt. Warum dies etwa mit „der kategorische Imperativ“ nicht in der gleichen Breite geschieht (hier und da findet man auch in diesem Fall schon ein großes k), weiß ich schlicht nicht; es wird wohl historische Gründe haben. Ich selbst habe mich bei meiner Formulierung schlicht an meinem Sprachgefühl orientiert, was ja nichts anderes ist als der ins Unbewusste sedimentierte Gebrauch. Erst die Nachfrage hat mich stutzen lassen; und das Stutzen hat bislang auch noch nicht aufgehört.
Sehr geehrter Bonaventura!
Zunächst einmal danke für den äußerst analytischen und sehr präzisen Kommentar zum Büchlein von Herrn Stefanowitsch – als studierter Philosoph mit Schwerpunkt „Ethik“ teile ich Ihre Kritik.
Ich bin über Umwege (Blog: Sprachlog – „Frauen natürlich ausgenommen“ – des Verfassers // diverse Wikipedia-Einträge) auf Sie gestoßen.
Was die Frage nach der Großschreibung von „die Goldene Regel“ und der Kleinschreibung von „der kategorische Imperativ“ betrifft:
Bei der „Goldenen Regel“ handelt es sich wohl um einen „Eigennamen“, weshalb „Golden“ hier groß geschrieben wird.
Es geht eben nicht, wie Sie selbst ausgeführt haben, um die „goldene Regel“, wo es doch auch noch die „grüne“, „rote“ und „blaue Regel“ gibt.
Beim „kategorischen Imperativ“ (z.B. „Du darfst kein falsches Versprechen abgeben.“) verhält es sich – m.E. – deshalb anders, weil es Kant darum geht, diesen von einer anderen Art des Imperativs zu unterscheiden, nämlich vom „hypothetischen Imperativ“ (z.B. „Wenn du ein guter Pianist werden willst, musst du jeden Tag üben.“).
Außerdem wird die mit kleinem „k“ geschriebene Form „der kategorische Imperativ“ der Intention Kants, ein Argument mit reiner Vernunft zu analysieren, wohl am ehesten gerecht.
Wenn man den „Kategorischen Imperativ“ mit großem „K“ schreiben würden, würde man ihn zu einem magischen Begriff erheben – und das verträgt sich mit Kants Intention wohl eher nicht.
😉
PS: Davon abgesehen schreibt der Philosoph den „kategorischen Imperativ“ in seinen Werken selbst mit kleinem „k“.
„Goldene Regel“ (oder auch „goldene Regel“) ist ein idiomatischer Ausdruck mit terminologischem Charakter und eben kein Eigenname. Daher darf das Adjektiv groß- oder kleingeschrieben werden. Es wird ja mit dem Begriff keine einzelne unveränderliche Sache beschrieben, sondern er kann ganz unterschiedliche Regeln bezeichnen. Ob im Sprachgebrauch auch andersfarbige Regeln eine Rolle spielen ist dabei meiner Meinung nach unerheblich.