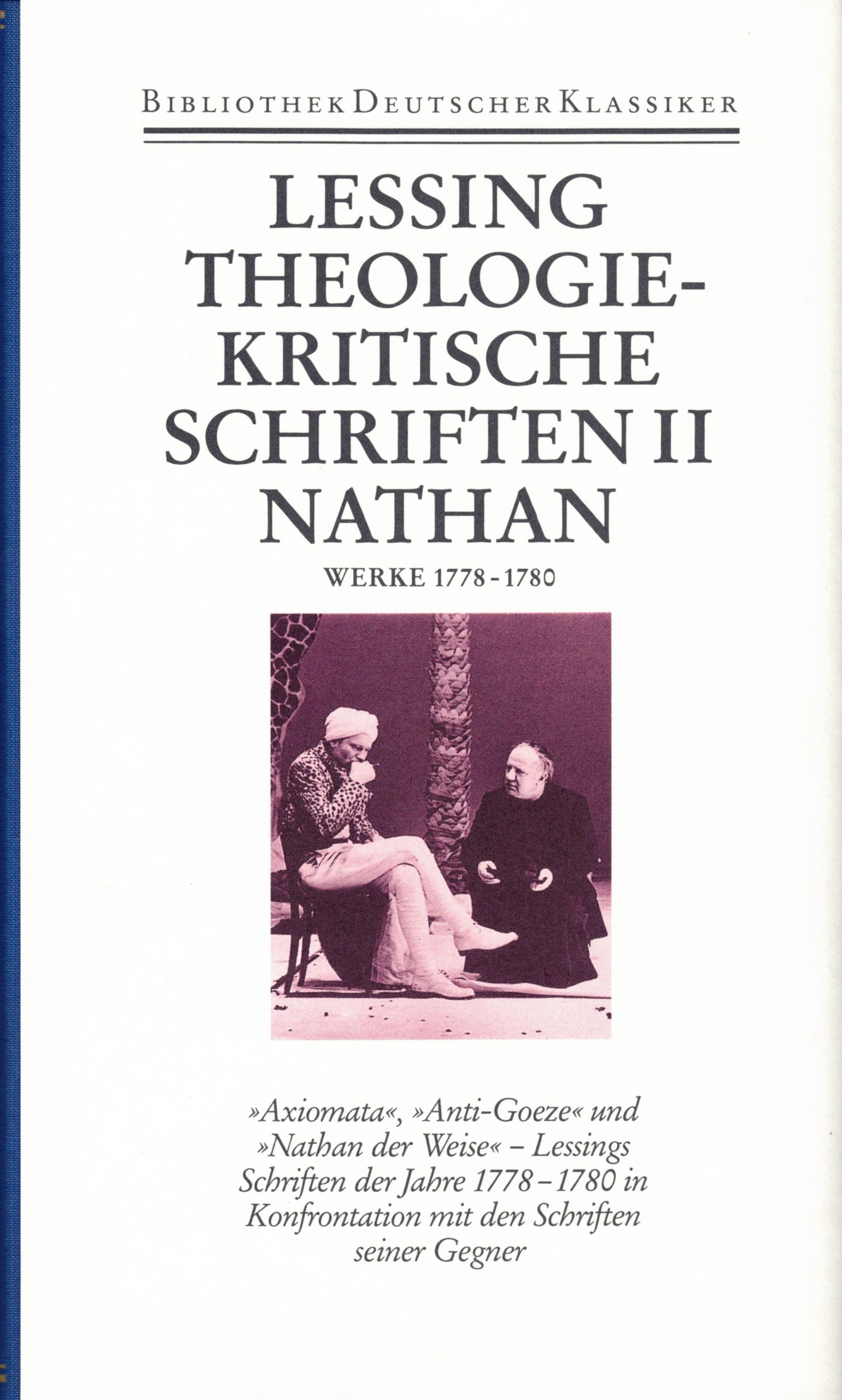Es sind [/] Nicht alle frei, die ihrer Ketten spotten.
Ich kehre immer wieder staunend zu Lessing zurück. Der Nathan war direkt nach dem Goetheschen Werther einer meiner Initiationstexte für das, was ich später „Klassiker“ zu nennen gelernt habe. Das frühe „Potztausend!“ (Friedrich Schlegel) differenzierte sich während des Studiums ein wenig aus, und über die Jahre hin habe ich immer und immer wieder die eine und andere Inszenierung auf der Bühne angeschaut (zuletzt eine, die nicht nur nicht lustig, sondern auch gänzlich ohne Witz war), stets in der Hoffnung, es würde sich eine oder einer an dem Text bewähren; das Beste, was ich zu sehen bekam, war ein Bühnenbild. Aber ich gebe zu: Es ist sehr schwierig, dem Stück gerecht zu werden.
Die Schwierigkeiten beginnen schon auf dem Titelblatt: Obwohl der Nathan offenbar eine Komödie (in Lessings Deutsch ein „Lustspiel“) darstellt und als solche inszeniert werden muss, merkte Lessing wohl, dass es mit dieser Einordnung nicht so einfach gehen dürfte. Zu ernst sind die verhandelten Probleme, zu wenig komisch die Dialoge, zu gesucht und künstlich (und fragil, aber dazu später) das Komödienende, selbst wenn die Inszenierung Lessings mühevolle Vorbereitungen dazu nicht kürzen sollte; und kürzen muss sie irgendwo (wenn auch nicht gleich auf 100 Minuten, wie zuletzt), wenn sie in den dem heutigen Publikum zumutbaren Grenzen bleiben will. Als Warnschild stellt Lessing deshalb die Gattungsbezeichnung „Ein dramatisches Gedicht“ voran, als zweifle er selbst daran, dass er ein Schauspiel für die Bühne geschrieben habe.
Als nächstes haben wir höchst anspruchsvolle Charaktere: Außer der Titelfigur ist keiner ohne Fehl und Tadel, alle hegen Vorurteile, handeln rasch und unüberlegt, lassen sich von Einfällen und Leidenschaften hinreißen. Am schlimmsten ist vielleicht die Figur des Patriarchen von Jerusalem, ein Fanatiker („Tut nichts! der Jude wird verbrannt.“ IV/2, V. 168 u. ö.), der überhaupt nur einmal leibhaftig auftritt, aber als Damoklesschwert das Schicksal Nathans und Rechas bedroht. Man denke: Das Oberhaupt der Christenheit in Jerusalem als der heimliche Bösewicht des Stücks und dagegen ein Muselman (wenn der auch erst noch ein wenig geläutert werden muss) und ein Jude als Repräsentanten einer vernunftbestimmten Humanität. Und auch sonst ist fast alles Vorurteil, Intrige und Vorteilsnahme; es ist ein Wunder, dass das Stück überhaupt zu seinem versöhnlichen Ende kommt.
Und dieses Ende ist nicht leicht zu glauben: Statt des einen Geschwisterpaars (Saladin und Sittah) stehen nun plötzlich deren zwei (Recha und der Tempelherr) auf der Bühne und sollen zudem auch noch untereinander miteinander verwandt sein als Onkel und Tante und Neffe und Nichte. Und der in Liebe entflammte Tempelherr wird von jetzt auf gleich ein liebevoller Bruder, und die Familienbande überlagern alle religiösen Konflikte, die doch gar nicht gelöst wurden. Und am ärgsten: Die neu gewonnene Harmonie schließt Nathan gar nicht ein, der zwar als Stifter der Familienbande glänzt, aber im gegenseitigen Erkennen ganz außen vor bleibt. Wenn’s denn bedeuten soll, dass alle Menschen und immer schon heimlich Brüder und Schwestern einander sind und waren und die Religionen nur die Tünche über den wirklich bedeutenden Verbindungen, warum bleibt dann gerade der weise Jude außen vor? (Ich sehe es vom Dramaturgischen her schon ein: Das Ende ist auch so schon unwahrscheinlich genug, aber dennoch …).
Und vom Fragmenten-Streit, der zu alle dem den fernen Hintergrund bildet, haben wir da noch gar nicht geredet.
So bleibt das Stück ein Meisterwerk an Sprache und Gehalt, doch wacklig konstruiert, und sein Weg am dramaturgischen Abgrund entlang verlangt ein sorgsam bedachtes und in jeder Einzelheit beherrschtes Spiel. Dieser Anspruch geht offenbar über das hinaus, was heutiges Theater will und kann. Daher habe ich eine politische Inszenierung nach der anderen gesehen, die von Text und Absicht des Stückes einfach nicht getragen wurden, habe Kürzungen erlebt, die das Ende ganz zuschanden machten. Da saß dann ein ahnungsloses Publikum und lachte Lessing aus statt jener, die für das Scheitern verantwortlich waren und es am Ende wohl auch gewollt haben. Mag sein, Lessing ist tatsächlich nicht mehr für unsere Zeit, doch das sagt nichts Gutes über unsere Zeit.
Gotthold Ephraim Lessing: Nathan der Weise. Ein dramatisches Gedicht in fünf Aufzügen. In: Derselbe: Werke und Briefe. Bd. 9: Werke 1778–1780, S. 483–627. Frankfurt/M.: Deutscher Klassiker Verlag, 1993. Leinen, Fadenheftung, Lesebändchen. 1383 Seiten. Nicht mehr im Druck.