ein gutes und schlichtes Herz
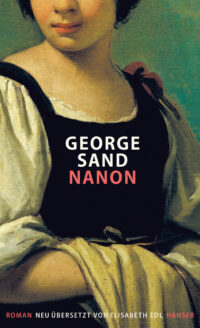
Das erste Buch, das ich von George Sand lese, und auch diesmal nicht um der Autorin, sondern der Übersetzerin willen. Der Eindruck, den es gemacht hat, ist zwiespältig:
Einerseits kann man Sand nur in ihrer Selbsteinschätzung zustimmen: „Ich schreibe leicht und gern.“ Das Buch ist offenbar rasch und ohne großen Anspruch auf formale Kunstfertigkeit geschrieben, sprich: Es handelt sich im Grunde um anspruchsvolle Unterhaltungsliteratur, wie sie in jedem Zeitalter verfasst und mehr oder weniger rasch vergessen wird. Die sprachliche Qualität des Originals kann ich nicht wirklich beurteilen; allerdings nehme ich an, dass die grammatikalischen und stilistischen Ecken und Kanten des deutschen Textes von der Autorin beabsichtigt und von der Übersetzerin getreulich übertragen wurden. Das allein ist schon kein kleiner stilistischer Aufwand.
Andererseits enthält der Roman Passagen, die einen ernsthaften Versuch einer Auseinandersetzung mit der Französischen Revolution und ihren Folgen darstellen, wie auch immer man sich zur Darstellung und der Figurenrede stellen möchte. Die Meinungen, die aufeinanderprallen, bleiben im Grunde naiv, aber sie sind den Figuren und ihrer sozialen und politischen Stellung angepasst, und so kann man sie gelten lassen. Und natürlich ist Nanon eine auch 1872 noch außergewöhnliche Protagonistin, wenn ihr ihr Schicksal auch ein bisschen zu sehr von der Autorin zurechtgeschrieben wurde.
Erzählt wird die Geschichte als Ich-Erzählung der Bäuerin Nanon, 1775 geboren, bald Waise, die bei einem Großonkel aufwächst und nun im Jahr 1850 auf ihr Leben zwischen 1789 und 1795 zurückblickt. Sie ist inzwischen reich und lebenssatt, Mutter und Großmutter, trägt den Titel einer Marquise – „Ich bleibe Bäuerin. Auch ich habe meinen Standesstolz!“ (S. 344) –, kommt mit ihren Freunden und Verwandten sowohl des ersten als auch des dritten Standes aus und ist überhaupt die ideale Mutter der Nation. Wie das alles gegen jede Wahrscheinlichkeit gekommen ist, kann man getrost selbst nachlesen; die Fabel ist so gut oder schlecht erfunden, wie jede beliebige von Dumas oder Sue.
Am meisten leidet der Roman aus heutiger Sicht wohl unter der fast vollständigen inneren Konfliktlosigkeit der Protagonistin, die ebenso gut wie langweilig bleibt. Natürlich ist sie – wie die meisten Protagonisten des 19. Jahrhunderts – wesentlich Verkörperung eines Ideals; der einzige Zweifel, den sie hegt, entspringt aus ihrer demütigen Selbsteinschätzung, dass sie nicht gut genug ist für den Mann, den sie liebt, wodurch sie natürlich gerade geadelt wird. Tritt man also einen Schritt zurück, so ist das alles recht schematisch, und an keiner Stelle wagt die Autorin einen echten Konflikt mit den Vorurteilen ihrer Zeit: „Wenn Émilien mein Gatte ist, wird er auch mein Gebieter, und ich gehorche ihm gern.“ (S. 343) Wenn das wenigstens als ironisch markiert wäre, aber so wäre es besser fortgelassen worden, denn die Lücke ersetzte die Plattitüde mehr als vollständig.
Ich hatte es schon gesagt: „zwiespältig“ – eine historisch interessante Lektüre, sowohl was die Französischen Revolution als auch was die Literargeschichte angeht. Dennoch sollte man nicht zu viel Außergewöhnliches oder wirklich Originelles erwarten, aber auch keine Abenteuerscharteke à la Dumas – hier weiß die Autorin das Schlimmste gerade noch zu verhindern.
George Sand: Nanon. Aus dem Französischen von Elisabeth Edl. München: Hanser, 2025. Leinenband, Fadenheftung, Lesebändchen, 495 Seiten. 38,– €.
Wie bei fast allen Vielschreibenden streut das Werk von Sand sehr stark. Man denke etwa an Philipp Dick oder Balzac. Bei Sand beeindruckt aber durchaus die Professionalität, mit der auch die schwächeren Texte halbwegs rund gearbeitet und spannend gehalten werden. Ich glaube, ich habe von Sand noch nichts gelesen, das so schwach ist wie die größten Katastrophen im Werk von Balzac. Ja, viele Texte haben, auch wenn sie passagenweise sehr gelungen sind, größere Schwächen, aber es finden sich auch Texte, die absolut auf dem Niveau des Besten der anderen Großen ihrer Zeit sind.
Was also soll ich lesen?
„Der Teufelssumpf“ ist mE am stärksten, „Teverino“ ist ein faszinierender aber etwas verwirrender Text in der Tradition des Wilhelm Meister und der große Dreiteiler „Consuelo“ ist auf jeden Fall ähnlich lesenswert wie die meisten dieser dicken bildungsromanartigen Wälzer aus dieser Zeit, wenn er sich mit denen auch die Schwächen teilt.
Zu Bedenken: Das ist immer noch nur ein kleiner Ausschnitt, ich habe eine 99 Cent Ausgabe mit höchstens 20 Romanen und Erzählungen von, ich glaube, über 90, die auf französisch erschienen sind.
Vielen Dank! Ich habe die drei nun in den ältlichen, freien Übersetzungen heruntergeladen und werde auf jeden Fall mal hineinlesen. Wenn sich daraus etwas ergibt, was meine Vorurteile aufweicht, werde ich es hier vermelden.