… ich bilde mir ein, ein großer deutscher Humorist zu sein.
Arno Schmidt
Es findet alles sein Ende in der Welt. Jede Zeit hat ihr eigenes Pläsier und kümmert sich wenig um das der vorhergegangenen.
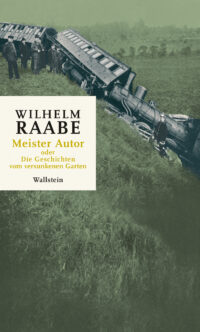
Was für ein ganz und gar wundervolles kleines Buch! Heute darf man knapp 180 Seiten Text schlechtweg einen Roman heißen, damals war es noch nur eine Erzählung, aber sie ist so dicht geraten („hätte ich dieses Buch, wie man es nennt – gemacht“ (S. 145)), dass andere Autoren daraus 800 Seiten und mehr erkünstelt hätten. Und obwohl es so kurz ist, ist es gar nicht so einfach zu sagen, worum es denn eigentlich geht. Denn es geht, in bester Manier des 19. Jahrhunderts, um Liebe und Tod, ums Altern der Menschen und das Jungbleiben der Welt, darum dass jede Generation seit Adam und Eva den Garten verliert, in den sie hineingeboren wird, dass die neuen Möglichkeiten der Zeit und ganz neue Gefahren Hand in Hand gehen und schließlich darum, dass es keine kleine Kunst ist, sich in sein Glück zu finden, wenn es sich einem denn anbietet; und ganz am Rande geht es auch noch um Kolonialismus und Rassismus und noch um einiges mehr.
Erzählt wird das Ganze von einem nicht sonderlich erfolgreichen Schriftsteller, dem Baron Emil von Schmidt („Es kann schließlich nich Jeder Schmidt heißn.“ Arno Schmidt [BA I/3, 403]), der den titelgebenden Meister Autor Kunemund bei einer Waldführung in der Gegend um Kneitlingen, dem Geburtsort Till Eulenspiegels, kennenlernt. Kunemund lebt in einem Forsthaus zusammen mit dem Förster Arend Tofote, dessen Töchterchen Gertrud und einer Haushälterin. Der Erzähler fasst sofort eine große Sympathie für den von Schnitzereien lebenden Kunemund und besucht den Haushalt der Tofotes nach dem ersten Kennenlernen jährlich, bis Gertrud eines Tages eine überraschende Erbschaft macht. Kunemunds jüngerer Bruder ist von seinen Weltreisen offenbar als reicher Mann und in Begleitung eines schwarzen Dieners zurückgekehrt und hat in der nahegelegenen Stadt ein Haus erworben, die Leute im Försterhaus aber nur ein einziges Mal besucht. Nach seinem Tod weist es sich, dass er Trude als seine Alleinerbin eingesetzt hat, die unter anderem eben auch das Rokokohaus und den zugehörigen Garten des Verstorbenen erbt. Der Erzähler ist Zeuge beim Einzug Gertrudes in ihren neue Besitz, der allerdings schon zu diesem Zeitpunkt zum Untergang verdammt ist, da die Planung zur Erweiterung der Stadt hier den Bau einer neuen Straße vorsieht.
Nach diesen Ereignissen verliert der Erzähler seine Bekannten für einige Jahre aus den Augen, bis ein Eisenbahnunglück auf der Strecke, auf der auch der von ihm benutzte Zug unterwegs ist, ihn zwingt, seine rasche Fahrt zu unterbrechen und unerwartet zu Fuß die Landschaft zu durchqueren. Bei dieser Gelegenheit trifft er nicht nur zufällig den Meister Autor wieder, sondern erfährt auch von den neuen Verhältnissen, in denen sich seine ehemaligen Bekannten inzwischen befinden: Kunemund lebt für sich allein wieder in seinem Elternhaus, der Förster Tofote ist verstorben, die reiche Gertrud wohnt in der Stadt und verkehrt in der sogenannten besseren Gesellschaft und der schwarze Diener des Mynheer van Kunemund ist in ihrem Haushalt beschäftigt. Am dramatischsten aber gerät das Schicksal des ehemaligen Leichtmatrosen, jetzigen Steuermanns Karl Schaake ausgefallen, der ganz am Ende des ersten Teils plötzlich aufgetaucht war, ein Jugendfreund Gertrudes und offenbar unglücklich in sie verliebt. Karl aber saß in dem verunglückten Zug und ihm wurden beim Unglück beide Füße gebrochen; nun liegt er bei seiner Tante zur Pflege, aber das Wundfieber wird immer schlimmer und schließlich erliegt er, beinahe in Anwesenheit der gesamten versammelten Buchgesellschaft, seinen Verletzungen. Obwohl damit der Tod in die Verhältnisse eingetreten ist, nimmt das Buch ein gutes Ende, wenn auch nur, wenn man nicht so ganz genau hinschaut.
Es fehlen an der Leiter, die in den Brunnen hinunterreichen soll, immer einige Sprossen.
S. 97
Dieses Buch unterläuft so konsequent die Erwartungen einer Leserin oder eines Lesers des 19. Jahrhunderts, dass es kein Wunder ist, dass es in seinem Reichtum, seiner Dichte und Tiefe erst im 20. Jahrhundert richtig wahrgenommen worden ist. Noch einmal: ein ganz und gar wundervolles kleines Buch! Wer wissen will, was Raabe konnte, greife zu diesem Band.
Wilhelm Raabe: Meister Autor oder Die Geschichten vom versunkenen Garten. In: Werke. Kritische kommentierte Ausgabe. Göttingen: Wallstein, 2025. Pappband, Fadenheftung, 245 Seiten. 26,– €.