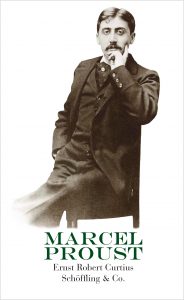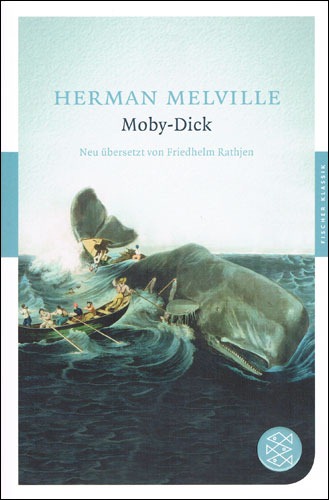Diesmal habe ich – wieder einmal aus didaktischem Anlass – zusammen mit Der Radetzkymarsch auch diesen späten Nachtext Josephs Roths gelesen. Er ist der Versuch, an den Erfolg des großen Romans anzuknüpfen und zugleich Themen abzuarbeiten, die dort nicht oder nur am Rande behandelt wurden. Die Kapuzinergruft ist deutlich kürzer geraten (etwa ein Drittel des Vorgängers), ja reicht an die damalige Länge für einen Roman (die berühmt-berüchtigten 50.000 Wörter E. M. Forsters) nicht heran. Er ist zudem weit anekdotischer gearbeitet als Der Radetzkymarsch und hat einen Ich-Erzähler. Dagegen sichern zahlreiche motivische Korrespondenzen die Zusammengehörigkeit der Texte, nicht nur das verwandtschaftliche Verhältnis des Ich-Erzählers und Carl Josephs von Trotta.
Beim Ich-Erzähler handelt es sich um Franz Ferdinand Trotta, einen entfernten, bürgerlichen Vetter des Protagonisten von Der Radetzkymarsch. Er studiert nur zum Schein in Wien Jura, als ihn sein Vetter Joseph Branco in Wien besucht, der wiederum die Bekanntschaft zum Kutscher Manes Reisiger vermittelt. Mit diesen beiden neuen Freunden zusammen verlebt er dann noch vor dem Ersten Weltkrieg in Galizien einige glückliche Tage. Bei Kriegsausbruch heiratet er noch rasch seine heimliche Liebe Elisabeth, rückt dann ein, lässt sich als Leutnant zum Regiment seiner Freunde versetzen und gerät in der Schlacht, in der der Leutnant von Trotta fällt, zusammen mit ihnen in russische Gefangenschaft. Die Freunde werden nach Sibirien deportiert und der Erzähler kehrt nach diversen Flucht-Abenteuern nach Wien zurück.
Dort findet er seine Frau entfremdet und in einer lesbischen Liebesbeziehung vor. Sein Schwiegervater erweist sich als windiger Geschäftsmann, der ihn in seiner Firma zum Vertrieb von Kunstgewerbe anstellt, ohne dass es eine wirkliche Arbeit für den Schwiegersohn gäbe. Nachdem der Schwiegervater sein eigenes Geld durchgebracht hat, überredet er die Mutter Trottas, ihr Haus, das ihren einzigen Besitz bildet, mit mehreren Hypotheken zu belasten. Schließlich endet der Erzähler als Betreiber einer Pension im Haus seiner verstorbenen Mutter und versinkt in Apathie und Depression. Der Roman endet mit dem sogenannten Anschluss Österreichs an das deutsche Reich.
Diese Handlung bildet aber nur das Rückgrat für eine Schilderung der atmosphärischen und kulturellen Entwicklung von den Vorkriegsjahren bis zum vorläufigen staatlichen Ende Österreichs. Es geht Roth offensichtlich um eine Schilderung der Ziellosigkeit der österreichischen Intellektuellen, eine Kritik der Kultur der Moderne und nicht zuletzt der Gleichgültigkeit, mit der Österreich auf seine Vereinnahmung durch das faschistische Deutschland reagiert. Es ist eine scharfe Abwendung von seiner Heimat und eine sentimentale Rückwendung zum Vielvölkerstaat der Vorkriegszeit, der angesichts des aktuellen Desasters als schlechte, aber immerhin eigenständige Alternative erscheint. Für ihn steht symbolisch der Leichnam des letzten Kaisers in der Kapuzinergruft.
Man merkt dem Buch sehr an, dass ihm die umfassende, geschlossene Komposition mangelt, die Der Radetzkymarsch ausgezeichnet. Die Handlung bleibt anekdotisch und mehr als eine der Wendungen der Handlung erscheint eher als willkürlich erfunden denn als organisch hergeleitet. Das Buch ist nicht ohne Reiz, aber es ist ironischerweise ein typisches Produkt jener Moderne, die es zu kritisieren versucht.
Joseph Roth: Die Kapuzinergruft. dtv 13100. München: dtv, 112020. Broschur, 187 Seiten. 9,90 €.