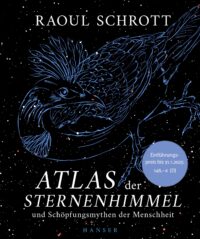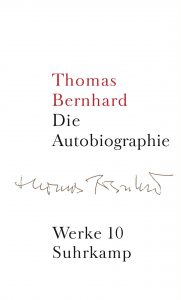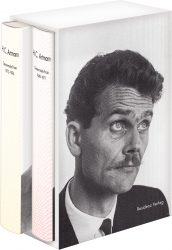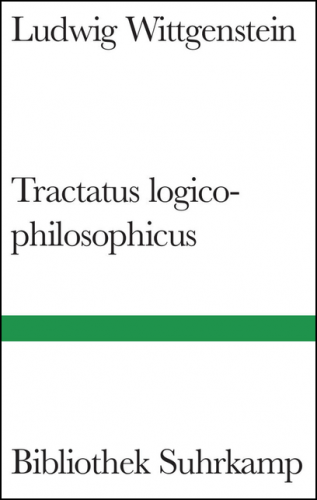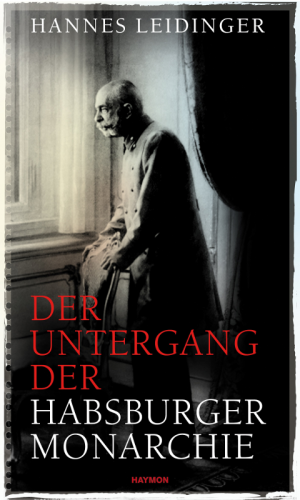Zwei Dinge erfüllen das Gemüth mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir.
Immanuel Kant
Die Veröffentlichungen Raoul Schrotts begleite ich seit dem Erscheinen von „Finis Terrae“ vor knapp 30 Jahren. Von daher ist es eher verwunderlich, dass er hier bislang nur einmal als Übersetzer aufgetaucht ist. Nun aber ist ein Buch von ihm erschienen, an dem der Nachtwächter nicht vorübergehen kann:
Jeder an Astronomie interessierte Mensch hat sicherlich schon einmal den Gedanken gehabt, dass man das eigene willkürliche System der Sternbilder, das man notwendig erlernt, um sich wenigstens grob am Himmel orientieren zu können – einige wenige Sternbilder über den Tierkreis hinaus kennt wahrscheinlich jeder, wenn er sie auch nicht immer gleich am Himmel auffinden kann –, zumindest einmal mit dem einer anderen Kultur vergleichen sollte, nicht nur um die Willkür konkret werden zu lassen, sondern einfach auch, um den Reichtum an Gestalten kennenzulernen, den verschiedene Kulturen in den objektiv gestaltlosen Himmel hineinerfunden haben.
Einer gottlob unter einem ganzen, ja auch unter einem halben Dutzend deutscher Männer hat immer Astronomie ein wenig gründlicher getrieben als die übrigen und weiß Auskunft zu gehen, Namen zu nennen und mit seinem Stabe zu deuten, wo die andern vorübergehend in der schauerlichen Pracht des Weltalls verlorengehen und kopfschüttelnd sagen: Es ist großartig.
Wilhelm Raabe
Aber natürlich bedeutet es einen ungeheuerlichen Aufwand, sich auch nur annähernd einen Überblick darüber zu verschaffen, wie der Himmel in anderen Kulturen aufgeteilt und Verstand und Gedächtnis zugänglich gemacht worden ist. Raoul Schrott hat diesen Aufwand nun gleich mehrfach auf sich genommen: Sein „Atlas der Sternenhimmel“ präsentiert 17 astronomische Systeme im Zusammenhang mit den Schöpfungs- und weiteren Mythen, aus denen sich die himmlischen Gestalten speisen. Zusammengekommen sind beinahe 1.300 großformatige Seiten (25 × 30 cm), die jeweils ungefähr 4 Normalseiten an Text enthalten dürften. Ein unauslesbares mythologisches Kompendium, ein Buch, das man nun wirklich auf die berühmte einsame Insel mitnehmen könnte. Ergänzt wird der Band mit acht großformatigen Himmelskarten, die auf Vorder- und Rückseite jeweils eine der astronomischen Nomenklaturen im Zusammenhang darstellen.
Wer sich einen Eindruck von diesem Atlas verschaffen will, ohne ihn gleich kaufen zu müssen, kann auf der Sonderseite des Hanser Verlages eine ausführliche Leseprobe anschauen. Für alle, die auch nur eine Winzigkeit der von Kant heraufbeschworenen Bewunderung und Ehrfurcht empfinden, eine unbedingte Empfehlung: Ein Buch für den Rest des Lebens! Ganz und gar großartig!
Raoul Schrott: Atlas der Sternenhimmel und Schöpfungsmythen der Menschheit. Mit Sternbildern von Heidi Sorg. München: Hanser, 2024. Bedruckter Leinenband, Fadenheftung, zwei Lesebändchen, 1278 Seiten (25 × 30 cm). Bis zum 31.01.2025 148,– €, danach 178,– €.