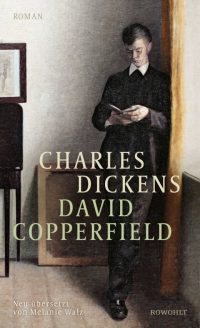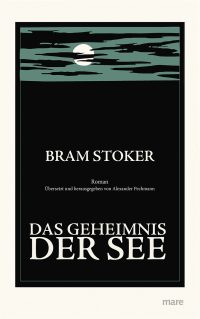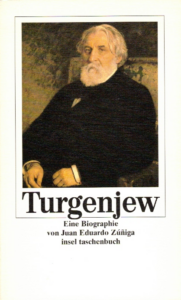Blogger-Kollege Jürgen Fenn hat auf seiner Schneeschmelze auf eine Umfrage des französischen Radiosenders France Culture hingewiesen, der seine Hörer nach nicht zu Ende gelesenen Romanen gefragt hat. Fenn weicht – kluger Weise? – jeder Diskussion der Ergebnisse aus und listet einfach nur die Top-10 auf:
- Ulysses von James Joyce
- Die Wohlgesinnten von Jonathan Littell
- Auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Marcel Proust
- Der Herr der Ringe von J. R. R. Tolkien
- Die Schöne des Herrn von Albert Cohen
- Der Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil
- Rot und Schwarz von Stendhal
- Madame Bovary von Gustave Flaubert
- Hundert Jahre Einsamkeit von Gabriel Garcia Marquez
- Reise ans Ende der Nacht von Louis-Ferdinand Céline
Wie bei vielen Fällen statistischer Daten ist die Deutung schwierig: Zwar haben auf die Umfrage immerhin 3.000 Hörer geantwortet, aber sie dürften dennoch kaum eine repräsentative Stichprobe bilden, denn zum einen handelt es sich um Franzosen – wofür sie selbstredend nichts können – und zum anderen sind sie Hörer eines Kultursenders. Jenes führt dazu, dass sechs von zehn Titeln von französischen Autoren stammen, dieses, dass alle Titel zumindest in dem Verdacht stehen müssen, zur Hochkultur zu gehören.
Aber vielleicht liegt die Vorhersehbarkeit der Antworten auch in der Frage begründet: Während kaum jemand auf Fragen wie „Am Fuß welcher 8.000er haben Sie bereits gestanden, ohne sie bestiegen zu haben?“ oder „In welchen Ozeanen haben Sie schon gebadet, ohne sie durchschwommen zu haben?“ antworten würde, machen Kulturmenschen bei der Frage nach abgebrochenen Lektüren sofort Männchen und geben hechelnd genau jene Antworten von sich, die von ihnen erwartet werden; und je anonymer die Befragten, desto stereotyper die Antworten.
Natürlich führt der Joycesche Ulysses das Feld in jeder dieser Umfragen an. Der durchaus begründete Ruf der Bedeutung dieses Romans steht in direkt reziproker Proportionalität zum Glauben des kultivierten Lesers, er müsse ihn einerseits gelesen haben, er – der Roman, nicht der Leser – werde aber andererseits zu Recht für unlesbar gehalten; es versteht sich von selbst, dass beides falsch ist. Nicht der Ulysses ist unlesbar, sondern die meisten seiner Leser begegnen ihm mit zumeist unbewussten Konzepten, wie ein Roman zu funktionieren habe, denen das Buch aber in nur verschwindenden Anteilen entspricht. Anders gesagt: Die Leser des Ulysses scheitern in der Regel an ihren anderwärts sich bewährenden Vorurteilen, nicht am Buch.
Ganz anders dagegen ein Fall wie Der Mann ohne Eigenschaften: Hier scheitert das Zuendelesen bereits an der Tatsache, dass der Roman gar nicht zu Ende geschrieben worden ist, dass also auch die umfangreichste und gründlichste Lektüre immer den Fall liefert, dass man das Buch nicht zu Ende gelesen hat; was aber naturgemäß die wenigsten der Befragten wissen dürften, da sie lange vor diesem nicht existenten Ende aufgegeben haben. Das wiederum liegt daran, dass Musil für einen impliziten Leser schreibt, der deutlich intelligenter und aufmerksamer ist als der reale. Das meiste, was Musil schreibt, entkommt seinen Lesern also direkt über den Kopf hinweg ins Nichts.
Ganz anders wiederum ein Fall wie Der Herr der Ringe, ein Buch, das, wenn man ehrlich ist, nicht nur von gähnender Langweiligkeit ist, sondern auch seine wichtigste Pointe bereits im Titel des dritten Bandes ausschwatzt: Die Rückkehr des Königs. Ganz abgesehen davon, dass man inzwischen bequem die Verfilmung anschauen kann.
Ganz anders wiederum ein Fall wie Madame Bovary, bei dem es sich nur mit massivster Humorlosigkeit oder Gehirnamputation erklären lässt, wenn einer das Buch nicht zu Ende liest. Man sieht leicht, wohin das führt.
Aber – und deshalb schreibe ich das alles hier– am andersten ein Fall wie Die Schöne des Herrn, zumindest für einen deutschen Leser – für mich: Mir war die Existenz des Buches bis zu dieser Umfrage komplett entgangen, was sich am einfachsten daraus erklärt, dass Elke Heidenreich es empfohlen hat. Etwas verwundert darüber, dass ich dieses eine Buch der Liste so gar nicht einordnen konnte, habe ich mir beim deutschen Verlag eine Leseprobe der Übersetzung heruntergeladen und durfte gleich auf der zweiten Seite folgendes lesen:
Um den knirschenden Kies zu vermeiden, wagte er einen Sprung in die mit Muschelwerk eingefassten Hortensienbeete.
Was für ein Mann! Nicht nur läuft er seit Textbeginn mit nacktem Oberkörper durch den Roman, er wagt es auch, in mehrere Hortesienbeete zugleich zu springen! Mir läuft es eiskalt den Nasenrücken herunter. Aber gleich geht es weiter: Völlig unvorbereitet und unvorhersehbar hat unser Held etwas in der Hand:
Er lächelte ohne Grund und ging auf und ab, von Zeit zu Zeit seine automatische Pistole in der Hand wiegend.
Ja, seinen Ballermann hat er wohl aus der Hose gefischt, weil der Autor nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen wollte. Und auch die Übersetzung hat es in sich:
In dem Salon, dessen Wände mit rotem Samt ausgeschlagen und mit vergoldetem Holz getäfelt waren, …
Nun kann zwar ein Salon mit Samt ausgeschlagen sein, aber seine Wände können es nicht. Um etwas mit etwas anderem ausschlagen zu können, bedarf das erste Etwas so etwas wie eines Innenraums, was Wände schlechthin nicht haben. Aber es wird noch besser:
Stieß sie sich an irgendeiner Unzulänglichkeit, wie eine brüchige Rampe, ein aus den Fugen geratenes Eisengitter, ein versiegter öffentlicher Brunnen, …
Verzweifelnd nach vorn blätternd, entdecke ich, dass das Buch nicht nur einen Übersetzer, sondern auch noch einen grundlegenden Überarbeiter der Übersetzung hat. Nur damit man es recht versteht: Ein französischer Roman aus dem Jahr 1968 wurde nicht nur 1983 ins Deutsche übersetzt, sondern die Übersetzung war offenbar derart, dass 2012 eine grundlegende Überarbeitung erschien. Dabei ist das Buch zweimal durchs Lektorat gegangen, und dann steht ein Satz wie der oben zitierte auf der achten Textseite. Das ist kein Deutsch! Auch wenn auf der Straße und in der Tagesschau so gesprochen wird, ist das kein Deutsch. Wer mag, kann den Grund gern unter „Kongruenz im Kasus“ nachschlagen. Was auch immer im Original steht, es kann nicht auch nur halbwegs so schrecklich sein wie das, was im Deutschen daraus geworden ist.
Und auch wenn ich kaum angefangen habe, werde ich dieses Buch nicht zu Ende lesen. Weil es fürchterlich ist; weil der Übersetzer oder der Überarbeiter kein Deutsch kann; weil solche Bücher unerträglich sind. Von Frau Heidenreich empfohlen: „Wenn ich jetzt sagen müsste, welches das schönste Buch ist, was ich in meinem Leben gelesen habe, wäre es dieses.“ – Jo!
Und wie geht sowas jetzt in eine Umfrage ein?