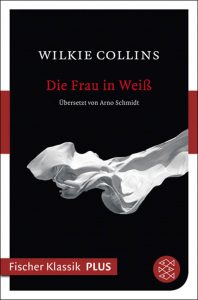Im Falle Cooper beginnt die erstaunliche Tatsache sich abzuzeichnen, daß jede Übersetzung, sie kann nicht anders, besser werden muß, als das Original!
Arno Schmidt
Auch diese Lektüre gehört in die Reihe meiner Revisionen der Übersetzungen Arno Schmidts. Cooper gehört schon früh unter die Schmidtschen literarischen Hausheiligen und seine Übersetzung von The Wept of Wish-Ton-Wish (1829) ist wohl so etwas wie ein Testballon gewesen für seine spätere Übersetzung der Littlepage-Trilogie (die ebenfalls demnächst noch einmal gelesen werden soll). Was Schmidt bewogen hat, ausgerechnet dieses sowohl inhaltlich als auch sprachlich antiquarische Buch zu übersetzen, soll etwas später erwogen werden.
Das Stück spielt in Connecticut in den Jahren zwischen etwa 1660 bis 1675. Ort der Handlung ist eine abgelegene Puritaner-Siedlung, eine Gründung des Hauptmanns Marcus Heathcote, der sich zu Anfang des Romans mit seiner Familie und seinen Bediensteten aufmacht, um in der Wildnis noch einmal ganz von vorn zu beginnen. Die Handlung selbst konzentriert sich im Wesentlichen auf zwei Episoden in der Geschichte der Ansiedlung, die beide den kriegerischen Konflikt mit den lokalen Indianern thematisieren. In beiden spielt ein Häuptling der Narragansets, eben der bei Schmidt titelgebende Conanchet eine zentrale Rolle. Im ersten Teil wird der Häuptling als junger Mann von den Siedlern gefangengenommen und lebt für einige Monate mit ihnen zusammen, wobei er langsam aber sicher das Vertrauen der Siedler gewinnt, ohne sich tatsächlich mit ihnen einzulassen. Diese erste Episode endet mit einem die Siedlung nahezu komplett zerstörenden Überfall durch die Narragansets, den allerdings die meisten der Siedler wie durch ein Wunder überleben.
Die zweite Episode schildert die Verwicklung der wieder erblühten Siedlung in den sogenannten King Philip’s War, die erste große kriegerische Auseinandersetzung zwischen den Indianer im Nordosten der späteren USA und den weißen Siedlern. Im Verlauf dieses Krieges kehrt Conanchet an den Ort seiner früheren Gefangenschaft zurück, und es stellt sich heraus, dass er ein im früheren Überfall verschwundenes und für tot gehaltenes junges Mädchen, Ruth, entführt und zu seiner Frau gemacht hat. Seine emotionale Verbindung mit den von ihm wiederum für tot gehaltenen Siedlern verhindert die nochmalige Zerstörung der Siedlung und bringt ihn in Konflikt mit seinen Verbündeten im Krieg. Die Handlung endet in einer melodramatischen Tragödie, die hier nicht im Detail geschildert werden muss.
Neben den zum Teil äußerst drastischen Schilderungen der Kampfhandlungen ist der Roman weitgehend angefüllt mit der ausführlichen Beschreibung puritanischen Lebens und ebensolcher Dialoge, die bereits nach kurzer Zeit dazu geeignet sind, den Leser bis aufs Äußerste zu strapazieren. Schmidt hat als Grundlage seiner Übersetzung die erste deutsche Übertragung durch Karl Meurer (wohl ebenfalls bereits 1829 erstmals erschienen) zugrunde gelegt, wobei er sie über weite Strecken in den sprachlichen Details präzisiert und über den gesamten Text hinweg um knapp 5 % gekürzt hat.1 Wirklich überzeugen kann das Buch dennoch nicht.
Auch Schmidts Nachwort, das hauptsächlich deutsche Leser mit Cooper und der Breite seines Werks vertraut machen soll, gibt keinen echten Aufschluss darüber, warum gerade dieses Werk ausgewählt wurde, um eine Cooper-Renaissance in Deutschland anzustoßen. Schmidt selbst lässt an Coopers Fabeln und Hauptfiguren kaum ein gutes Haar und lobt dagegen im Allgemeinen dessen Landschaftsschilderungen und Nebenfiguren. Und so wird es – neben den Motiven der Zivilisationsflucht und des Lebens in der Isolation, die in Schmidts eigenen Inselphantasien eine bedeutende Rolle gespielt haben – wahrscheinlich eine der Nebenfiguren des Romans sein, die Schmidts Aufmerksamkeit gefesselt hat: Bei dem im Text nur unter dem angenommenen Namen Submissus auftretenden Einzelgänger, der die Siedler beim ersten Angriff der Indianer vor dem Untergang rettet und auch im zweiten Teil eine durchgehende Nebenrolle spielt, handelt es sich wohl um ein Porträt des sogenannten Königsmörder William Goffe, der zum unmittelbaren Umfeld Cromwells gehörte und maßgeblich am Prozess gegen Charles I beteiligt war. Er war einer jener unter Charles II Verurteilten, denen es gelungen war, nach Amerika zu entkommen, aber auch dort immer noch durch Agenten der englischen Regierung verfolgt wurden. Schmidt liebte solche Verflechtungen von Fiktion und Historie und hat mit seinem Das steinerne Herz selbst ein Muster für das Historische im Roman geliefert.
Alles in allem eine eher zähe Lektüre, die zwar einmal mehr den edlen amerikanischen Wilden feiert, bis auf wenige Passagen aber weder historisch interessant noch anderweitig belangreich ist.
James F. Cooper: Conanchet oder die Beweinte von Wish-Ton Wish. Aus dem Englischen von Arno Schmidt. Fischer Tb. 1287. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 21977. Broschur, 414 Seiten. Derzeit nicht im Druck.
1 – Günter Jürgensmeier war so freundlich, mir einen vergleichenden Text der beiden Übersetzungen zusammen mit einigen wichtigen statistischen Details zur Verfügung zu stellen.