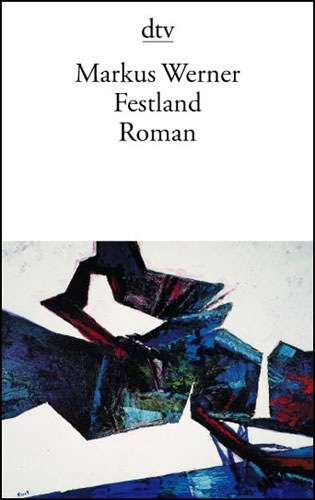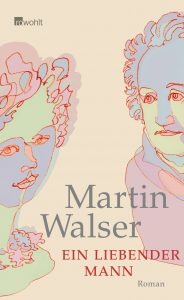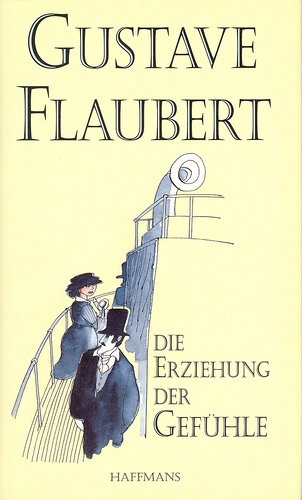Mit ihren ersten beiden Büchern, Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot (1997) und Sex II (1998, beide Reclam Leipzig), hatte Sibylle Berg bei mir großen Eindruck gemacht. Ich hatte mit ihrer Unverfrorenheit und ihrer klaren, schlanken und harten Prosa viel Spaß. Dann kam – vielleicht zu schnell – Amerika (1999) heraus, das ich fad und voller sprachlicher Klischees fand. Daraufhin habe ich erst einmal aufgehört, Sibylle Berg zu lesen. Nun tauchte sie im letzten Jahr bei Hanser wieder auf, und ich habe es wieder mit ihr versucht und bin nicht enttäuscht worden.
Mit ihren ersten beiden Büchern, Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot (1997) und Sex II (1998, beide Reclam Leipzig), hatte Sibylle Berg bei mir großen Eindruck gemacht. Ich hatte mit ihrer Unverfrorenheit und ihrer klaren, schlanken und harten Prosa viel Spaß. Dann kam – vielleicht zu schnell – Amerika (1999) heraus, das ich fad und voller sprachlicher Klischees fand. Daraufhin habe ich erst einmal aufgehört, Sibylle Berg zu lesen. Nun tauchte sie im letzten Jahr bei Hanser wieder auf, und ich habe es wieder mit ihr versucht und bin nicht enttäuscht worden.
Sibylle Berg ist vielleicht die einzige wirklich misanthropische Autorin, die wir haben, sprich: die so erfolgreich ist, dass man von ihr weiß. Es mag andere misanthropische Autorinnen geben, aber wahrscheinlich fehlt ihnen die geschliffene Prosa Bergs und ihre – ja, was ist jetzt das genaue Gegenteil von Weinerlichkeit? Toughness?
Ihr jüngstes Buch erzählt die Geschichte einer Frau in den besten Jahren, die nach einem langen misanthropischen und einsamen Leben endlich ihren Mann findet. Die beiden leben etwa vier Jahre zusammen und unternehmen dann ihre zweite gemeinsame Urlaubsreise auf eine kleine, vor Hongkong liegende Insel. Dort verschwindet der Mann eines Tages. Die Frau bemüht sich 14 Tage lang erfolglos darum, ihn wiederzufinden, und verfällt anschließend in eine langsam sich steigernde Depression. Nach einiger Zeit wird sie von einem chinesischen Mädchen adoptiert und zu sich nach Hause eigeladen. Aber auch der dortige Familienanschluss hilft nicht; die Erzählerin verfällt als letztem Trost dem Alkohol. Am Ende bleibt es unklar, ob sie gerettet wird oder einem Wahnzustand verfällt. Die Fabel wird in alternierenden Kapiteln erzählt, die jeweils »Damals« und »Heute« überschrieben sind und deren Handlungsbögen sich auf den letzten Seiten vereinigen.
Entscheidend ist aber weniger die erzählte Geschichte, sondern die tief misanthropische Grundposition des Buches: Die Erzählerin verachtet die Menschen, ihre Anstrengungen, ihre Routinen, ihre Dummheit, ihre Lügen und – wahrscheinlich am schlimmsten – ihre Wahrheiten.
Dieses Theater, das um Sexualität gemacht wird, zu unerheblich, um sich davon beeinflussen zu lassen. Selbst die seltsamste Fetischanwandlung wollen wir heute begreifen und akzeptieren, wir wollen tolerant sein und offen und ersticken an unserem Hass gegen alles, was uns nicht ähnelt, und brüllen umso lauter das Lied der Gleichberechtigung.
Alles muss definiert sein, geregelt, geordnet; geheiratet muss werden, auch gleichgeschlechtlich, auch Familienmitglieder und Tiere, so entfernt von Anarchie und Ungehorsam wie jetzt schienen die Menschen noch nie, gerade weil sie so frei sind. Wenn sie nicht das Pech hatten, im Mittelalter geboren zu werden, also bei Fundamen-talisten, also im Patriarchat, versagen sie es sich, suchen nach Geländern zum Festhalten, haben Angst, sich zu verlieren, wenn sie die Regeln nicht befolgen, die sie selber aufgestellt haben. Alle müssen über ihre sexuellen Präferenzen reden, sie müssen sich mitteilen, unbedingt, und akzeptiert werden. [S. 167 f.]
Dabei ist die Erzählerin durchaus nicht selbstgerecht:
Meine Wut auf die Rasse, der ich angehörte, verschwand, denn ich hatte es kaum besser gemacht. Anstatt die Welt zu verändern, hatte ich mich auf die Unmöglichkeit dieser Aufgabe berufen und mich in Gemütlichkeit zurückgezogen, mit meinem kleinen Beruf, den kleinen Freunden, den kleinen Möbeln. Da konnte ich fein ruhig sein, und das war ich dann auch. [S. 175]
Wer die Bücher von Sibylle Berg noch nicht kennt, findet hier einen »netten« Einstieg – nur eben Humor sollte man mitbringen, sonst fällt einem das menschenfeindliche Gezeter leicht auf die Nerven.
Sibylle Berg: Der Mann schläft. München: Carl Hanser, 2009. Pappband, 309 Seiten. 19,90 €.