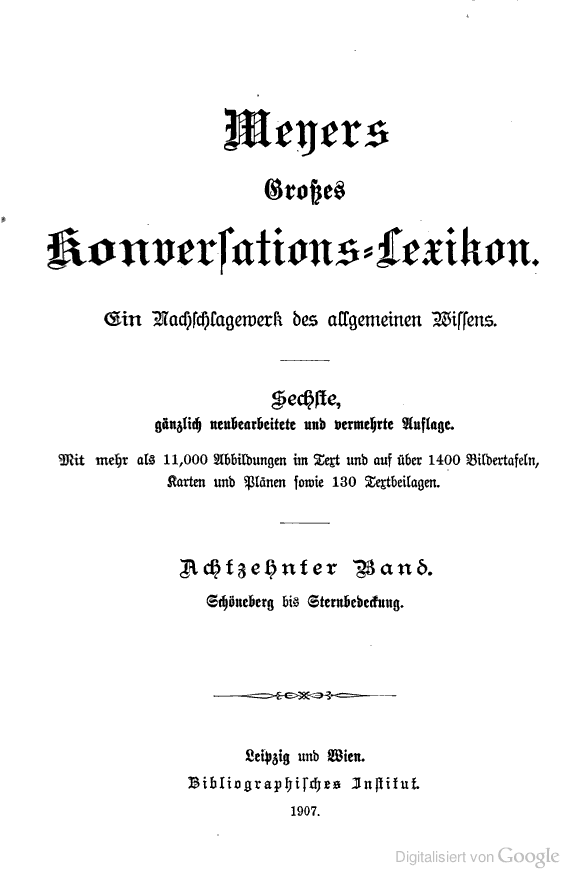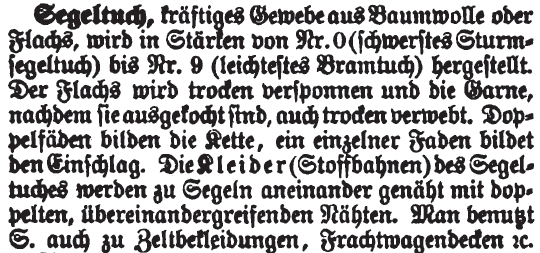Ich gebe nach und äußere mich endlich auch zum »Wettbewerb der Initiative Deutsche Sprache und der Stiftung Lesen«, auch wenn mir bislang niemand Auskunft darüber erteilen konnte, worin denn der Wettbewerb bei dieser Veranstaltung bestehen soll.
Werden die besten Begründungen prämiert? Dann ist es freilich egal, welcher erste Satz der Schönste wäre, und das ganze wäre ein versteckter Schreibwettbewerb in der Kategorie Panegyrik. Falls nicht die Begründung, so ergibt sich die Frage, warum überhaupt eine Begründung geschrieben werden muss. Da genügte dann doch ein einfaches »Der erste Satz der Jupiter-Sinfonie ist für mich der schönste erste Satz« – und fertig. Was erwartet man denn noch mehr?
Wenn allerdings tatsächlich die ersten Sätze prämiert werden sollen, so würde das zum einen bedeuten, dass die Einsender untereinander in einen Wettbewerb des Geschmacks treten, der offenbar unentscheidbar ist. Wer soll da gewinnen? Wer hat den besten Geschmack – ich natürlich, aber ich nehme ja nicht teil. Zum anderen muss man voraussetzen, dass die Jury die Schönheit der eingereichten Sätze überhaupt beurteilen kann. Da sich die Schönheit erster Sätze aber oft erst im weiteren Gang des Buches tatsächlich entfaltet, sind Ungerechtigkeiten vorprogrammiert.
Noch einmal: Worin besteht eigentlich der Wettbewerb?
Abgesehen von diesen Fragen habe natürlich auch ich einen Kandidaten. Nicht gerade für den »schönsten« ersten Satz – das wäre vielleicht Sternes
I wish either my father or my mother, or indeed both of them, as they were in duty both equally bound to it, had minded what they were about when they begot me; had they duly consider’d how much depended upon what they were then doing;—that not only the production of a rational Being was concern’d in it, but that possibly the happy formation and temperature of his body, perhaps his genius and the very cast of his mind;—and, for aught they knew to the contrary, even the fortunes of his whole house might take their turn from the humours and dispositions which were then uppermost:——Had they duly weighed and considered all this, and proceeded accordingly,——I am verily persuaded I should have made a quite different figure in the world, from that, in which the reader is likely to see me.
… aber doch zumindest für den (beinahe) ersten Satz, der als Beginn eines Prosatextes auf mich einen tiefen, vielleicht den tiefsten Eindruck überhaupt gemacht hat:
Eine kleine Station an der Strecke, welche nach Rußland führt.
Endlos gerade liefen vier parallele Eisenstränge nach beiden Seiten zwischen dem gelben Kies des breiten Fahrdammes; neben jedem wie ein schmutziger Schatten der dunkle, von dem Abdampfe in den Boden gebrannte Strich.
Wie beschreibt einer das Ende der Welt? Einen Ort, an dem alle Zusammenhänge sich verlieren, von dem alle Linien nur weglaufen, von dem man nur flüchten kann und an dem man verdammt ist, wenn man hier ankommt? Genau so! Hier gibt es keine Eisenbahnlinie von A nach B, hier gibt es nur mehr vier Eisenstränge, die keinerlei Bedeutung konstituieren, die endlos parallel nach beiden Seiten bis an den Horizont reichen und dort verschwinden. Das ist groß! Am schönsten ist es wahrscheinlich nicht, aber wen kümmert das?
Und nein, ich verrate nicht, wo das steht.