Der Nachmittag verlief sehr eintönig.
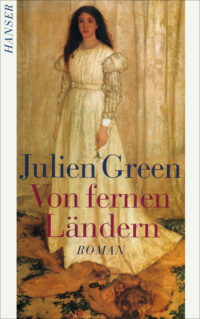
Die sogenannte Dixie-Trilogie bildet das Spätwerk Julien Greens (1900–1998), den ich bislang nur dem Namen nach kannte. „Von fernen Ländern“ (Le Pays liotaine, 1987) eröffnet den Zyklus, der von den Romanen „Die Sterne des Südens“ (Le Etoiles du Sud, 1989) und „Dixie“ (1995) abgeschlossen wird. Mein Interesse ergab sich auch in diesem Fall wieder durch die Übersetzerin des dritten Bandes, Elisabeth Edl, aber da ich ebenfalls ein eher vages Interesse an Kultur und Geschichte der us-amerikanischen Südstaaten habe, habe ich mit der Lektüre dieses ersten Bandes begonnen. Nach immerhin 400 der knapp 1.000 Seiten habe ich das Handtuch geworfen.
Erzählt wird in der Hauptsache die Geschichte der sechzehnjährigen Elisabeth Escridge, die im März 1850 als Halbwaise zusammen mit ihrer Mutter zu Verwandten in die Südstatten, genauer nach Georgia, flieht, um dem drohenden finanziellen Ruin in England zu entgehen. Während die Mutter nur als Vehikel dient, um Elizabeth an den neuen Ort zu verfrachten, weshalb sie vom Autor auch umgehend wieder nach England zurück expediert wird, ist Elizabeth eigentlich dazu gedacht, um einen verwunderten, europäischen Blick auf die Kultur der Südstaaten zu werfen und sich verzaubern zu lassen.
Allerdings muss der Leser schon bald erkennen, dass der Autor nicht so ganz genau weiß, was er nun eigentlich erzählen will: Seine sechzehnjährige Heldin interessiert sich wesentlich für Kleider und – mit einiger Zurückhaltung, die ihr immer wieder das Adjektiv „unschuldig“ einträgt – Männer und findet, wie der Leser, die von den Erwachsenen um sie herum geführten politischen und moralischen Gespräche eher wirr und emotional als informierend. Im Haus, in dem sie anfangs hauptsächlich lebt, scheint es zuerst zu spuken, was dann als Motiv aber überhaupt nicht zum Tragen kommt. Die schwarze Dienerschaft spielt im Denken der Erwachsenen zwar eine große Rolle, sie wird aber immer wieder nur mit „Sie sind Kinder“ beurteilt, und ihre Kultur bleibt vollkommen undeutlich. Was Elizabeth oder vielleicht auch den Autor nicht daran hindert, solch grundlegende Einsichten in die Psychologie der Schwarzen zu formulieren wie: „Dann sah sie, wie Betty sich die Schürze vor das Gesicht hielt, was bei den Schwarzen ein Zeichen höchster Verzweiflung war.“ (S. 390) Wie mag wohl ein Schwarzer verzweifeln, wenn gerade keine Schürze zur Hand ist?
Überhaupt neigt der Autor zu Perlen der Verallgemeinerung: „Einer unvordenklichen Tradition zufolge besaß der März das Recht, wie ein Lamm zu beginnen und wie ein Löwe aufzuhören, oder umgekehrt.“ (S. 865) Man ist als Leser bald geneigt, das Buch so zu benutzen, wie seine Protagonistin ihre Bibel: als Zufallsorakel für das eigene Leben!
Im Grunde ist das recht traditionelle artistische Konzept des Buches gut gemeint: Mittels einer Liebes- und Ehegeschichte ein Panorama des amerikanischen Südens vor dem Bürgerkrieg zu zeichnen. Nur gelingt weder das eine noch das andere: Seine Protagonistin ist zu naiv und unbedarft, dass sich an ihrer Fremdheit in der neuen Welt etwas zeigen könnte, und die Welt des Süden bleibt zu allgemein und oberflächlich, um dem Leser ein spezifisches Bild zu vermitteln.
Ich werde es nun noch mit „Dixie“, dem eigentlichen Ziel meines Unternehmens, versuchen und eventuell auch noch mit Greens wohl berühmtestem Roman „Adrienne Mesurat“, hege aber nach der Teillektüre dieses Buches erhebliche Befürchtungen.
Julien Green: Von fernen Ländern. Aus dem Französischen von Helmut Kossodo. München: Hanser, 1988. Leinen, Lesebändchen, 1007 Seiten. 24,90 € (UVP).
Um Julien Green von besserer Seite kennenzulernen, auch vom Umfang her nicht so ausufernd, empfehle ich „Le Visionnaire“, auf Deutsch „Der Geisterseher“ betitelt, was bereits Hermann Hesse „nicht ganz prägnant“, aber den Text „schön übersetzt“ fand.
Die Lektüre von „Dixie“ nach wenigen 10 Seiten abgebrochen. Es bringt nur mehr vom selben.