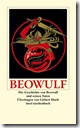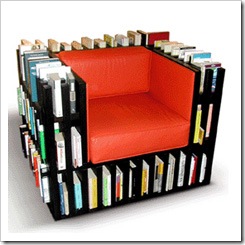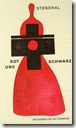 Die Neuübersetzung von Elisabeth Edl präsentiert den Roman in weiten Teilen in einer nüchternen, manchmal sogar lakonischen Sprache und hebt sich damit von allen früheren Übersetzungen ab. Vertraut man der Übersetzungskritik im Anhang (S. 724–726), so liegt mit dieser Neuübersetzung erstmals eine dem Original adäquate deutsche Ausgabe vor. Ob dies – unabhängig von der Frage der früheren Übersetzungen – tatsächlich der Fall ist, müssen andere beurteilen, da mir die dafür notwendigen Sprachkenntnisse fehlen. Allerdings macht die Übersetzung insgesamt einen sorgfältigen und ausgewogenen Eindruck. Sie liegt inzwischen auch schon im Taschenbuch bei dtv vor.
Die Neuübersetzung von Elisabeth Edl präsentiert den Roman in weiten Teilen in einer nüchternen, manchmal sogar lakonischen Sprache und hebt sich damit von allen früheren Übersetzungen ab. Vertraut man der Übersetzungskritik im Anhang (S. 724–726), so liegt mit dieser Neuübersetzung erstmals eine dem Original adäquate deutsche Ausgabe vor. Ob dies – unabhängig von der Frage der früheren Übersetzungen – tatsächlich der Fall ist, müssen andere beurteilen, da mir die dafür notwendigen Sprachkenntnisse fehlen. Allerdings macht die Übersetzung insgesamt einen sorgfältigen und ausgewogenen Eindruck. Sie liegt inzwischen auch schon im Taschenbuch bei dtv vor.
Der schon erwähnte Anhang enthält sowohl einen klugen und zur historischen Einordnung des Buches hilfreichen Essay als auch umfangreiche Anmerkungen zu Einzelstellen, die nicht nur sachliche Erläuterungen liefern, sondern in Auszügen auch Stendhals spätere Selbstkritik des Romans dokumentieren. Ich hätte es für die Erst-Lektüre wohl hilfreicher gefunden, wenn man diese beiden Ebenen getrennt hätte; aber das ist eine Kleinigkeit.
Insgesamt kann die Ausgabe zur Erst- oder erneuten Lektüre des Romans unbedingt empfohlen werden. Überhaupt ist er nicht nur an sich ein Lesevergnügen, sondern stellt auch eine wichtige Stufe in der Entwicklung des modernen Romans dar. Julien Sorel ist fraglos ein Vorläufer Frédéric Moreaus, wenn Flaubert auch auf äußerere Dramatik weitgehend verzichtet. Dabei ist Stendhal sowohl gesellschaftlich als auch politisch deutlich reicher als Flaubert, ohne dabei die Psychologie und innere Dynamik seiner Figuren zu vernachlässigen. Um Julien Sorel entsteht ein erstaunlich reiches und detailliertes Bild der französischen Gesellschaft der Restauration am Fuße der Juli-Revolution 1830.
Für alle, die den Roman noch nicht kennen, eine echte Empfehlung, wenn man an der Literatur und/oder an der französischen Gesellschaft der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts interessiert ist.
Stendhal: Rot und Schwarz. Chronik aus dem 19. Jahrhundert. Herausgegeben und übersetzt von Elisabeth Edl. Lizenzausgabe. Frankfurt/M.: Büchergilde Gutenberg, 2004. Bedruckter Leinenband, Lesebändchen, 872 Seiten. 29,90 € (nur für Mitglieder der BG).