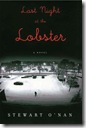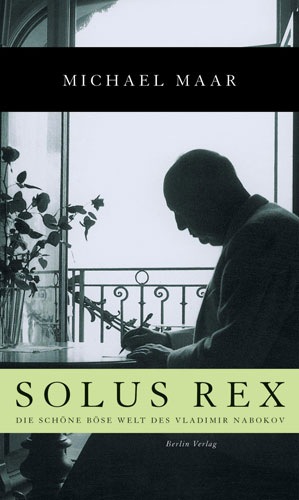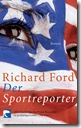 Als im vergangenen Jahr Die Lage des Landes erschien – der dritte Roman Richard Fords, in dem Frank Bascombe im Zentrum steht –, hatte ich mir vorgenommen, zuerst Der Sportreporter (1986) und dann noch einmal Unabhängigkeitstag (1995) zu lesen. Mit Unabhängigkeitstag hatte ich Richard Ford kennengelernt, allerdings liegt die Lektüre nun auch über zehn Jahre zurück und mehr als ein allgemeiner, wenn auch positiver Eindruck ist nicht geblieben. Danach hatte ich zwar noch Eifersüchtig gelesen, mir aber für eine weitere Lektüre Fords bislang keine Zeit genommen.
Als im vergangenen Jahr Die Lage des Landes erschien – der dritte Roman Richard Fords, in dem Frank Bascombe im Zentrum steht –, hatte ich mir vorgenommen, zuerst Der Sportreporter (1986) und dann noch einmal Unabhängigkeitstag (1995) zu lesen. Mit Unabhängigkeitstag hatte ich Richard Ford kennengelernt, allerdings liegt die Lektüre nun auch über zehn Jahre zurück und mehr als ein allgemeiner, wenn auch positiver Eindruck ist nicht geblieben. Danach hatte ich zwar noch Eifersüchtig gelesen, mir aber für eine weitere Lektüre Fords bislang keine Zeit genommen.
Der Sportreporter spielt am Osterwochenende 1984 hauptsächlich in New Jersey. Im Zentrum steht – wie bereits gesagt – Frank Bascombe, jetzt Sportjournalist, früher Schriftsteller, geschieden, zwei Kinder und derzeit locker mit einer Krankenschwester liiert. Der Roman beginnt mit einem morgendlichen Treffen Franks mit seiner ehemaligen Gattin X (lies: Ex) am Grab ihres gemeinsamen Sohnes Ralph, dessen Tod letztendlich der Auslöser zum Scheitern der Ehe war. Als sich die beiden kennenlernten, war Frank ein junger, erfolgreicher Schriftsteller, der gerade seine erstes Buch veröffentlicht hatte. Beide entschließen sich nach New Jersey zu ziehen, wo Frank einige Zeit braucht, um festzustellen, dass er sein zweites Buch, einen Roman, nicht schreiben kann oder will. Er nimmt ein Angebot an, für einen renommierte Sportzeitschrift zu arbeiten, und eine Zeit lang scheint alles gut zu gehen. Aber der Tod Ralphs stellt sowohl Frank als auch X’ Lebensentwürfe in Frage, und als X nach einem Einbruch ins Haus Briefe einer anderen Frau an Frank findet, lässt sie sich scheiden.
Inzwischen scheint Frank ein labiles Gleichgewicht in seinem Leben gefunden zu haben. Der Roman beschreibt nun eine Folge von Ereignissen an einem einzigen Wochenende, die dieses Gleichgewicht zum Wanken und Franks Leben wieder zum Fließen bringen. Es ist hier nicht nötig, das im Einzelnen hier nachzuerzählen, doch soviel sollte wohl gesagt werden, dass Franks Begegnungen mit ganz unterschiedlichen Menschen ihn zwar an der Oberfläche gleichgültig zurücklassen, in der Summe aber dazu führen, dass er am Sonntagabend eine kleine, spontane Entscheidung trifft, die sein Leben in der Konsequenz komplett verändert. Der Roman endet mit einem offenen Schluss, der förmlich auf eine Fortsetzung hin angelegt ist.
Das Buch ist in dem, was es erzählt, recht subtil. Viele Episoden erscheinen auf den ersten Blick zufällig, alle sind aber letztlich darauf kalkuliert, Franks aus seiner scheinbar unerschütterlichen Gelassenheit herauszubringen. Zugleich liefert Ford ein Porträt des alltäglichen Lebens und der »normalen« Menschen in der US-amerikanischen Provinz der 80er-Jahre. Dabei ist gerade die Normalität seines Protagonisten aufgesetzt: Frank Bascombe versucht sich allen Situationen anzupassen, den Erwartungen seiner Mitmenschen zu genügen, niemanden vor den Kopf zu stoßen. Doch das misslingt immer wieder, und sein Leben scheint mehr und mehr aus den Fugen zu geraten. Aber Frank behält bei alle dem einen klaren Kopf und vertraut seinem Gefühl, das ihn schließlich aus seiner inneren wie äußeren Stasis herausführt.
Ein verhalten optimistisches Buch, das Normalität und Alltäglichkeit thematisiert, ohne dabei einerseits langweilig oder andererseits zynisch zu werden.
Richard Ford: Der Sportreporter. Aus dem Amerikanischen von Hans Hermann. BVT 323. Berlin: Berliner Taschenbuch Verlag, 2006. 525 Seiten. 11,90 €.