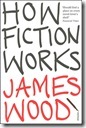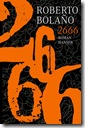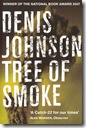Die Zeit verging.
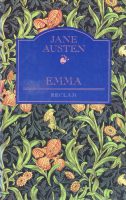 Bei „Emma“ handelt es sich um Austens längsten und – gemessen an ihrem eigenen Gesamtwerk – zugleich langweiligsten Roman. Für ihn spricht zwar der anspruchsvolle Versuch, beim Publikum mit einer negativen Heldin durchzukommen, aber Emmas Wandlung zur idealen Gattin im zweiten Teil des Romans verdirbt das ohnehin nur halbherzig unternommenen Experiment. Der Roman erschien 1815 und war die letzte Veröffentlichung Austens zu Lebzeiten; ihre letzten beiden Romane gab ihr Bruder Henry aus dem Nachlass heraus.
Bei „Emma“ handelt es sich um Austens längsten und – gemessen an ihrem eigenen Gesamtwerk – zugleich langweiligsten Roman. Für ihn spricht zwar der anspruchsvolle Versuch, beim Publikum mit einer negativen Heldin durchzukommen, aber Emmas Wandlung zur idealen Gattin im zweiten Teil des Romans verdirbt das ohnehin nur halbherzig unternommenen Experiment. Der Roman erschien 1815 und war die letzte Veröffentlichung Austens zu Lebzeiten; ihre letzten beiden Romane gab ihr Bruder Henry aus dem Nachlass heraus.
Erzählt werden einige Monate aus dem Leben von Emma Woodhouse. Emma unterscheidet sich von allen bisherigen Heldinnen Austens darin, dass sie zum einen wohlhabend ist – sie lebt in einem wohlversorgten Haushalt und ist die einzige Erbin ihres Vaters – und zum anderen keinerlei Ambitionen zu haben scheint zu heiraten. Damit Austen sich aber nicht zu weit von ihrem einzigen und zentralen Thema entfernt, pflegt Emma als Hobby die Eheanbahnung für andere, eine Tätigkeit, für die sie sich besonders begabt glaubt, in deren Verlauf sich ihr Mangel an Menschenkenntnis, Selbsterkenntnis und Bescheidenheit aber nur zu deutlich erweist. Doch unter dem Einfluss des unbestechlichen Mr. Knightley, der sie bereits seit ihren Kindertagen kennt, wandelt sich Emma zu einer hehren Lichtgestalt, bemerkt, dass sie – wie jede andere Frau – natürlich auch nichts anderes zum Lebensglück braucht als einen Ehemann und heiratet den unerträglich moralisierenden, zum Hintüberfallen aufrechten Mr. Knightley; sie hat auch nicht anderes verdient.
Es mag sein, dass Jane Austen selbst von dem Abziehbild, das ihre Fanny Price im Wesentlichen darstellt, so gelangweilt war, dass sie auf den Gedanken verfiel, ob es nicht möglich sei, einen Roman mit einer negativen Heldin zu schreiben. Emma wird also als absolutes Gegenteil gestaltet: reich, verwöhnt, eingebildet und zu selbstverliebt, um heiraten zu wollen. Woran Austen letztlich scheitert, ist, für diese neue Art von Heldin ein Schicksal zu erfinden, das sich ebenso radikal von der Schablone der zeitgenössischen Romane unterscheidet wie die Grundkonzeption der Protagonistin. Stattdessen liefert Austen einmal mehr eine vollständig geradlinige, vorhersehbare und kaum über ihre Konstruktion hinausreichende Fabel. Auch von ihrem Humor ist in diesem Roman wenig zu spüren, so dass es kein Wunder ist, dass dieser Roman mit großem Erfolg und Gwyneth Paltrow zu einer Seifenoper verarbeitet worden ist.
Jane Austen: Emma. Aus dem Englischen von Ursula und Christian Grawe. RUB 7633. Stuttgart: Reclam, 1996. Broschur, 560 Seiten. In dieser Ausgabe nicht mehr lieferbar. Lieferbare Ausgabe.