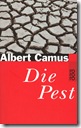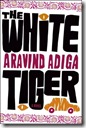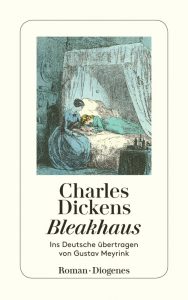Der dritte Roman des Zyklus, offensichtlich als direktes Pendant zu Die Beute entworfen. Im Fokus steht mit Florent ein angeheirateter Verwandter der Familie Rougon-Macquart; sein Halb-Bruder Quenu hat Lisa Macquart, eine Kusine Aristide Rougon-Saccards geheiratet, mit der zusammen er eine Metzgerei an den Pariser Markthallen betreibt. Florent ist Ende 1852 während der Unruhen in Paris verhaftet und auf die Teufelsinsel verbannt worden. Ihm gelingt es aber, von dort zu fliehen und nach Frankreich zurückzukehren. Mit seiner Rückkehr nach Paris setzt die Handlung ein.
Der dritte Roman des Zyklus, offensichtlich als direktes Pendant zu Die Beute entworfen. Im Fokus steht mit Florent ein angeheirateter Verwandter der Familie Rougon-Macquart; sein Halb-Bruder Quenu hat Lisa Macquart, eine Kusine Aristide Rougon-Saccards geheiratet, mit der zusammen er eine Metzgerei an den Pariser Markthallen betreibt. Florent ist Ende 1852 während der Unruhen in Paris verhaftet und auf die Teufelsinsel verbannt worden. Ihm gelingt es aber, von dort zu fliehen und nach Frankreich zurückzukehren. Mit seiner Rückkehr nach Paris setzt die Handlung ein.
Florent findet seinen Bruder rasch wieder und zieht bei ihm und seiner Schwägerin ein. Das ihm von Lisa angebotene Erbteil schlägt er vorerst aus und nimmt nach einigen Wochen auf Drängen Lisas die stelle eines Aufsehers in der Fischhalle an. Mit der Zeit kommt er in Kontakt mit einer Gruppe von Stammtisch-Revolutionären, was letzten Endes dazu führt, dass er erneut verhaftet und deportiert wird. Lisa sorgt damit, dass sie ihren Schwager bei der Polizei anzeigt, dafür, dass sie und ihr Mann unbeschadet aus der Affäre hervorgehen.
Wie oben bereits gesagt, wird hier das kleinbürgerliche Gegenstück zur großbürgerlichen Welt der Saccards geliefert. Die nahezu gänzlich auf das Gebiet der Markthallen konzentrierte Handlung präsentiert eine Welt aus kleinlichem Neid und verleumderischem Tratsch. Parallel dazu zeichnet Zola ein enzyklopädisches Porträt der Markthallen und ihres Angebots an Nahrungsmitteln: Gemüse, Obst, Fleisch, Fisch und Käse werden in erstaunlicher Breite vorgeführt; zahlreiche Nebengestalten erzeugen die Atmosphäre einer Kleinstadt in der Stadt. Die zugehörige impressionistisch-realistische Theorie wird durch die Gestalt des Malers Claude Lantier eingebracht, der Florent und den Leser in die visuelle Welt der Markthallen einführt.
Bei Zola kommt – im Gegensatz etwa zu den Tendenzen bei Fontane – das Kleinbürgertum durchaus nicht besser weg als das geldgierige Großbürgertum: Auch hier gibt es im Wesentlichen zwei Grundtypen: manipulative Intriganten und naive Opfer; hier und da existieren einzelne Ausnahmen, die aber den gesellschaftlichen Grundton nicht mitprägen, sondern als Außenseiter charakterisiert werden. Sowohl Lisa als auch ihrer Feindin Normande geht es am Ende nur um die egoistische Sicherung ihrer geschäftlichen Existenz, ganz gleich unter welcher Regierung oder in welchem politischen System. Der Slogan, Ruhe sei erste Bürgerpflicht, gilt für sie ebenso wie für ihre preußischen Klassengenossen. Die juristische Ungerechtigkeit und politische Unfreiheit, die das Schicksal Florents repräsentiert, interessieren sie nur, insoweit es ihre Geschäfte zu stören droht. Sowohl verwandtschaftliche Beziehung als auch die Liebe werden diesen privatökonomischen Interessen untergeordnet. Daher kann das den Roman beschließende Resümee Lantiers durchaus als Urteil Zolas gelesen werden:
»Was für Schurken, diese ehrbaren Leute!«
Übersichtsseite zur Rougon-Macquart
Émile Zola: Die Rougon-Macquart. Natur- und Sozialgeschichte einer Familie unter dem zweiten Kaiserreich. Hg. v. Rita Schober. Berlin: Rütten & Loening, 1952–1976. Digitale Bibliothek Bd. 128. Berlin: Directmedia Publ. GmbH, 2005. 1 CD-ROM. Systemvoraussetzungen: PC ab 486; 64 MB RAM; Grafikkarte ab 640×480 Pixel, 256 Farben; CD-ROM-Laufwerk; MS Windows (98, ME, NT, 2000, XP oder Vista) oder MAC ab MacOS 10.3; 256 MB RAM; CD-ROM-Laufwerk. 10,– €.