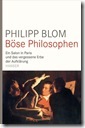Das letzte Wort zu alldem musste lauten, dass Mrs. Headway ein Quälgeist war.
 „Eine Dame von Welt“ heißt im Original “The Siege of London”, also Die Belagerung von London. Dass der Verlag eine solche Umbenennung für notwendig hielt, macht deutlich, dass James in Deutschland mittlerweile so unbekannt ist, dass man mit einer getreuen Übersetzung des Titels die Leser historischer Romane in die Irre zu leiten fürchtet. Ich vermute, dass es inzwischen in China eine Ausgabe von Thomas Manns „Der Zauberberg“ unter dem chinesischen Titel Das Sanatorium gibt, um die chinesischen Fantasy-Leser nicht zu verwirren. Einerseits ist eine solche Haltung in Zeiten eines immer breiteren und zugleich immer differenzierteren Buchmarktes verständlich (dazu gehört auch die hinzuerfundene Gattungsbezeichnung „Eine Salonerzählung“), andererseits nimmt die deutsche Ausgabe mit dieser Entscheidung dem intelligenteren Leser ein von James bewusst an den Anfang gesetztes Signal, um den Ton der Erzählung einschätzen zu können. Aber was nützt das beste Straßenschild, wenn es kaum wer als solches erkennt? Da kann man an derselben Stelle auch gleich eine Reklametafel aufstellen. Denn immerhin existiert ja noch die Straßenverkehrsordnung, wenn die auch kaum mehr wer kennt. „Das ist ein prächtiger Anfang! Wenn jeder nur erst wieder von Null ausgeht, da müssen die Fortschritte in kurzer Zeit außerordentlich bedeutend werden“, bemerkte Goethe zu Johann Daniel Falk am 17. April 1808. Wie rasch doch die unbedeutendsten Dinge zu vollständig nutzlosen Betrachtungen führen können.
„Eine Dame von Welt“ heißt im Original “The Siege of London”, also Die Belagerung von London. Dass der Verlag eine solche Umbenennung für notwendig hielt, macht deutlich, dass James in Deutschland mittlerweile so unbekannt ist, dass man mit einer getreuen Übersetzung des Titels die Leser historischer Romane in die Irre zu leiten fürchtet. Ich vermute, dass es inzwischen in China eine Ausgabe von Thomas Manns „Der Zauberberg“ unter dem chinesischen Titel Das Sanatorium gibt, um die chinesischen Fantasy-Leser nicht zu verwirren. Einerseits ist eine solche Haltung in Zeiten eines immer breiteren und zugleich immer differenzierteren Buchmarktes verständlich (dazu gehört auch die hinzuerfundene Gattungsbezeichnung „Eine Salonerzählung“), andererseits nimmt die deutsche Ausgabe mit dieser Entscheidung dem intelligenteren Leser ein von James bewusst an den Anfang gesetztes Signal, um den Ton der Erzählung einschätzen zu können. Aber was nützt das beste Straßenschild, wenn es kaum wer als solches erkennt? Da kann man an derselben Stelle auch gleich eine Reklametafel aufstellen. Denn immerhin existiert ja noch die Straßenverkehrsordnung, wenn die auch kaum mehr wer kennt. „Das ist ein prächtiger Anfang! Wenn jeder nur erst wieder von Null ausgeht, da müssen die Fortschritte in kurzer Zeit außerordentlich bedeutend werden“, bemerkte Goethe zu Johann Daniel Falk am 17. April 1808. Wie rasch doch die unbedeutendsten Dinge zu vollständig nutzlosen Betrachtungen führen können.
Wie so oft bei James ist es nicht einfach zu entscheiden, wessen Geschichte eigentlich erzählt wird. Es beginnt mit einer Begegnung der beiden US-Amerikaner George Littlemore und Rupert Waterville mit Nancy Headway in der Pariser Comédie Française. Littlemore kennt Nancy aus seiner Zeit im Westen der USA; damals hieß sie noch Nancy Beck, und seit damals hat sie einige Ehen hinter sich gebracht. Nachdem sie mit dem Versuch, in die New Yorker High Society aufgenommen zu werden, gescheitert ist, versucht sie jetzt ihr Glück in London. Zu diesem Zweck hat sie dem deutlich jüngeren Sir Arthur Demesne den Kopf verdreht, den sie zu heiraten gedenkt, wenn er sich denn dazu bringen lässt. Dem steht im Wesentlichen seine Mutter im Weg, die den Verdacht hegt, Mrs. Headway sei nicht gesellschaftsfähig, es aber nicht nachweisen kann. Sie versucht sowohl Waterville, der für die US-Botschaft in London arbeitet, als auch Littlemore die entsprechenden Informationen zu entlocken. Littlemore, der mit der ganzen Sache eigentlich nichts zu tun haben will, knickt schließlich ein und bestätigt Lady Demesnes Verdacht. Doch es ist zu spät: Nancy ist bereits verlobt mit Sir Arthur und setzt sich gegen die Mutter letztlich durch.
Der moralische Konflikt ist interessanterweise der Littlemores: Nancy ist eine rücksichtslose Karrieristin, die schlicht versucht, ihre Interessen durchzusetzen; sie betrachtet das Normensystem der besseren Gesellschaft und seine Vertreter schlicht als Gegner, gegen die es sich durchzusetzen gilt. Waterville dagegen will als Vertreter des Normensystems erscheinen, ist aber nicht bereit, die daraus folgenden Konsequenzen zu ziehen: Von Lady Demesne nach der Vergangenheit von Nancy Headway befragt, windet er sich aus der Verantwortung heraus, obwohl er sie moralisch ebenso verurteilt wie die Fragestellerin oder seine Mutter oder Schwester. Littlemore schließlich, der das ganze als eine Art oberflächlichen Spiels ansieht und auf dem Standpunkt steht, dass Nancy jedes Recht hat zu versuchen, sich gegen den Widerstand der Gesellschaft durchzusetzen, ist derjenige, der Lady Demesne am Ende das liefert, was sie braucht. Er tut dies in dem Wissen, dass eine Verlobung bereits stattgefunden hat, und in der Überzeugung, dass seine Antwort wahrscheinlich nichts mehr ändern wird. Dennoch ist er es, der als einziger der moralischen Forderung nach Wahrhaftigkeit im Umgang miteinander nachkommt. Ob Lady Demesne einen Anspruch auf diese Wahrhaftigkeit erheben kann, bleibt dabei ebenso ungeklärt wie die Frage, ob das moralische Urteil, das sich die High Society über Nancy Headway anmaßt, berechtigt ist oder nicht.
Hält man diese distanzierte Haltung des Erzählers mit dem historisierenden Originaltitel zusammen, bekommt man einen Eindruck von der über dem Ganzen der Erzählung liegenden Ironie: James erzählt diese Episode, als würde sie beispielsweise am Hofe Heinrich VIII. spielen, und er hält sie in ihren moralischen Konsequenzen wahrscheinlich für ähnlich relevant, als hätte sie sich dort abgespielt. Nimmt man allerdings an, die Erzählung sei eine Salonerzählung und handle von einer Dame von Welt, könnte dies im Einzelfall beim Leser zu einem ganz grundsätzlichen Missverständnis führen. Doch die Hauptsache ist natürlich, dass der Vertrieb zufrieden ist.
Ergänzt wird der Band durch einen Essay von Henry James, indem er unter anderem über eines der Vorbilder der Erzählung, Alexandre Dumas’ Komödie „Le Demi-Monde“, schreibt.
Henry James: Eine Dame von Welt. Eine Salonerzählung. Aus dem Englischen von Alexander Pechmann. Berlin: Aufbau, 2016. Flexibler Leinenband mit Banderole, Lesebändchen, 176 Seiten. 16,95 €.