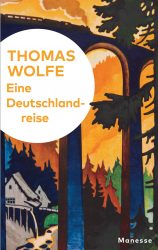Seit dem Einsturz der Dämme und seit sie Joseph nicht mehr schlug, schlug die Mutter Suzanne viel öfter als vorher. »Wenn sie niemand mehr hat, dem sie Prügel austeilen kann«, sagte Joseph, »wird sie sich selbst in die Fresse hauen.«
Ich muss gestehen, dass ich erst durch eine ARTE-Dokumentation auf Marguerite Duras gestoßen wurde. Sicherlich war sie mir dem Namen nach bekannt, aber ich hatte kaum eine Vorstellung von ihrer Literatur. Wahrscheinlich hat auch der deutsche Titel ihres berühmtesten Werks, das im Original Un barrage contre le Pacifique (Ein Damm gegen den Pazifik) heißt, dazu beigetragen, der mit Heiße Küste denkbar nichtssagend daherkommt. Erst die Dokumentation machte mir die Bedeutung dieses Buches in der Diskussion des Kolonialismus in Frankreich deutlich. Duras, so darf man wohl sagen, war allein dafür verantwortlich, dass sich ein bedeutender Teil der französischen Bevölkerung im Jahr 1950 erstmals kritisch mit den Zuständen in den Kolonien, insbesondere in Französisch-Indochina auseinandergesetzt hat.
Duras wurde 1914 in der Nähe von Saigon geboren; ihr Roman spielt wohl Anfang der 30er-Jahre an der Pazifikküste Kambodschas. Im Zentrum steht eine Familie, die aus einer namenlosen Mutter, dem 20-jährigen Sohn Joseph und der 17-jährigen Tochter Suzanne besteht. Die Mutter ist in Frankreich aufgewachsen und als junge Lehrerin zusammen mit ihrem Mann in die Kolonie ausgewandert. Nachdem ihr Mann gestorben ist, hat sie ihre Familie mit Klavierspielen und -unterricht über Wasser gehalten; sie war sogar in der Lage, soviel zu sparen, dass sie eine Konzession auf eine Farm erwerben konnte, auf der die Familie nun lebt. Leider erweist sich der Großteil des erworbenen Landes als unbebaubar, da es jährlich vom Pazifik überflutet wird. Nachdem sich die Mutter vergeblich beim zuständigen Katasteramt beschwert hat, organisiert sie zusammen mit einheimischen Bauern den Bau eines Dammes gegen den Pazifik, der aber schon im ersten Jahr unterspült wird und zusammenbricht. Seitdem lebt die Familie in ärmlichen Verhältnissen auf der mit Hypotheken belasteten Farm. Die Hoffnung darauf, noch einmal einen kräftigeren Damm errichten und damit doch noch über die überwältigende Natur siegen zu können, ist es, was die offenbar herzkranke Mutter am Leben hält.
Den eigentlichen Erzählanlass bildet eine in diese Verhältnisse einschneidende Änderung: Beim Besuch im nächsten Dorf fällt Suzanne dem Sohn eines reichen Kaufmanns und Kautschuk-Farmers aus dem Norden des Landes auf, dessen Ziel es über die nächsten 100 Seiten ist, mit Suzanne zu schlafen, was nicht nur durch Suzannes Gleichgültigkeit ihm gegenüber verhindert wird, sondern auch durch die Mutter, die ihre Tochter mit diesem Herrn Jo zu verheiraten und damit ihre Familie aus der Krise zu retten gedenkt. Herr Jo ist sich aber darüber im Klaren, dass sein Vater einer Hochzeit mit Suzanne niemals zustimmen würde, doch kann er sich von seiner Begierde nach dem Mädchen nicht losmachen und ist am Ende so von seiner Leidenschaft regiert, dass er Suzanne einen Diamantring seiner Mutter schenkt, der – wenigstens seiner Aussage nach – 20.000 Francs wert sein soll. Kurz nachdem sie diesen Ring geschenkt bekommen hat, teilt Suzanne Herrn Jo denkbar trocken mit, dass seine Besuche nicht weiter erwünscht seien.
Der Anfang des zweiten Teils des Romans spielt in der nächstgelegenen Provinzstadt – vielleicht Kampot –, wo die Mutter versucht, den Ring für den ihr genannten Preis zu verkaufen. Der Diamant weist allerdings einen Einschluss auf, so dass die Händler nur etwa die Hälfte des Preises zu zahlen bereit sind. Für die Mutter aber liegt in den 20.000 Franc die Hoffnung auf die Fortsetzung ihres Damm-Projektes, so dass sie zu keinem niedrigeren Preis verkaufen will. Während sie von Händler zu Händler läuft, beginnt Joseph eine leidenschaftliche Affäre mit einer verheirateten Frau, während Suzanne durch die Oberstadt streift und das Kino besucht. Am Ende gelingt es Joseph nicht nur, den Ring zum Wunschpreis an seine Geliebte zu verkaufen, er findet ihn zu seiner eigenen Überraschung auch in seiner Jackentasche wieder, als er mit Mutter und Schwester zur Farm zurückkehrt. Die Mutter hat das gerade erworbene Geld zur Tilgung eines Teils ihrer Schulden zur Bank getragen, muss dort aber feststellen, dass ein Großteil des Geldes von den aufgelaufenen Zinsen aufgefressen wird und sie von der Bank keinerlei neuerlichen Kredit erwarten darf. Mit der Rückkehr zur Farm beginnt der letzte und destruktivste Teil des Buches; aber das soll jede und jeder selbst lesen.
Das Buch ist tief getränkt von den persönlichen Erfahrungen der Autorin, erschöpft sich aber durchaus nicht in dieser autobiographischen Ebene. Im Gegenteil erweist sich das Projekt der Mutter als zentrale Allegorie des Textes, sie selbst als die eigentlich bestimmenden Figur, wenn auch nahezu gleichgewichtig die Coming-of-age-Geschichte Suzannes erzählt wird. Selbst an den Stellen, an denen die Fiktion nicht wirklich trägt – so etwa wenn Joseph Suzanne von seiner Affäre erzählt – ist der Stoff des Romans immer überzeugend und ursprünglich. Er lebt nicht nur von den zerrütteten Verhältnissen der Familie, sondern auch von der Schilderung der gesellschaftlichen Strukturen der Kolonie sowie der Armut und des Elends der einheimischen Bevölkerung. Ein in hohem Grad authentisches und zugleich literarisches Buch, wie man es nur selten findet.
Marguerite Duras: Heiße Küste. Aus dem Französischen von Georg Goyert. st 1581. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 62009. Broschur, 281 Seiten. 4,95 €.