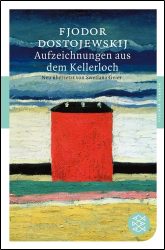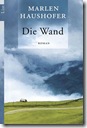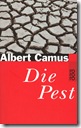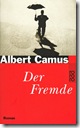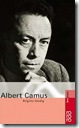Zum vorläufigen Abschluss meiner Dostojewskij-Lektüre noch einmal eine Rückkehr fast ganz zum Anfang: Im Januar 2019 hatte ich hier die vor der Reihe der letzten sechs Romane entstandenen Aufzeichnungen aus dem Kellerloch in der damals aktuellsten Übersetzung Swetlana Geiers besprochen. Dieser vergleichsweise kurze Text, der eine Mischung aus essayistischer Reflexion und fiktiver autobiografischer Erinnerung des Erzähler liefert, war bei seinem Erscheinen nur wenig beachtet worden und wurde in seiner Bedeutung als thematische Vorschule zahlreicher Themen, die dann in den „fünf Elefanten“ entfaltet werden sollten, erst viel später begriffen. Ich selbst habe es als die Eröffnung des psychologischen Labors Dostojewskijs bezeichnet.
Im Jubiläumsjahr legt nun Manesse in seiner Bibliothek eine Neuübersetzung des Textes durch Ursula Keller vor. Zum Inhalt des Buches sei auf die frühere Besprechung verwiesen; das muss hier nicht wiederholt werden. Was Stil und Wortwahl angeht, unterscheiden sich die beiden Übersetzungen allerdings deutlich. Gleich auf den ersten Blick erscheint die Übersetzung Kellers oft konkreter und bildhafter im Ausdruck:
Ich bin ein kranker Mensch … Ich bin ein böser Mensch. Ein abstoßender Mensch bin ich. Ich glaube, meine Leber ist krank. Übrigens habe ich keinen blassen Dunst von meiner Krankheit und weiß gar nicht mit Sicherheit, was an mir krank ist. Für meine Gesundheit tue ich nichts und habe auch nie etwas dafür getan, obwohl ich vor der Medizin und den Ärzten alle Achtung habe. Zudem bin ich noch äußerst abergläubisch, so weit z. B., daß ich vor der Medizin alle Achtung habe. (Ich bin gebildet genug, um nicht abergläubisch zu sein, aber ich bin abergläubisch.) Nein, meine Herrschaften, wenn ich für meine Gesundheit nichts tue, so geschieht das nur aus Bosheit. Sie werden sicher nicht geneigt sein, das zu verstehen. Nun, meine Herrschaften, ich verstehe es aber. Ich kann Ihnen natürlich nicht klarmachen, wen ich mit meiner Bosheit ärgern will, ich weiß auch ganz genau, daß ich nicht einmal den Ärzten dadurch schaden kann, daß ich mich nicht von ihnen behandeln lasse; ich weiß am allerbesten, daß ich damit einzig und allein mir selbst schade und niemandem sonst.
Geier, S. 7 f.
Und dennoch, wenn ich nichts für meine Gesundheit tue, so geschieht es aus Bosheit, und ist die Leber krank, dann mag sie noch ärger krank werden!
Ich bin ein kranker Mensch … Ich bin ein zorniger Mensch. Ein hässlicher Mensch bin ich. Ich glaube ich bin leberkrank. Eigentlich habe ich nicht die geringste Ahnung, woran ich erkrankt bin, und weiß nicht einmal sicher, worunter ich leide. Ich bin nicht in Behandlung und war auch nie in Behandlung, obwohl ich Medizin und Ärzten Respekt entgegenbringe. Zugleich bin ich über die Maßen abergläubisch; nun, wenigstens so sehr, dass ich der Medizin Respekt entgegenbringen. (Ich bin gebildet genug, um nicht abergläubisch zu sein, und doch bin ich abergläubisch.) Nein, mit Verlaub – ich will mich aus reinem Trotz nicht in Behandlung begeben. Und genau das werden sie wohl nicht verstehen wollen. Nun, aber ich verstehe es. Ich vermag Ihnen, selbstredend, nicht zu erklären, wem ich mit diesem Trotz das Leben schwer machen; ich weiß sehr genau, dass ich den Ärzten ja damit, dass ich nicht bei ihnen in Behandlung bin, «keinen Haufen vor die Tür» setze; ich weiß selbst am besten, dass sich mit alledem nur mir ganz allein schade und niemandem sonst. Und trotzdem – wenn ich nicht in Behandlung bin, so ist das reiner Trotz. Die Leber ist krank, soll sie doch noch kränker werden!
Keller, S. 9 f.
Von der Frage des zusätzlichen bzw. fehlenden Absatzes abgesehen, erscheint es schon als deutlicher Unterschied, ob der Erzähler sich aus Bosheit oder Trotz der ärztlichen Behandlung verweigert, ob er den Ärzten dadurch nicht schadet oder ihnen keinen Haufen vor die Tür setzt. Solche Unterschiede finden sich kontinuierlich durch den ganzen Text hindurch, begleitet von weiteren seltsamen Phänomenen wie zum Beispiel Klammern, die an unterschiedlichen Stellen des Textes geschlossen werden. Leider hindert mich meine Unkenntnis des Russischen daran, mehr zu tun, als auf diese durchaus eklatanten Unterschiede hinzuweisen. Ein kritisches Urteil muss andernorts gefällt werden. (Für Hinweise auf ein kompetentes Urteil sei gleich hier im Voraus gedankt!)
Wenigstens muss der Neuübersetzung von Ursula Keller attestiert werden, dass sie den Text an zahlreichen Einzelstellen und im Ganzen verständlicher und differenzierter zu übersetzen scheint, dass die durchweg außergewöhnlichen Gedankengänge des Erzählers in ihr weniger obskur und dunkel erscheinen.
Fjodor M. Dostojewski: Aufzeichnungen aus dem Untergrund. Aus dem Russischen von Ursula Keller. München: Manesse, 2021. Pappband, Fadenheftung, Lesebändchen, 312 Seiten. 25,– €.