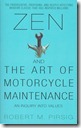Alles weitere geschieht im Hauptquartier …
 Benjamin Stein beweist sich, wie bereits zuvor mit »Die Leinwand«, einmal mehr als Autor außergewöhnlicher Erzählperspektiven. Und wie dort, so ist es auch hier wieder schwierig, das Buch ohne Spoiler zu rezensieren. Die Handlung spielt in einer nicht so weit entfernten Zukunft, in der zumindest in den USA das Goldene Informationszeitalter Wirklichkeit geworden ist. Im Zentrum der Entwicklung dorthin stand der Ich-Erzähler Ed Rosen, der mit einer körperlichen Behinderung geboren wurde: Er ist auf einem Auge blind, wodurch ihm eine Dimension des Sehens fehlt. Während seiner religiösen Ausbildung von kabbalistischer Zahlenmystik fasziniert, studiert er Informatik und spezialisiert sich auf das Proben der digitalen Repräsentation der Wirklichkeit. Nach dem Studium beginnt er bei der kleinen, aber feinen Silicon-Valley-Firma Juan Matanas, eines Exil-Chilenen, der sich für das Problem der Schnittstelle zwischen biologischen und elektronischen Systemen interessiert. Ed Rosen wird für ihn nicht nur zu einem wertvollen Mitarbeiter, sondern aufgrund seiner Behinderung auch zur ersten Versuchsperson bei dem Experiment, die Daten einer elektronischen Prothese direkt ins menschliche Gehirn einzuspeisen.
Benjamin Stein beweist sich, wie bereits zuvor mit »Die Leinwand«, einmal mehr als Autor außergewöhnlicher Erzählperspektiven. Und wie dort, so ist es auch hier wieder schwierig, das Buch ohne Spoiler zu rezensieren. Die Handlung spielt in einer nicht so weit entfernten Zukunft, in der zumindest in den USA das Goldene Informationszeitalter Wirklichkeit geworden ist. Im Zentrum der Entwicklung dorthin stand der Ich-Erzähler Ed Rosen, der mit einer körperlichen Behinderung geboren wurde: Er ist auf einem Auge blind, wodurch ihm eine Dimension des Sehens fehlt. Während seiner religiösen Ausbildung von kabbalistischer Zahlenmystik fasziniert, studiert er Informatik und spezialisiert sich auf das Proben der digitalen Repräsentation der Wirklichkeit. Nach dem Studium beginnt er bei der kleinen, aber feinen Silicon-Valley-Firma Juan Matanas, eines Exil-Chilenen, der sich für das Problem der Schnittstelle zwischen biologischen und elektronischen Systemen interessiert. Ed Rosen wird für ihn nicht nur zu einem wertvollen Mitarbeiter, sondern aufgrund seiner Behinderung auch zur ersten Versuchsperson bei dem Experiment, die Daten einer elektronischen Prothese direkt ins menschliche Gehirn einzuspeisen.
Wie man sich leicht denken kann, löst das Gelingen dieses Projekts eine technische und kulturelle Revolution aus: Die Lösung des prinzipiellen Problems der digitalen/biologischen Schnittstelle eröffnet nur zu sehr geahnte Möglichkeiten der heraufziehenden Informationsgesellschaft. Alles weitere muss man selbst nachlesen.
Der Text ist ein kleines Meisterwerk: Nicht nur ist er motivisch beeindruckend dicht gearbeitet, er ist mit seinem naiven Erzähler und seinem harmlos optimistischen Auftakt auch von einer ebenso luziden wie boshaften Ironie, wie sie sich in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur nur sehr selten finden lässt. In diesem Sinne sei allen Lesern unbedingt angeraten, sich von der scheinbar ziellos dahintreibenden Geschichte der ersten Hälfte des Buches nicht täuschen zu lassen; sie ist die notwendige Folie für das letztendlich sich ergebende Gesamtbild. Überhaupt kann man die erste Hälfte des Buches erst richtig würdigen, wenn man sie mit dem Wissen um das Ganze zum zweiten Mal liest.
Benjamin Stein ist es mit »Replay« nicht nur gelungen, einen würdigen Nachfolger für »Die Leinwand« zu schreiben, sondern auch ein zeitgemäßes und notwendiges Gegenstück zu Orwells »1984«.
Benjamin Stein: Replay. München: Beck, 2012. Pappband, 173 Seiten. 17,95 €.
P.S.: Inzwischen gibt es auch einen Filmtrailer zum Buch: