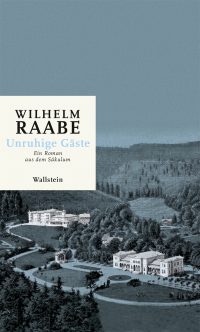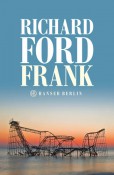Eine fatale Geschichte! wahrhaftig, eine nette Dorfidylle!
„Unruhige Gäste“ ist ein später, kurzer Roman Wilhelm Raabes und wurde 1885 im populären Familienblatt „Die Gartenlaube“ in zwölf Folgen veröffentlicht; im Jahr darauf erschien die Buchausgabe bei Grote in Berlin. Mit der Fortsetzungsausgabe erreichte der „Roman aus dem Säkulum“ – so die vom Autor gewählte Genrebezeichnung – ein für Raabe vergleichsweise breites Publikum, das den Roman anfänglich zumeist positiv aufnahm, mit dem Ende aber nicht recht zufrieden war; ich werde noch darauf zurückkommen.
Die Handlung spielt in den 1880er Jahren in einem Minendorf im Harz und einem im Tal darunter gelegenen Kurort, für den offenbar Bad Harzburg das Vorbild war. Über den Charakter des Städtchens als Badeort macht sich Raabe, der Bad Harzburg aus eigenem Erleben kannte, ein wenig lustig:
Dieser beliebte Badeort für Gesunde hatte selten eine so gute Gesellschaft wie diesmal um seine unschädlichen Quellen versammelt gesehen.
S. 90
Zu dieser guten Gesellschaft gehört auch eine Gruppe um Professor Freiherr Veit von Bielow, der das Bad offenbar mit seiner Verlobten in spe Valerie, deren Vater und einer Gruppe von jungen Leuten besucht. Beim Ausflug in das in den Bergen gelegene Dorf macht er einen Abstecher ins Pfarrhaus, um dort seinen ehemaligen Kommilitonen, den in Gott verbitterten Pastor Prudens Hahnemeyer aufzusuchen, den er seit der Studienzeit nicht mehr gesehen hat. Hahnemeyer lebt zusammen mit seiner Schwester Phöbe, einer 20-jährigen Lehrerin und Krankenpflegerin, die sich in der Gemeinde und im Pfarrhaus nützlich macht. Den eigentlichen Erzählanlass bildet der Tod von Anna Fuchs, die gerade an dem Tag stirbt, als von Bielow im Dorf eintrifft. Anna Fuchs war am Typhus erkrankt und wurde zusammen mit ihrem im Dorf ohnehin nur mäßig beliebten Mann Volkmar und ihren beiden Kindern zu einer ärmlichen Existenz in einer notdürftigen Hütte am Dorfrand gezwungen. Nun will man die Tote möglichst rasch unter die Erde bringen, doch Volkmar in seiner Trauer und seinem Zorn auf die Gemeinde verweigert die Herausgabe der Toten, die er lieber im Wald verscharren will, als es zuzulassen, dass sie zusammen mit jenen, die sie verachtet haben, auf einem Friedhof liegen soll.
Es gibt nun mehrere Versuche, Fuchs zur Vernunft zu bringen, die aber alle scheitern: Weder die Drohungen des Ortsvorstehers, noch die Ermahnungen des Pastors helfen; erst als Phöbe, die sich aufopferungsvoll um die Kranke gekümmert hatte, zusammen mit von Bielow noch einmal die Hütte aufsucht, gelingt der Durchbruch, als von Bielow spontan anbietet, drei nebeneinanderliegende Grabstellen zu erwerben, in denen Anna – in der Mitte – bewacht von Phöbe und ihm selbst die letzte Ruhe finden soll. Völlig überrascht und überwältigt von der Zustimmung Volkmars zu diesem Vorschlag, erklärt sich auch Phöbe einverstanden. Nach der Beerdigung geht von Bielow wieder hinab in den Kurort zu der Gesellschaft, zu der er gehört.
Damit beginnt die zweite Hälfte des Romans, in deren Zentrum die Erkrankung von Bielows am Typhus steht. Wieder im Kurort angekommen, muss von Bielow sehr rasch und gegen seinen Willen die Geschichte um das Begräbnis der Anna Fuchs und der dreifachen Grabstelle erzählen. Valerie ist von dieser Festlegung von Bielows auf eine letzte Ruhestätte so betroffen und in Furcht versetzt, dass sie selbst hinauf ins Dorf reitet, Volkmar und Phöbe – in der sie eine Konkurrentin um die Liebe von Bielows zu haben fürchtet – kennenlernt und sich den Friedhof zeigen lässt. Es kommt zu einer Art von Aussprache zwischen den beiden Frauen, und als Valerie abends ins Tal zurückkommt, muss sie erfahren, dass inzwischen von Bielow selbst an Typhus erkrankt ist.
Merkwürdigerweise wird nun nicht das Klischee umgesetzt, dass sich Valerie am Krankenbett Veits zum großen, entsagenden Vorbild der Phöbe hinauf arbeitet, sondern ganz in Gegenteil flieht die Gesellschaft um Valerie den Kurort, von Bielow wird in ein aufgelassenes Siechenspital am Rande des Städtchens verbannt und dort vom lokalen Doktor, Phöbe und Dorette – einer spät eingeführten, aber nichts weniger als unbedeutenden Nebenfigur – gepflegt. Nur dass Veit von Bielow dem Tod entgeht und nach einer Woche Phöbe wieder ins Pfarrhaus zurückkehrt, wird uns erzählt. Und dann schließt Raabe einen ganz merkwürdigen Schluss an: Im nächsten Frühjahr erreichen das Pfarrhaus zwei Briefe. Zum einen von Dorette an Phöbe, in dem ein schlichtes Gemüt die Erlebnisse der Woche der Pflege von Bielows und die Freundschaft der beiden Frauen reflektiert. Zum anderen von dem in Sizilien sich nur langsam erholenden Veit von Bielow und seiner Gattin Valerie, die ihre Flitterwochen zu einem Genesungsurlaub verlängert haben.
Wer die Romane kennt, die im Umfeld um „Unruhige Gäste“ entstanden, wird begreifen, dass ein Gutteil der Leser der „Gartenlaube“ mit einem solchen Ende nur wenig zufrieden sein konnten. Weder wird der durch die Flucht Valeries inszenierte Konflikt auch nur angesprochen, sondern die beiden werden einfach verheiratet, noch findet die aufopferungsvolle Liebe Phöbes, die durch die Persönlichkeit von Bielows doch für den Moment heftig aus dem Gleichgewicht geraten war, eine Auflösung. Stattdessen wird Volkmar Fuchs zu einem angesehenen Mitglied der Gemeinde, nachdem er – offenbar durch die Protektion von Valeries Vater – zu einer Anstellung als Forstwart gekommen ist. Aber eine der üblichen, kunstfertigen Abrundungen darf von Raabe im Ernst nicht erwartet werden.
Neben dem hier Nacherzählten hat der Roman noch die eine und andere knorrige Nebenfigur, wie man sie ähnlich nur in den Romanen von Charles Dickens finden wird. Für seine nur knapp 180 Seiten macht das Buch ein erstaunlich breites Gesellschaftspanorama auf. Und es enthält viel von der Welt, wie sie sich Raabe gezeigt hat.
Jeder für den Mist vor seine Kellerlöcher, und unser Herrgott fürs Ganze!
S. 158
Wilhelm Raabe: Unruhige Gäste. Ein Roman aus dem Säkulum. In: Werke. Kritische kommentierte Ausgabe. Göttingen: Wallstein, 2024. Pappband, Fadenheftung, 235 Seiten. 26,– €.