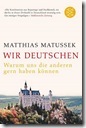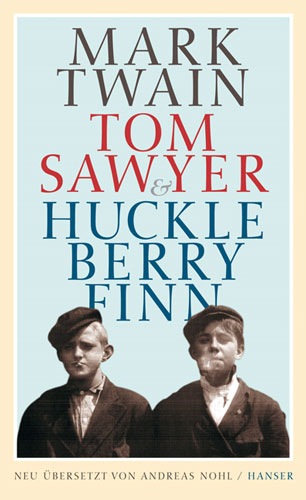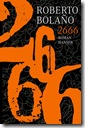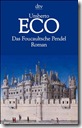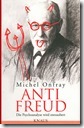 Ich habe mich sehr schwer getan, zu diesem Buch etwas zu schreiben, auch überlegt, ob ich es nicht einfach stillschweigend übergehen sollte, da es ein sehr schlechtes Buch ist und ich die Lektüre nach 150 Seiten eingestellt habe, weil kein neuer, geschweige denn ein origineller Gedanke mehr zu erwarten war. Ich selbst bin als Fachmann für Arno Schmidt auch ein halber, vielleicht auch nur ein drittel Fachmann für Freud geworden, weshalb mich die Auseinandersetzung mit ihm immer noch interessiert, während mir der Rest der psychoanalytischen Literatur inzwischen weitgehend gleichgültig ist.
Ich habe mich sehr schwer getan, zu diesem Buch etwas zu schreiben, auch überlegt, ob ich es nicht einfach stillschweigend übergehen sollte, da es ein sehr schlechtes Buch ist und ich die Lektüre nach 150 Seiten eingestellt habe, weil kein neuer, geschweige denn ein origineller Gedanke mehr zu erwarten war. Ich selbst bin als Fachmann für Arno Schmidt auch ein halber, vielleicht auch nur ein drittel Fachmann für Freud geworden, weshalb mich die Auseinandersetzung mit ihm immer noch interessiert, während mir der Rest der psychoanalytischen Literatur inzwischen weitgehend gleichgültig ist.
Um das Buch angemessen zu rezensieren, ist es leider notwendig, zuvor einige Sätze zu meiner eigenen Position in der Sache zu schreiben, damit man meine Kritik an Onfray nicht als ein Plädoyer für die Psychoanalyse missversteht. Die Psychoanalyse Sigmund Freuds ist eine der bedeutendsten Begründungen einer Weltanschauung (um nicht Religion zu schreiben) des 20. Jahrhunderts. Das in ihr implizit und explizit zum Ausdruck kommende Menschenbild hat einen nicht zu unterschätzenden weltweiten Einfluss auf die Kulturentwicklung gehabt, und niemand kann hoffen, die Entwicklung der westlichen Kultur in den letzten gut 100 Jahren zu verstehen, wenn er diesen Einfluss zu ignorieren versucht. In Freuds Denken fokussieren sich bedeutende geistige Strömungen des 19. Jahrhunderts: die Säkularisierung der Kultur, die Verbreitung atheistischen Denkens, der naive Glaube an die Erklärungsmächtigkeit rationaler Wissenschaft, das romantische Bewusstsein vom notwendig widersprüchlichen Charakter unseres Selbst und nicht zuletzt die Einsicht, dass es sich beim Bild vom Menschen als autarkem Herrn im eigenen Haus um eine weit verbreitete Selbsttäuschung handelt. Das Freudsche und in der Folge dann psychoanalytische Menschenbild im Allgemeinen hat das von Christentum und Humanismus geprägte der Neuzeit soweit gewandelt und aufgelöst, dass grundlegende Thesen der Psychoanalyse heute so weit zum selbstverständlichen und weitgehend popularisierten Grundbestand der westlichen Kultur gehören, dass sich selbst prinzipiell konkurrierende Glaubenssysteme (wie etwa das Christentum) dem anzupassen gezwungen sind.
Dies ist allerdings nicht der einzige Aspekt, unter dem die Psychoanalyse zu betrachten ist: Wie die meisten Weltanschauungen enthält auch die Psychoanalyse ein Heilsversprechen. In ihrem Fall ist dies erst sekundär ein gesellschaftliches oder soziales, primär ist es eines, das auf das Individuum zielt. Die Psychoanalyse versteht sich selbst in erster Linie als Therapie, und ihr wichtigstes Kriterium für die Richtigkeit des eigenen Menschen- und Weltbildes ist der therapeutische Erfolg. (Ob sich ein solcher nachweisen lässt oder nicht, ist eine so komplexe Frage, das sie hier nicht thematisiert werden kann.)
Dass es sich bei der Psychoanalyse nicht um eine Wissenschaft in dem Sinne handelt, wie sich dieser Begriff in den letzten beiden Jahrhunderten herausgemendelt hat, ist – auch entgegen den Ansprüchen einiger ihrer Adepten – offensichtlich und durch die Arbeiten von Wissenschaftstheoretikern wie Adolf Grünbaum hinreichend eindeutig nachgewiesen worden. Insbesondere die freie und freizügige Verwendung der logischen Negation, durch die in der psychoanalytischen Interpretation am Ende beinahe alles beinahe alles andere bedeuten kann, desavouiert die psychoanalytische Methode in den Augen empirischer Wissenschaftler. Im Gegensatz zu ihrem weit verbreiteten Selbstverständnis untersucht die Psychoanalyse nicht empirisch vorhandene Phänomene, sondern sie erzeugt wesentlich den Gegenstand ihrer Untersuchung im Vollzug dieser Untersuchung selbst. Sie ist daher – und bereits Sigmund Freud wusste dies sehr genau – eher eine historische als eine empirische Wissenschaft. Als Gegengewicht zu dieser sehr grundsätzlichen Kritik sollte man sich allerdings an die Einsicht des Aristoteles erinnern, dass von jeder Wissenschaft nur jener Grad von Genauigkeit erwartet werden sollte, den der behandelte Gegenstand tatsächlich hergibt (Nikomachische Ethik, 1094b).
Nach diesem ungewöhnlich langen Vorwort nun endlich zu Michel Onfrays Buch. Onfrays Kritik an Freud ist kein Versuch einer objektiven Einschätzung des wissenschaftlichen Anspruchs seiner Theorie oder ihrer Rolle in der Kultur des 20. Jahrhunderts. Vielmehr handelt es sich um eine Polemik, die versucht, Freuds Person zu verleumden und dadurch seine Theorie zu entwerten. Zu diesem Zweck wiederholt Onfray etwa alle fünf Seiten seine Behauptung, dass Freud seine Theorie zum einen hauptsächlich bei Nietzsche abgeschrieben habe, zum anderen aus seiner persönlichen psychischen Disposition abgeleitet und verallgemeinert habe. Diese Verallgemeinerung sei unzulässig, da Freud dadurch von ihm als universell ausgegebene psychische Gesetzmäßigkeiten von einem einzigen, noch dazu seinem eigenen Fall ableite.
Diese beiden Behauptungen werden von Onfray mit großer rhetorischen Beharrlichkeit immer erneut abgewandelt. Zwischen diesen Wiederholungen des ewig Selben beschuldigt Onfray in der Hauptsache Anna Freud, Ernest Jones und Peter Gay der systematischen Legendenbildung im Fall Freuds. Dies alles wird in einem Ton vorgebracht, als würden hier große Neuigkeiten verkündet, was wahrscheinlich nur diejenigen Leser Onfrays überzeugen wird, auf die das Buch zielt. Jeder dagegen, der sich auch nur oberflächlich mit der Literatur zu Freud beschäftigt hat, weiß, dass der Einfluss der Geistesgeschichte des 19. Jahrhunderts und insbesondere Nietzsches auf Freud inzwischen breit dokumentiert und diskutiert wurde. Onfray rennt hier unter großem Gebrüll Türen ein, die bereits seit mehreren Jahrzehnten weit offen stehen.
Was die methodologische Kritik angeht, so bemerkt Onfray offenbar nicht (oder er will es nicht bemerken), dass seine Kritik gänzlich ins Leere geht: Zum einen hat Freud nie bestritten, dass er selbst und die Angehörigen seiner Familie bevorzugte Objekte seiner Studien waren, zum anderen ist es nicht verwunderlich, dass Freud allgemein gültige psychische Gesetzmäßigkeiten auch an sich selbst feststellen kann. Onfrays Argument folgt in etwa der Struktur, dass Newtons Gravitationsgesetz nicht gültig gewesen wäre, hätte Newton es bloß dadurch herausgefunden, dass er es an der Schwere seiner eigenen Person studiert hätte. Wollte Onfray tatsächlich nachweisen, dass hier ein Fehler vorliegt, so müsste er – wie dies andernorts durchaus fruchtbar praktiziert worden ist – zuerst auf empirischem oder logischem Weg nachweisen, dass die von Freud als allgemein gültig angesehen psychischen Gesetzmäßigkeiten diesem Anspruch nicht genügen, um dann Freuds Schluss von sich auf andere als Fehlschluss nachweisen zu können. Selbstverständlich macht sich der Philosoph Onfray die Mühe eines solchen Nachweises nicht, besonders auch weil dessen langwierige Erarbeitung und detaillierte Darstellung am Interesse seiner Zielgruppe gänzlich vorbeigehen würde.
Von der logischen Schwierigkeit, dass Onfrays Argument gegen Freud auf ihn selbst zurückschlägt und so seine Kritik Freuds als nichts anderes erscheinen muss als ein Ausfluss seiner – Onfrays – persönlichen psychischen Disposition, wollen wir hier ganz schweigen; ein beschämendes Bild mangelnder Reflexion für einen, der sich als Philosophen ausgibt. Bleibt nur noch festzuhalten, dass Onfray eine Diskussion des wichtigen Arguments, dass sich die Richtigkeit der psychoanalytischen Theorie letztlich nur an den Erfolgen bzw. Misserfolgen der therapeutischen Praxis entscheiden wird (eine Entscheidung, die noch lange nicht gefallen ist und wahrscheinlich auch erst fallen wird, wenn sie vollständig unerheblich geworden ist), in keiner einzigen Zeile auch nur versucht.
Insgesamt lässt sich das Buch völlig ausreichend beurteilen, wenn man einen Blick auf das Cover der deutschen Ausgabe wirft: Da hat ein frecher, kleiner Junge dem Papa Sigmund Hörner, eine Brille und eine herausgestreckte Zunge angemalt und eine Teufelsgabel in die Hand gedrückt. Man kann das witzig finden, aber es ist weder ein Argument gegen die Psychoanalyse, noch wird Freud auf diese Weise tatsächlich zum Teufel. Das Buch ist ein alberner und etwas kindischer Versuch Onfrays, mit einem seiner geistigen Väter abzurechnen – und es folgt damit so klassisch dem Freudschen Mythos vom Vatermord, dass es schon wieder lächerlich ist.
Michel Onfray: Anti Freud. Die Psychoanalyse wird entzaubert. Aus dem Französischen von Stephanie Singh. München: Knaus, 2011. Pappband, Lesebändchen, 540 Seiten. 24,99 €.