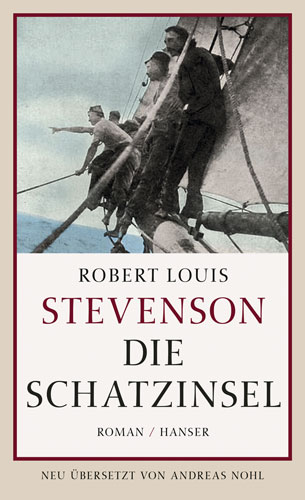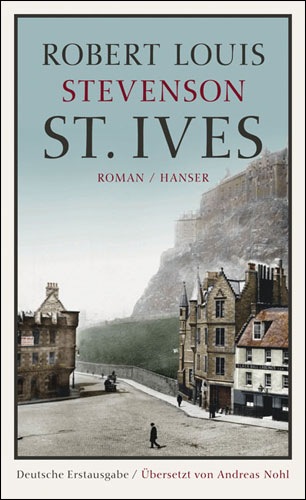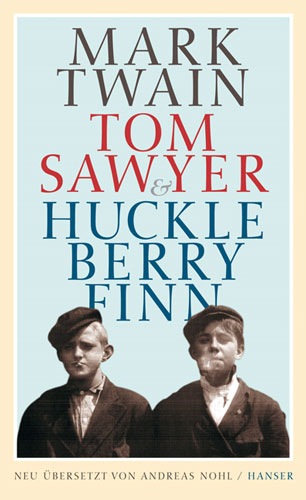Als jüngsten Band in seiner ebenso schönen wie verdienstvollen Reihe von Neuübersetzungen literarischer Klassiker legt der Hanser Verlag mit „Die Schatzinsel“ nach „St. Ives“ einen weiteren Stevenson-Band vor. „Die Schatzinsel“ ist völlig zu Recht Stevensons bekanntester Roman; er war nicht nur ein Bestseller seiner Zeit, sondern hat auch auf unzählige Nachfolger sowohl im Detail als auch der erzählerischen Form nach massiven Einfluss gehabt. Seine Fabel ist exzellent konstruiert und kompakt und ökonomisch erzählt, seine Figuren prägnant und klar motiviert, ohne einem zu simplem Gut-Böse-Schema zu gehorchen, seine Sprache eingängig, ohne simpel oder klischeehaft zu wirken. All dies hat das Buch zu einem der Muster der Abenteuererzählung werden lassen. So wäre es etwa kein kleiner Spaß, einmal alle direkten und indirekten Anspielungen auf die „Schatzinsel“ in Disneys „Pirates of the Caribbean“-Filmen aufzuspüren.
Es ist daher kein Wunder, dass die Neuübersetzung von Andreas Nohl die Fortsetzung einer langen Reihe darstellt, selbst wenn man von allen Ausgaben für die heranwachsende Jugend absieht, die ohne besondere literarische Ansprüche die Handlung paraphrasieren. Erzählt wird, wie bekannt sein dürfte, die Geschichte vom jungen Jim Hawkins, Sohn eines verstorbenen Gastwirts, der aus dem Nachlass eines merkwürdigen, seemännischen Gastes im elterlichen Gasthaus in den Besitz einer Schatzkarte gelangt, auf der das Versteck des Schatzes des berüchtigten Piraten Flint eingetragen ist. Jim findet im Doktor des Dorfes und einem benachbarten Gutsverwalter zwei Unterstützer bei der Suche nach Flints Schatz, die ein Schiff ausrüsten und sich zusammen mit ihm auf den Weg zur Schatzinsel machen. Wie sich herausstellt, besteht ein bedeutender Teil der Besatzung des Schiffes aus Flints alter Mannschaft, die dem eigentlichen Bösewicht des Buches, dem Schiffskoch Long John Silver gehorchen und eine Meuterei inszenieren, sobald man auf der Schatzinsel angekommen ist. Mehr muss von den Abenteuern Jims nicht nacherzählt werden, denn dass es gut ausgeht und die Richtigen am Ende mit dem Schatz nach Hause fahren, versteht sich von selbst.
Um die Neuübersetzung sollte man eigentlich auch nicht viele Worte machen müssen, da es völlig normal ist, dass ein so populärer Text mit schöner Regelmäßigkeit neu übersetzt wird. Nohl selbst betont einmal mehr, seine Übersetzung suche die „größtmögliche Nähe zum Original bei gleichzeitig größtmöglicher Lesbarkeit“. Die Auffassung, dass es Aufgabe des Übersetzers sei, die größtmögliche Lesbarkeit des Textes zu erzeugen, anstatt dem zielsprachlichen Leser einen möglichst genauen Eindruck vom ausgangssprachlichen Text zu vermitteln, hatte mir bereits das Vergnügen an seiner „Tom Sawyer & Huckleberry Finn“-Übersetzung verdorben. Was Lesbarkeit in diesem Zusammenhang überhaupt anderes bedeuten soll als die Vorstellung eines Verlegers von der rezeptiven Dummheit seiner Kunden, bleibt denn auch diesmal unklar. Im Falle der „Schatzinsel“ ist dies nicht ganz so dramatisch, da das englische Original in weiten Teilen schon recht lesbar ist. Dennoch macht sich Nohl Sorgen um „ausgefallene“ nautische Fachausdrücke, die er versucht, in „leichter verständliche“ zu übersetzen. Ob der Reiz der Verwendung ausgefallener Ausdrücke nicht gerade darin liegen könnte, die Fremdheit der Welt an Bord eines Segelschiffs des 18. Jahrhunderts zu erhöhen, wird – zumindest im Nachwort – nicht reflektiert.
Dass Nohl die grammatikalisch oft falsche und stark mit Dialektausdrücken und Verschleifungen durchsetzte Sprache Long John Silvers im Namen der Lesbarkeit verflachen und verharmlosen würde, war nicht anders zu erwarten. Dabei ist er für die sprachliche Ausdifferenzierung des Originals durchaus nicht unempfänglich, wie sich an dem fein gemachten Tonwechsel in den wenigen Kapiteln zeigt, in denen nicht Jim Hawkins, sondern der Doktor als Erzähler fungiert.
Doch bleibt es wenigstens für mich fraglich, ob es bei der Übersetzung eines Romans aus dem 19. Jahrhundert, der zudem noch im 18. Jahrhundert spielt, wirklich glücklich ist, „cooling drinks“ mit dem Wort „Erfrischungsgetränke“ zu übersetzen; oder warum Billy Bones, der im Original den ihn behandelnden Doktor einen „fool“ (Narren) nennt, seine ehemaligen Schiffskameraden aber als „lubbers“ (Trottel) bezeichnet, in Nohls Übersetzung für beide Wörter den Ausdruck „Dösbaddel“ benutzen muss. Ob „gentleman of fortune“, für das es das schöne deutsche Wort „Glücksritter“ gibt, besser mit „Hasardeur“ übersetzt ist, mag noch immerhin Geschmackssache sein. Auch gestehe ich gern zu, dass sich der berühmte Fluch Long John Silvers „shiver my timbers“ nicht recht eindeutschen lässt, aber wenn es denn schon „hau mich der Lukas“ heißen soll – was meiner gänzlich unmaßgeblichen Meinung nach an und für sich schon ganz und gar schrecklich ist –, dann muss es eben auch so heißen und nicht mal so und mal „zum Donnerwetter“ (S. 218) und mal „Donnerkiel“ (S. 254), was nebenbei an anderer Stelle (S. 276) die Übersetzung von „by thunder“ ist. Von Schlampereien des Lektorats wie den missratenen Gradangaben auf Seite 59 und der Erwähnung einer „westlichen Breite“ in der dazugehörigen Fußnote will ich ganz absehen; sicherlich hätte man solche ausgefallenen nautischen Angaben am liebsten ganz aus dem Text fortgelassen.
Leser, denen solche literarischen Feinheiten gleichgültig sind, bekommen – wie immer bei Hanser – ein sehr schön ausgestattetes Buch mit einer weitgehend akzeptablen, modernen und lesbaren Übersetzung. Wir anderen gehen ins Antiquariat oder hoffen darauf, dass sich doch wieder einmal ein Verleger besinnt, die Übersetzung Friedhelm Rathjens (Haffmans, 1997) zum Druck zu befördern.
Robert Louis Stevenson: Die Schatzinsel. Aus dem Englischen von Andreas Nohl. München: Hanser, 2013. Leinen, Fadenheftung, bedrucktes Vorsatzpapier, Lesebändchen, 383 Seiten. 27,90 €.