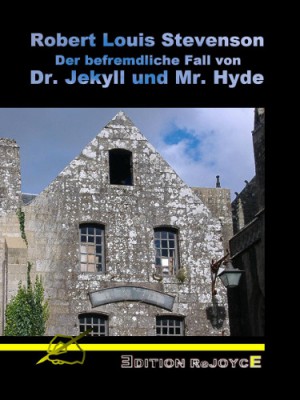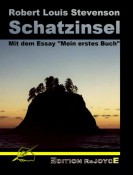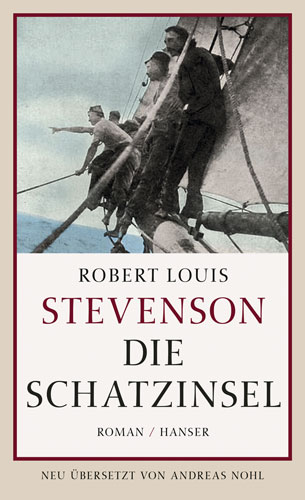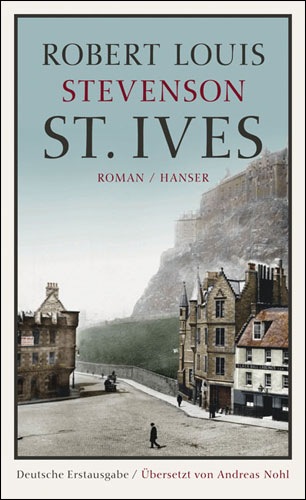Dies war vielleicht das Verrückteste, was jemals von zwei Personen ausgeführt wurde, die für sich beanspruchen, bei Verstand zu sein.
Eine längere Erzählung des noch jungen Stevenson, die hauptsächlich 1879 in den USA entstanden ist und im folgenden Jahr veröffentlicht wurde. Sie markiert in gewisser Weise Stevensons Durchbruch als Autor, da sie sowohl von der Kritik als auch von Kollegen hoch gelobt wurde, obwohl Stevenson selbst sie eher für eine Handwerksarbeit hielt. Arthur Conan Doyle gefiel sie gar so gut, dass er sie auch noch viele Jahre später als die beste englische Erzählung überhaupt bezeichnete.
Erzählt wird vom Ich-Erzähler Frank Cassilis, einem etwas menschenscheuen Eigenbrötler, der in seinem dreißigsten Lebensjahr ein unstetes Wanderleben führt. Unter anderem bringt ihn seine Wanderschaft auch an einen Ort zurück, den er zuletzt vor neun Jahren besucht hat: Den Landsitz seines einzigen Studienfreundes Northmour, von dem er sich damals im Streit getrennt hatte. Bewohnt hatten beide damals ein Nebengebäude, eben den titelgebenden Pavillon in den Dünen. Kaum hat sich Cassilis in der Nähe mit seinem Zelt eingerichtet, so beobachtet er, wie eines Nachts der Pavillon für Besucher hergerichtet wird und in der Nacht darauf Northmour mit einer jungen Frau und einem älteren Herrn den Pavillon bezieht. Bald wird Cassilis in die Angelegenheiten dieser Leute verwickelt sein, sich in die junge Frau verliebt haben und sich zusammen mit seinem Rivalen um deren Gunst gegen eine Gruppe von Italienern verteidigen, die dem Vater der jungen Frau, einem betrügerischen Bankier, ans Leben wollen.
Die Erzählung ist nett gebaut, bringt zu Anfang etwas Schauerromantik ins Spiel, wird dann zur Kriminalerzählung mit aktuellem politischem Hintergrund, in die geschickt eine Liebesgeschichte eingeflochten ist. Es erstaunt nicht, dass Stevenson selbst von einem Handwerksstück (carpentry) spricht, denn die Erzählung liegt ganz in der Linie der populären Literatur der Zeit. Sie zeichnet sich aber durch eine außergewöhnlich hohe Ökonomie aus, erzählt nur das unbedingt Notwendige und erspart dem Leser so viel Geschwätz. Zugleich weiß Stevenson die Klaviatur der Spannung und der Emotion souverän zu bedienen, so dass man von einem rundherum gelungenen Kurz-Roman sprechen könnte, wenn es so etwas damals schon gegeben hätte. (Heute würden die meisten Verlage auf einem vergleichbaren Produkt gnadenlos die Kennmarke Roman absetzen.)
Die Neuübersetzung bei Mare von Lucien Deprijck ist durchweg gut; das kleinformatige Bändchen (15½ × 10 cm) mit seinem bedruckten Leineneinband sehr gefällig; einzig die Fadenheftung fehlt, um das Büchlein perfekt zu machen.
Robert Louis Stevenson: Der Pavillon in den Dünen. Aus dem Englischen von Lucien Deprijck. Hamburg: mare, 2018. Bedrucktes Leinen, Lesebändchen, 159 Seiten. 20,– €.