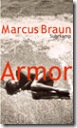mein ideal.
ich schreibe für die kommenden klugscheisser; um das milieu dieser ära komplett zu machen.
Die 60er Jahre des letzten Jahrhunderts waren eine fruchtbare Zeit für das, was man damals „experimentelle Literatur“ nannte. Dieses formal und stofflich recht uneinheitliche Genre hatte seine deutschsprachige Gründungsschrift wahrscheinlich in Peter Weiss’ „Der Schatten des Körpers des Kutschers“ (1960) und sah – pars pro toto – Merkwürdigkeiten wie Thomas Bernhards Romane („Frost“ (1962)), Peter Bichsels „Eigentlich möchte Frau Blum den Milchmann kennenlernen“ (1964), Max Frischs „Mein Name sei Gantenbein“ (1964), Wolfgang Hildesheimers „Tynset“ (1964), Günter Eichs „Maulwürfe“ (1968), Helmut Heißenbüttels „Projekt Nr. 1. D’Alemberts Ende“ (1970), Paul Wührs „Gegenmünchen“ (1970) und nicht zuletzt natürlich Arno Schmidts Mythos „Zettel’s Traum“ (1970). Alle diese und zahlreiche andere Texte dieser Zeit galten und gelten zum Teil heute noch als schwer oder gar unlesbar oder -verständlich und hätten bei dem heutigen Buchmarkt nur geringe Chancen, es an den Controllern und Finanzfachkräften in Lektorat und Vertrieb vorbei bis in die Druckerei zu schaffen.
Einer dieser Texte war Oswald Wieners Buch „die verbesserung von mitteleuropa, roman“ (1969), das im Erscheinungsjahr erstaunliche drei Auflagen (achttausend Exemplare) erlebte, 1972 als Taschenbuch aufgelegt wurde (Abb. rechts) und 1985 nochmals erschien. Ob es sich 1985 auch verkauft hat, wage ich nicht zu mutmaßen. Weswegen das alles aber hier zur Sprache kommt, ist die überaus erstaunliche Tatsache, dass in den letzten Wochen im österreichischen Verlag Jung und Jung eine weitere Neuausgabe dieses Textes erschienen ist, von dem ich vermutet hätte, dass er inzwischen – sieht man von einigen wenigen eingepuppten Germanisten ab – komplett vergessen ist.
Oswald Wiener (geb. 1935) war einer der theoretischeren Köpfe der sogenannten Wiener Gruppe um H. C. Artmann. Er hatte sich schon früh mit Kybernetik beschäftigt, ist außergewöhnlich breit belesen und hatte schon damals mehr Seiten Prosa weggeworfen, als mancher in seinem Leben überhaupt geschrieben hat. „die verbesserung von mitteleuropa, roman“ – es wäre aufgrund der dem Titel ironisch angeklebten Gattungsbezeichnung mit Sicherheit eines der am häufigsten falsch zitierten und bibliographisch erfassten deutschsprachigen Bücher, wenn es denn zitiert würde – ist ein Konglomerat kürzerer und längerer Texte, die sich im Wesentlichen mit allem beschäftigen, was dem Autor während der 60er Jahre durch den Kopf gegangen sein dürfte. Es finden sich philosophische und linguistische Reflexionen über Sprache, poetologische und literarische Aphorismen, Tagebucheinträge, ein langer Essay „zum konzept des bio-adapters“, „zwei studien über das sitzen“, die en passant allen Peter-Handke-Enthusiasten zur Lektüre empfohlen seien, (zumindest mir) völlig unverständliche Ein-, Zwei- und Mehrzeiler, Schimpfereien und Ressentiments, alles hinter- und untereinander gesetzt wohl in der Hoffnung, jene Authentizität der Literatur wiederzugewinnen, die durch die ewige Reproduktion derselben Formen verloren gegangen zu sein schien.
Der Leser muss für dieses Buch viel Geduld aufbringen und sich einlassen auf die sehr spezifische und unvermittelte Welt des Autors. Alternativ dazu kann er das Buch auch einfach nur durchblätternd anstaunen und lernen, was auf dem deutschsprachigen Buchmarkt einmal möglich war. Jene Freiheit, die uns in den vergangenen 30 Jahren abhanden gekommen ist, scheint hier für einen Augenblick auf. Aber natürlich ist es zum Ausgleich heutzutage viel sicherer als damals. Wovor also fürchten wir uns?
Oswald Wiener: die verbesserung von mitteleuropa, roman. Salzburg: Jung und Jung, 2013. Pappband, 220 Seiten (davon 205 römisch nummeriert). 25,– €.