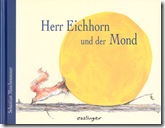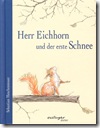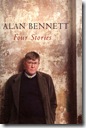Der zweite Teil der Frank-Bascombe-Trilogie. Obwohl das Buch neun Jahre später als Der Sportreporter geschrieben wurde, setzt die Handlung nur etwas mehr als vier Jahre später wieder ein. Frank Bascombe, der sich am Ende des ersten Teils nach Florida und dann nach Europa zurückgezogen und dort mit einer sehr viel jüngeren Frau zusammengelebt hatte, lebt nun als Immobilienmakler wieder in Haddam, New Jersey. Er ist immer noch unverheiratet (ein Thema, das viel Raum in seinem Denken einnimmt), hat aber seit einiger Zeit eine Beziehung zu Sally, einer ebenfalls geschiedenen Frau etwa in seinem Alter. Auch Unabhängigkeitstag beschreibt in der Haupthandlung nur einige wenige Tage, diesmal Anfang Juli 1988.
Der zweite Teil der Frank-Bascombe-Trilogie. Obwohl das Buch neun Jahre später als Der Sportreporter geschrieben wurde, setzt die Handlung nur etwas mehr als vier Jahre später wieder ein. Frank Bascombe, der sich am Ende des ersten Teils nach Florida und dann nach Europa zurückgezogen und dort mit einer sehr viel jüngeren Frau zusammengelebt hatte, lebt nun als Immobilienmakler wieder in Haddam, New Jersey. Er ist immer noch unverheiratet (ein Thema, das viel Raum in seinem Denken einnimmt), hat aber seit einiger Zeit eine Beziehung zu Sally, einer ebenfalls geschiedenen Frau etwa in seinem Alter. Auch Unabhängigkeitstag beschreibt in der Haupthandlung nur einige wenige Tage, diesmal Anfang Juli 1988.
Dass die Handlung nicht weiter in die Zukunft gerückt ist, liegt wohl in der Hauptsache daran, dass ein Ausflug Franks mit seinem Sohn Paul ein wesentliches Element der Handlung bildet. Franks geschiedene Frau Ann (diesmal hat sie einen Namen bekommen) hat inzwischen wieder geheiratet und lebt mit den gemeinsamen Kindern inzwischen nicht mehr in Haddam. Paul, der jetzt 15 Jahre alt ist, macht gerade eine schwierige Phase durch. Er ist beim Stehlen von Kondomen erwischt worden, hat sich anschließend mit dem Sicherheitspersonal herumgeprügelt und sieht nun einer Gerichtsverhandlung entgegen. Frank hat das Gefühl, sich nicht gut genug um seinen Sohn gekümmert zu haben, und will nun auf einer kurzen Vater-Sohn-Spritztour, auf der sie zwei Ruhmeshallen – die für Basket- und die für Baseball – anschauen wollen, die Beziehung zu seinem Sohn wieder vertiefen und ihm vorschlagen, für eine Weile zurück nach Haddam zu ziehen.
 Doch bevor Frank seinen Sohn abholen fährt, will er rasch noch einem Ehepaar ein Haus verkaufen. Joe und Phyllis Markham sind zwei Kunsthandwerker, beide in zweiter Ehe miteinander verheiratet, die mit ihrer gemeinsamen Tochter noch einmal ein neues Leben anfangen wollen und dafür ihr Traumhaus suchen. Sie sind schon seit einiger Zeit auf der Suche und inzwischen am Rande der Verzweiflung, da sie ihr altes Haus schon verkauft haben, die Zwischenlösung, die sie sich ausgedacht haben, dem Ende entgegengeht und auch ihre Geldreserve schwindet. Ihr Traumhaus können sie sich nicht leisten, sie sind aber auch nicht wirklich bereit, Kompromisse einzugehen. In dieser quälenden Lage zeigt ihnen Frank Bascombe ein Haus, das gerade so in Frage käme, das aber in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem Gefängniskomplex liegt, was Phyllis das ansonsten schöne Haus verleidet. Die Markhams geraten an diesem Wochenende in eine tiefe Krise, an der sich Frank als Zuschauer beteiligt sieht. Es gehört zu seinem Beruf, die seelischen Höhen und Tiefen seiner Klienten mit zu durchleben, und er erträgt das Benehmen der Markhams mit einer erstaunlichen Gelassenheit. Mit einer ähnlichen äußerlichen Ruhe hält er die Zweifel seiner Freundin Sally aus, die am Abend vor dem geplanten Ausflug Franks ihre Beziehung grundsätzlich in Frage stellt, was ihr aber schon kurze Zeit später leid tut.
Doch bevor Frank seinen Sohn abholen fährt, will er rasch noch einem Ehepaar ein Haus verkaufen. Joe und Phyllis Markham sind zwei Kunsthandwerker, beide in zweiter Ehe miteinander verheiratet, die mit ihrer gemeinsamen Tochter noch einmal ein neues Leben anfangen wollen und dafür ihr Traumhaus suchen. Sie sind schon seit einiger Zeit auf der Suche und inzwischen am Rande der Verzweiflung, da sie ihr altes Haus schon verkauft haben, die Zwischenlösung, die sie sich ausgedacht haben, dem Ende entgegengeht und auch ihre Geldreserve schwindet. Ihr Traumhaus können sie sich nicht leisten, sie sind aber auch nicht wirklich bereit, Kompromisse einzugehen. In dieser quälenden Lage zeigt ihnen Frank Bascombe ein Haus, das gerade so in Frage käme, das aber in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem Gefängniskomplex liegt, was Phyllis das ansonsten schöne Haus verleidet. Die Markhams geraten an diesem Wochenende in eine tiefe Krise, an der sich Frank als Zuschauer beteiligt sieht. Es gehört zu seinem Beruf, die seelischen Höhen und Tiefen seiner Klienten mit zu durchleben, und er erträgt das Benehmen der Markhams mit einer erstaunlichen Gelassenheit. Mit einer ähnlichen äußerlichen Ruhe hält er die Zweifel seiner Freundin Sally aus, die am Abend vor dem geplanten Ausflug Franks ihre Beziehung grundsätzlich in Frage stellt, was ihr aber schon kurze Zeit später leid tut.
Der zweite Teil des Romans umfasst im Wesentlichen den Ausflug Franks mit Paul, der natürlich nicht so harmonisch verläuft, wie Frank sich das erhofft hat, aber trotzdem eine kurzzeitige Annäherung von Vater und Sohn bringt, bevor es dann in Cooperstown zu einer dramatischen Zuspitzung kommt.
Unabhängigkeitstag variiert ganz bewusst die Muster, die in Der Sportreporter bereits angelegt waren: Auch hier werden nur wenige Tage erzählt, in denen das Leben Frank Bascombes aus dem Gleichgewicht zu geraten scheint, nur um anschließend ein neues Gleichgewicht zu finden. Auch hier scheint Frank eher Zuschauer eines Geschehens zu sein, denn aktiver Teilnehmer oder gar Gestalter. Bascombe erscheint wesentlich als Quietist, dem sein Leben zustößt, ohne dass er dagegen viel einzuwenden hätte. Im Gegensatz zum Vorgängerbuch spielen die Politik und die wirtschaftliche Lage der USA eine prominentere Rolle. Die Wahlen des Jahres 1988, aus denen Ronald Reagan als Präsident hervorgehen wird, sind ein wichtiges Thema, ebenso die abzusehende Krise auf dem Immobilienmarkt, der Frank mit seiner gewohnten Gelassenheit entgegensieht. Außerdem räumt Ford dem Thema Gewalt und Verbrechen in der US-amerikanischen Gesellschaft einen überraschend breiten Raum ein.
Der Roman hat wohl auch einige schwächere Passagen: So ist Ford offenbar nicht ganz zufrieden damit, dass er Frank Bascombe in einen so völlig anderen Beruf verpflanzen muss, um dem Roman neue stoffliche Quellen öffnen zu können. So wirkt denn auch das vierte Kapitel, das den Übergang zwischen den beiden Romanen herstellt, etwas gezwungen. Auch das unvermittelte Auftauchen von Franks Halbbruder im letzten Viertel des Romans, der ebenso sang- und klanglos wieder verschwindet, nachdem er seine Schuldigkeit getan hat, wirkt eher ungelenk. Alles in allem ist Unabhängigkeitstag aber eine gelungene Fortsetzung der Lebensgeschichte Frank Bascombes.
Richard Ford: Unabhängigkeitstag. Aus dem Amerikanischen von Fredeke Arnim. BVT 350. Berlin: Berliner Taschenbuch Verlag, 2007. 588 Seiten. 12,50 €.
P. S.: Meine alte Goldmann-Ausgabe (1997; Abb. 1) weist zahlreiche Druckfehler auf, die daher zu rühren scheinen, dass das Buch für die Taschenbuch-Ausgabe eingescannt und anschließend nur flüchtig Korrektur gelesen wurde. Ich hoffe, dass die neue Ausgabe im Berliner Taschenbuch Verlag (Abb. 2) eine bessere Qualität aufweist.
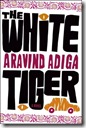 Bemerkenswerter Erstling eines jungen indischen Autors, auf den ersten Blick eine Kombination aus Schelmenroman und monologischem Briefroman. Beim Ich-Erzähler bzw. Verfasser der »Briefe«, die vorgeblich als E-Mails daherkommen, handelt es sich um Balram Halwai, Sohn eines Rikscha-Wallahs aus der indischen Provinz, der nun als erfolgreicher Unternehmer in Bangalore lebt. Seine E-Mails sind an den chinesischen Premierminister Wen Jiabao gerichtet, dessen Staatsbesuch in Indien unmittelbar bevorsteht. Ziel der E-Mails sei, dem Premier das Wesen freien Unternehmertums zu erklären, über das dieser sich angeblich in Bangalore unterrichten will.
Bemerkenswerter Erstling eines jungen indischen Autors, auf den ersten Blick eine Kombination aus Schelmenroman und monologischem Briefroman. Beim Ich-Erzähler bzw. Verfasser der »Briefe«, die vorgeblich als E-Mails daherkommen, handelt es sich um Balram Halwai, Sohn eines Rikscha-Wallahs aus der indischen Provinz, der nun als erfolgreicher Unternehmer in Bangalore lebt. Seine E-Mails sind an den chinesischen Premierminister Wen Jiabao gerichtet, dessen Staatsbesuch in Indien unmittelbar bevorsteht. Ziel der E-Mails sei, dem Premier das Wesen freien Unternehmertums zu erklären, über das dieser sich angeblich in Bangalore unterrichten will.