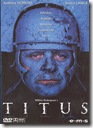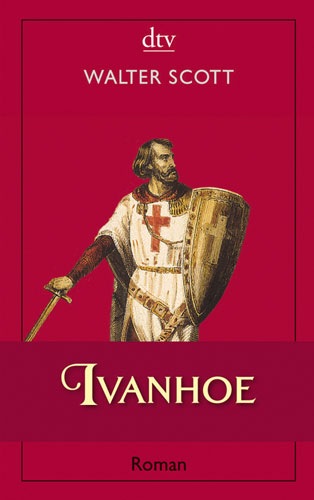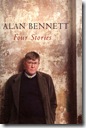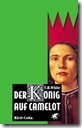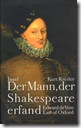 Worauf man sich wahrscheinlich mit den meisten ernsthaften Shakespeare-Lesern würde einigen können, ist, dass uns die Person des Stratforder Kaufmanns, der angeblich der Autor von Shakespeares Werken sein soll, nicht wirklich überzeugt. Andererseits werden die meisten im selben Atemzug einwenden, dass es um die anderen Kandidaten nicht so sehr viel besser bestellt ist.
Worauf man sich wahrscheinlich mit den meisten ernsthaften Shakespeare-Lesern würde einigen können, ist, dass uns die Person des Stratforder Kaufmanns, der angeblich der Autor von Shakespeares Werken sein soll, nicht wirklich überzeugt. Andererseits werden die meisten im selben Atemzug einwenden, dass es um die anderen Kandidaten nicht so sehr viel besser bestellt ist.
Allerdings wird seit etwa 90 Jahren ein möglicher Autor von Shakespeares Werken diskutiert, der alle Eigenschaften in sich vereint, die uns notwendig erscheinen, um das Genie Shakespeares zu erklären: Er ist Adeliger und Höfling, er hat eine breite höhere Bildung genossen, er hat Frankreich und – was wichtiger ist – Italien bereist, in seiner Bibliothek fanden sich mit hoher Wahrscheinlichkeit all jene Bücher, die Shakespeare gelesen haben sollte etc. pp. Es handelt sich um Edward de Vere, den 17. Earl of Oxford, geboren 1550, gestorben 1604, Lebemann, Frauenheld, stets tief verschuldet, lange Zeit in London und am Hofe Elizabeth I. lebend und nachweislich Autor diverser Gedichte, die er unter verschiedenen Pseudonymen veröffentlichte. Auch war er fraglos der Theaterwelt seiner Zeit verbunden – nur, ob er der Autor von Shakespeares Werken war, scheint fraglich.
Kurt Kreiler, der sich seit längerem darum bemüht, den Autor Edward de Vere dem deutschen Publikum nahe zu bringen, hat nun die erste umfangreiche deutschsprachige Biografie über ihn vorgelegt. Das Buch muss in zweierlei Hinsichten betrachtet werden: Zum einen als Biografie eines elisabethanischen Autors, zum anderen als Kampfschrift zur Shakespeare-Frage. Was die biografische Seite angeht, so ist Kreiler zu attestieren, dass er ein beeindruckender Kenner des Lebens und der Lebensumstände de Veres ist. Wie auch im Falle des Stratforder Shakespeares ist die Quellenlage gemessen an heutigen Vorstellungen eher dünn. So greift auch Kreiler zu dem üblichen Trick der Biografen, fehlende persönliche Details durch allgemeine Historie zu ersetzen. Dabei wird unvermeidlich vieles erzählt, was man eventuell bereits anderswo gelesen hat. Andererseits finden sich bei Kreiler auch immer wieder interessante Einzelheiten. Nur als Biografie betrachtet ist das Buch verdienstvoll und lesenswert.
Natürlich würden sich nur sehr wenige Leser für Edward de Vere interessieren, wenn nicht die These im Raum stünde, er habe Shakespeares Werke verfasst. Kreiler vertritt diese These geschickt, indem er deutlich macht, dass der Autor der »italienischen Stücke« seine Kenntnisse nicht aus einer auch noch so breiten Lektüre gewonnen haben kann, sondern höchstwahrscheinlich Italien bereist haben muss. Da sich eine solche Reise nicht in das Leben des Stratforder Kaufmanns hinein konstruieren lässt, erscheint er schlicht als unzureichende Persönlichkeit. De Vere dagegen hat die Vorzüge, die wir Shakespeare zuschreiben möchten: Er hat Italien selbst besucht, kennt die meisten Orte, an denen die Stücke spielen, aus eigener Anschauung, könnte all jene Kenntnisse, die Shakespeare nicht aus den Büchern seiner Zeit hätte extrahieren können, vor Ort in sich aufgenommen haben usw.
Das Bild ist verführerisch, nur ist es eben ein Bild und kein Beweis und sei es nur einer mittels Indizien. Denn leider ist die uns suggerierte Alternative zwischen einem Stratforder Stubenhocker einer- und einem weltmännischen Earl andererseits künstlich. Warum sollte ein Shakespeare allein auf Lektüre angewiesen sein, um die entsprechenden Kenntnisse zu erwerben? Was hinderte ihn daran, sich mit Italienreisenden, wenn nicht sogar mit Italienern selbst zu unterhalten? Das Problem der Shakespeare-Frage besteht nicht darin, den Unbekannten aus Stratford durch einen attraktiveren Autor zu ersetzen, sondern darin, dass wir über die Person Shakespeares und seine Arbeitsweise kaum konkretes, durch Quellen belegtes Wissen haben. Daher kann jeder das Bild malen, das zu seiner eigenen Theorie am besten passt.
So verweist Kreiler etwa auf das Stück The Jew, das bereits 1579 von Stephen Gosson erwähnt wird. Kreiler schreibt:
Gossons Beschreibung läßt aufhorchen: »Es handelt von der Gier derer, die Weltliches wählen, und von der blutdürstigen Gesinnung der Wucherer.« […]
Kein Zweifel: Gosson bezieht sich mit dem Wort »the greedinesse of wordly chusers« auf die Kästchen-Szene und mit »bloody minders of Usurers« auf die blutdürstige Gesinnung Shylocks in The merchant of Venice. [S. 214]
Kein Zweifel? Gleich im nächsten Absatz formuliert Kreiler selbst den ersten Zweifel, in dem er einräumt, es könne zu Shakespeares Der Kaufmann von Venedig ein Vorläufer-Stück gegeben haben, auf das sich Gosson bezieht und von dem das Shakespeare-Stück eine Bearbeitung darstellt. Das wäre zu Shakespeares Zeit kein ungewöhnliches Vorgehen und ist auch schon für andere Stücke unterstellt worden. Und geht es denn bei Shakespeare tatsächlich um das, was Gosson behauptet oder ist dessen Beschreibung nicht eher sehr oberflächlich? Und stammt diese Oberflächlichkeit daher, dass Gosson das Stück nur unvollständig verstanden hat oder gar nur vom Hörensagen her kannte, oder daran, dass es sich eben nicht um Shakespeares Stück handelt, sondern nur um eine uns nicht überlieferte Vorlage? Kein Zweifel? Ich wenigstens habe da noch erhebliche, ganz zu schweigen von Kreilers im Anschluss vorgenommener sogenannter Datierung von Shakespeares Stück, in der er ohne weiteres Portia mit Elizabeth I. gleichsetzt, um anschließend einfach Portias Freier mit denen Elizabeth’ zu identifizieren. Da wird der »neapolitanische Prinz« des Stücks als Don Juan d’Austria identifiziert, da der sich als Admiral in Neapel aufgehalten habe, was an sich schon fabelhaft genug wäre, was aber völlig unsinnig wird (und Kreiler weiß dies auch), wenn man sich Don Juan d’Austria als Bewerber um die Hand der Königin vorstellen soll. Derartige Holzwege der Spekulation sind leider typisch für alle Alternativtheorien und eben auch für Kreilers Buch.
Dass man mich richtig versteht: Edward de Vere ist eindeutig der beste Kandidat, der bislang als Autor für Shakespeares Stücke vorgeschlagen wurde. Er wäre eine sehr elegante und in vielen Einzelheiten passende Lösung der Shakespeare-Frage, so viel eleganter und passender als der Stratforder Kaufmann, dass das allein zu genügen scheint, die These stark zu machen. Nur ist das allein eben noch kein Beweis der Tatsache, sondern höchstens die Grundlage für eine Glaubensgemeinschaft.
Schauen wir uns noch kurz an, was gegen die de-Vere-These spricht und wie Kreiler damit umgeht: Was Kreiler selbstverständlich nicht lösen kann, ist die Frage, warum alle Zeitgenossen de Veres, die wussten, wer sich hinter dem Pseudonym Shakespeare versteckte, geschwiegen haben bzw. sich einzig in Anspielungen ergingen, die nur mit detektivischem Spürsinn zu enträtseln sind. Während man Freunden und Angehörigen de Veres noch als Motiv unterstellen kann, dass sie das für sie Offensichtliche aus Gründen der Standesehre verschwiegen haben, bestand für die Gegner und Feinde de Veres – und solche hatte er hinreichend – keinerlei Grund für eine solche Zurückhaltung. Aber selbst nach de Veres Tod findet sich keine einzige Quelle, die Shakespeare und de Vere eindeutig und klar miteinander identifiziert. Es ist natürlich nicht auszuschließen, dass alle derartigen Quellen verloren gegangen sind – was immer noch wahrscheinlicher ist als die Annahme, sie hätten niemals existiert –, aber glaubhaft ist das nicht. Hier ist der Punkt, wo die de-Vere-These an Verschwörungstheorien grenzt, was eher gegen als für sie spricht. Natürlich kann Kreiler diesen Eindruck nur abzuschwächen versuchen, aufheben kann er ihn nicht.
Das größere Problem stellt aber der Tod de Veres im Jahr 1604 dar. Da die akademische Shakespeare-Forschung ihren Autor noch mindestens acht, wenn nicht gar zehn Jahre nach diesem Datum aktiv sein lässt, muss Kreiler eine weitgehend veränderte Chronologie der Stücke entwickeln. Nach dem Motto »Wo gehobelt wird, fallen Späne« wird dabei einmal mehr Perikles, Fürst von Tyrus für unecht erklärt; Cymbeline und Das Wintermärchen werden aufgrund dünner Indizien deutlich vordatiert. Die eigentliche Crux stellt aber Der Sturm dar: Hier geht die Forschung davon aus, dass das Schiffsunglück zu Anfang des Stücks angeregt wurde von den Berichten über das Scheitern der Sea-Adventurer auf den Bermudas im Jahr 1609. Allgemein wird angenommen, der Autor des Stückes habe neben zwei Buchveröffentlichungen aus dem Jahr 1610 auch einen Brief gekannt, der 1610 geschrieben, aber erst 1625 abgedruckt wurde. Kreiler wendet ein, dass zum einen auch andere Quellen die entsprechende Vorlage geliefert haben könnten und dass zum anderen Der Sturm bereits 1605 in Eastward Ho! parodiert worden sei. Das alles geschieht auf einer halben Seite (vgl. S. 548).
Ein wenig mehr erwarte ich hier schon: Zumindest müsste man mir vorführen, was die früheren Deuter an Übereinstimmungen zwischen dem Stück und den Vorlagen (von denen Kreiler selbst nur eine erwähnt) gefunden haben bzw. nicht gefunden haben. Und auch die angebliche Parodie hätte ich gerne vorgeführt bekommen, anstatt mich mit der blanken Behauptung bescheiden zu müssen. Nicht, dass ich ohne Augenschein anderen Forschern von Haus aus mehr glauben würde als Kreiler; ihm glaube ich aber eben auch nicht.
Alles in allem ein interessantes und über Strecken informatives Buch, das die Vorteile der ohnehin starken Theorie der Autorenschaft de Veres an Shakespeares Werken deutlich herausarbeitet, aber aufgrund des unvermeidlich spekulativ bleibenden Ansatzes auch nicht über den Status einer Glaubensfrage hinausheben kann. Die Auseinandersetzung mit den Einwänden gegen die These bleibt insgesamt dünn, was den Verdacht erregt, Kreiler habe keine schlafenden Hunde wecken wollen. Meine Position zur Shakespeare-Frage wurde durch die Lektüre nicht verändert: Es wäre nett, wenn sich die Autorenschaft de Veres nachweisen ließe, doch bis auf weiteres sollten wir annehmen, dass die Werke Shakespeares weder von ihm noch von dem Stratforder Kaufmann geschrieben wurden, sondern von einem Mann, der ungefähr zur selben Zeit lebte und Shakespeare hieß, über den wir aber sonst gar nichts wissen.
Kurt Kreiler: Der Mann, der Shakespeare erfand. Edward de Vere, Earl of Oxford. Frankfurt/M.: Insel, 2009. Pappband, 595 Seiten. 29,80 €.