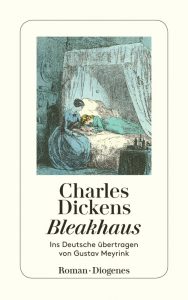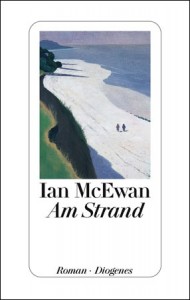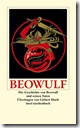Wieder ein Band in der guten Übersetzung von Thomas Schlachter, von der andere hier schon vorgestellt wurden. Er ist nach dem bewährten Strickmuster Wodehouses geschrieben: Ein begrenztes Personal wird auf einem Landsitz – diesmal Claines Hall in Sussex – versammelt, eine Anzahl einer widersprechender Interessen ins Werk gesetzt und dann konsequent ein Reigen der Verwirrungen und Verwechslungen durchgeführt. Der Landsitz gehört in diesem Fall Mable und Howard Steptoe, einem amerikanischen Ehepaar. Mable versucht mit einigem Aufwand vom lokalen Adel anerkannt zu werden, während sich Howard, ein ehemaliger Boxer und Filmstatist, sich in England denkbar unwohl und fehl am Platz fühlt. Mable versucht ihren Gatten mithilfe eines Kammerdieners zur Gesellschaftsfähigkeit zu erziehen, hat damit aber nur begrenzten Erfolg, da Howard einen Diener nach dem anderen vergrault. Auf dem Landsitz leben außerdem noch Sally Fairmile, eine verarmte Nichte der Steptoes, die die Stelle einer unbezahlten Bediensteten ausfüllt, Mrs Chavendar, eine Freundin Mables, und Lord Holbeton, der sich gerade heimlich mit Sally verlobt hat. Holbeton steht nach dem Tod seines Vaters unter der Vormundschaft von James Duff, eines Londoner Schinkenfabrikanten, der zudem noch vor 15 Jahren mit Mrs Chavendar verlobt war.
Wieder ein Band in der guten Übersetzung von Thomas Schlachter, von der andere hier schon vorgestellt wurden. Er ist nach dem bewährten Strickmuster Wodehouses geschrieben: Ein begrenztes Personal wird auf einem Landsitz – diesmal Claines Hall in Sussex – versammelt, eine Anzahl einer widersprechender Interessen ins Werk gesetzt und dann konsequent ein Reigen der Verwirrungen und Verwechslungen durchgeführt. Der Landsitz gehört in diesem Fall Mable und Howard Steptoe, einem amerikanischen Ehepaar. Mable versucht mit einigem Aufwand vom lokalen Adel anerkannt zu werden, während sich Howard, ein ehemaliger Boxer und Filmstatist, sich in England denkbar unwohl und fehl am Platz fühlt. Mable versucht ihren Gatten mithilfe eines Kammerdieners zur Gesellschaftsfähigkeit zu erziehen, hat damit aber nur begrenzten Erfolg, da Howard einen Diener nach dem anderen vergrault. Auf dem Landsitz leben außerdem noch Sally Fairmile, eine verarmte Nichte der Steptoes, die die Stelle einer unbezahlten Bediensteten ausfüllt, Mrs Chavendar, eine Freundin Mables, und Lord Holbeton, der sich gerade heimlich mit Sally verlobt hat. Holbeton steht nach dem Tod seines Vaters unter der Vormundschaft von James Duff, eines Londoner Schinkenfabrikanten, der zudem noch vor 15 Jahren mit Mrs Chavendar verlobt war.
Alles beginnt nun damit, dass sowohl Mrs Chavendar als auch Sally die Büroräume James Duffs aufsuchen, jene, um sich über die Ungenießbarkeit des Duffschen Premium-Schickens zu beschweren, diese, um Duff über die Verlobung in Kenntnis zu setzen und nach Möglichkeit ein bisschen Geld aus dem alten Herrn herauszubetteln. Beide Damen treffen aber hauptsächlich auf Joss Weatherby, einem von James Duff beschäftigten jungen Malers, der einerseits Duff das Leben gerettet, andererseits Mrs Chavendar porträtiert hat. Joss verliebt sich Knall und Fall in Sally, von der er unter anderem erfährt, dass sie wieder einmal auf der Suche nach einem neuen Kammerdiener für Howard Steptoe ist. Joss erkennt darin eine Chance, Sally den Hof zu machen und fährt sofort nach Claines Hall, um sich auf die Stelle zu bewerben. Duff dagegen setzt es sich in den Kopf, das in Caines Hall befindliche Porträt Mrs Chavendars in seinen Besitz zu bringen, um dieses Konterfei zu Werbezwecken für seine Schinken einzusetzen. Auch er macht sich daher nach Sussex auf und stiftet vor Ort sowohl Sally und Lord Holbeton als auch Joss dazu an, das Bild zu stehlen.
Aus dieser Konstellation heraus entwickelt Wodehouse eine seiner routinierten Prosakomödien, deren Motive der Wodehouse-Kenner sicherlich schon aus dem einen und anderen kennen wird. Dennoch eine angenehme und elegante Lektüre für Zwischendurch.
P.G. Wodehouse: Jetzt oder nie! Mit einem Nachwort von Evelyn Waugh. Aus dem Englischen von Thomas Schlachter. Suhrkamp Taschenbuch 3774. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 2006. 235 Seiten. 7,90 €.