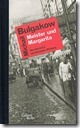Die Zeiten taumeln und lallen.
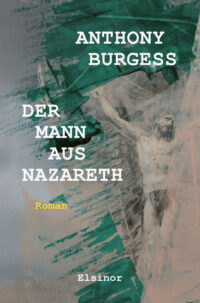
Anthony Burgess, dessen katholische Erziehung sich in unterschiedlicher Art und Gewichtung in seinem Gesamtwerk abzeichnet, hat in der zweiten Hälfte der 1970er-Jahre für Franco Zeffirelli das Drehbuch für dessen Vierteiler Jesus von Nazareth geschrieben.1 Burgess hat anschließend das recherchierte Material auch zu einem Roman verarbeitet und dabei seine ganz eigene Vision der Geschichte Jesu gestaltet. Herausgekommen ist eine etwas merkwürdige Mischung aus origineller Überschreibung, rationaler Umdeutung und letztlich doch gläubiger Bestätigung der ältesten Quellen. Dass die meisten Zeitgenossen mit dieser Version nicht unbedingt etwas anfangen konnten, zeigt sich sicherlich auch darin, dass der 1979 auf Englisch erschienene Roman trotz der anhaltenden Prominenz der TV-Serie erst jetzt ins Deutsche übersetzt wurde.2
Der Verlag gibt dem Text als einzigen Kommentar das Vorwort Burgess’ zur französischen Ausgabe (1977) bei, das wesentlich drei Punkte betont: Burgess habe versucht, Jesus als Menschen – kein „Weichling“, sondern „groß und stark, mit einer mächtigen Stimme“ (S. 370) – zu gestalten, ohne zugleich seinen Status als Gottessohn aufzuheben (hier wird man nicht zu genau nachfragen dürfen, was denn das eigentlich heißen soll), er wolle die „Logik der Eucharistie“ betonen und schließlich halte er die Liebe für die wesentliche Botschaft des Christentums:
Vor allem aber wollte ich zum Ausdruck bringen, dass es für den Menschen keine Hoffnung gibt, außer durch persönliche Erneuerung – das heißt, in der Bereitschaft jedes einzelnen zu Nachsicht, ja Liebe und sogar Vergebung Feinden gegenüber. Politische Reformen sind hoffnungslos. Das Kreuz ist das Symbol des Staates – des Staates Caesars wie des Präsidenten der französischen Republik. Der Weg Christi – der Kreuzweg – ist der einzige gangbare, auch aus praktischer und nicht-mystischer Sicht.
S. 371
Um diesen durchaus nicht einfach zu integrierenden Zielen nachzukommen, bekommen wir Jesus zuerst als einen belesenen Tischler vorgeführt: Zwar ist er von Anfang an davon überzeugt, nicht Sohn seines Ziehvaters Joseph zu sein, doch hindert ihn das vorerst nicht daran zu heiraten (die Hochzeit zu Kanaan wird zu Jesu eigener Hochzeit umgedeutet), doch stirbt seine Frau recht bald wieder und zu Beginn seiner Wirkungszeit ist Jesus daher Witwer. Er kennt sich außer in den Schriften auch in der Literatur des Mittelmeerraums aus, spricht und liest also Griechisch und Latein (Aramäisch versteht sich von selbst), kann mit dem studierten Judas durchaus mithalten und ist überhaupt ein Bild von einem Mann.
Je weiter die Geschichte jedoch fortgeschrieben wird, desto enger hält sich der Erzähler (ein griechischer Zeitgenosse, Kaufmann, von dem aber nie wirklich klar wird, warum er die Geschichte Jesu aufschreibt) an die Berichte der Apostel. Die Erzählungen der Evangelisten werden aber bis zum Ende konsequent durch eine politische und und soziale Ebene ergänzt, die zwar detaillierter aber in ähnlicher Weise gestaltet ist, wie sich dies auch schon bei Tim Rice in seinem Libretto für Jesus Christ Superstar (1971) finden lässt. Werden die Wunder zuerst noch wegrationalisiert (das Wunder der Verwandlung von Wasser in Wein zum Beispiel ist nur eine Art von Partyscherz; die ersten Geheilten sind wahrscheinlich psychosomatische Fälle; das wieder ins Leben gerufene Mädchen war wahrscheinlich noch gar nicht so ganz richtig tot etc. pp.), so wird ihr realer Status mit weiterem Fortschreiten immer vager, bis schließlich gar nicht mehr erst versucht wird zu erklären, wie es zu verstehen sein soll, dass der nun unbestreitbar tote Lazarus wieder ins Leben gerufen wird.
Der skeptische Betrachter kann sich des Eindrucks nicht erwehren, als habe die Religiosität des Autors seinen Text mehr und mehr überwältigt: Das Buch will den Leser je länger desto mehr zur Erkenntnis einer realen Gottessohnschaft Jesu und der Göttlichkeit seiner Lehre überreden.
Für Leser, die wie ich mit der Auseinandersetzung der 1970er-Jahre mit der Figur Jesu groß geworden sind, sicherlich ein interessantes Seitenstück; für gläubige Christen wahrscheinlich eine widerständige Lektüre; für alle anderen wohl eher ein Kuriosum.
Anthony Burgess: Der Mann aus Nazareth. Aus dem Englischen von Ludger Tolksdorf. Coesfeld: Elsinor, 2025. Klappenbroschur, 372 Seiten. 26,90 €.
- Als weitere Autorin des Drehbuchs wird Zeffirellis langjährige Mitarbeiterin Suso Cecchi D’Amico genannt. Ob es dabei eine echte Zusammenarbeit gegeben hat oder D’Amico das Drehbuch Burgess’ nachträglich überarbeitet hat, entzieht sich leider meiner Kenntnis. ↩︎
- Von den beiden anderen biblischen Erzählungen Burgess’ (beide ebenfalls zuerst als Drehbuch) – Moses (1976) und The Kingdom of the Wicked (1980) – wurde das Frühere ebenfalls bislang nicht ins Deutsche übersetzt. The Kingdom of the Wicked erschien 1985, also zur Hochzeit der Burgess-Rezeption in Deutschland, unter dem Titel Das Reich der Verderbnis (Katalog der DNB). ↩︎