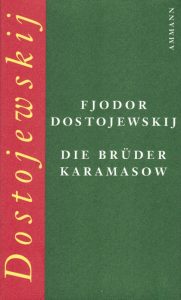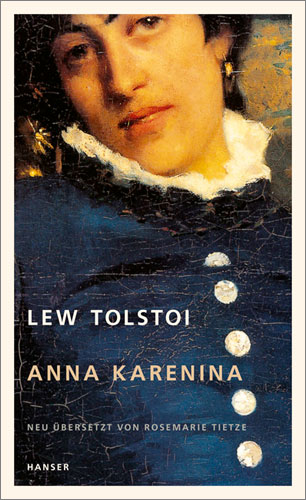Meistens sind die Menschen, sogar Bösewichte, wesentlich naiver und einfältiger, als wir annehmen. Wir sind ja auch nicht anders.
Der letzte der „fünf Elefanten“, im Jahr 1880 als letzter und zugleich umfangreichster Roman Dostojewskijs erschienen. Die Handlung lässt sich in zwei klar voneinander zu unterscheidende Abschnitte teilen: Im ersten Abschnitt geht es hauptsächlich um den jüngsten der drei (eventuell auch vier) Brüder Karamasow, Alexej, der zu Anfang des Romans noch in einem Kloster in seiner Heimatstadt in der russischen Provinz lebt. Dort ist er Vertrauter und Faktotum eines Einsiedlers, um dessen letzte Lebenstage und Sterben die Ereignisse angeordnet sind. Dostojewskij schafft sich damit Gelegenheit, in ausführlicher Breite seine Sicht des russischen Christentums auszubreiten, er geht sogar soweit, dass das komplette sechste Buch der Lebensbeschreibung und den Ansichten des Einsiedler gewidmet ist. Aber auch hier lässt Dostojewskij wieder mehr als nur eine Stimme vernehmen: So wird die über den Roman hinaus bekannte Erzählung Der Großinquisitor in den Roman eingeflochten, die der zweitälteste Bruder Iwan Karamasow seinem jüngeren Bruder Alexej erzählt und die eine eher skeptische Sicht auf die Kirche allgemein, die römisch-katholische Kirche im Speziellen präsentiert.
Mit dem achten von zwölf Büchern beginnt dann die Geschichte Dmitrij Karamasows, des ältesten Bruders, der aus der ersten Ehe des Vaters Fjodor Pawlowitsch stammt. Dmitrij hat den unsteten Charakter seines Vaters geerbt, ist Soldat geworden und hat das Erbe seiner Mutter weitgehend durchgebracht. Er befindet sich mit dem Vater in einem Streit darüber, ob ihm aus diesem Erbe noch eine Restzahlung zusteht; außerdem konkurrieren die beiden Männer trotz ihrem unterschiedlichen Alter um dieselbe Frau, Gruschenka, die ihre Unabhängigkeit dadurch unter Beweis stellt, dass sie beide Bewerber auf Distanz hält. Dmitrij ist zudem verschuldet: Er hat Geld, das ihm seine ehemalige Verlobte – in die wiederum Iwan Karamasow unglücklich verliebt ist – anvertraut hat, veruntreut und damit ein rauschendes Fest mit der umworbenen Gruschenka finanziert, ohne dass ihn das seinem Ziel irgendwie näher gebracht hätte. Nun sucht er verzweifelt nach jemandem, der ihm 3.000 Rubel leiht, damit er dieses veruntreute Geld zurückgeben kann.
Es kommt nun zu einer Reihe von Ereignissen, in deren Verlauf der Vater Fjodor Karamasow erschlagen und beraubt wird, wobei eine überwältigende Kette von Indizien auf Dmitrij als den Täter hinweist: Er ist plötzlich wieder zu Geld gelangt, hat das Fest für Gruschenka wiederholt, war in der Nacht zuvor nachweislich zumindest im väterlichen Garten und hat dort flüchtend den alten Diener des Hauses niedergeschlagen. Dmitrij wird verhaftet, ausführlich befragt und schließlich angeklagt. Der Mordprozess bildet den Höhepunkt und Abschluss des Romans. Mehr muss hier gar nicht verraten werden.
Erzählerisch variiert Dostojewskij hier noch einmal das Erfolgsmuster aus Böse Geister: Ein Ich-Erzähler, der von Teilen der Handlung unmittelbarer Zeuge war, berichtet das Geschehen, wobei er wechselweise als auktorialer Erzähler oder distanzierter Beobachter auftreten kann. Nach einer langen Phase, die ganz anderen Themen gewidmet zu sein scheint und die nur ganz nebenbei die Kriminal-Handlung des zweiten Teils Stück für Stück vorbereitet, rückt ein Verbrechen und – diesmal – seine polizeiliche und juristische Behandlung in den Mittelpunkt, hier mit dem Schwergewicht auf dem Problem, das wirkliche Geschehen aus einer Reihe von Indizien herleiten zu können. Sowohl das Bild, das der Staatsanwalt von dem Geschehen entwirft, als auch die epistemische Kritik des Verteidigers an diesem Bild verfehlen das tatsächliche Geschehen, das dem Leser zwar mitgeteilt wird, in der Welt des Romans aber unbeweisbar bleibt. Besonders diese zweite Hälfte des Romans brilliert mit dem, was man Dostojewskijs „Psychologie“ zu nennen beliebt.
Insgesamt ein zu langer Roman, dem man aber dennoch eine gewisse Balance nicht ganz abstreiten kann. Während das Hauptthema des ersten Teils heute weitgehend obsolet geworden sein dürfte, ist der zweite Teil des Romans durchweg interessant, wenn hier auch einige Elemente deutlich zu dramatisch geraten sind. Allerdings ist der zweite Teil ohne die vorbereitenden Elemente des ersten nicht wirklich zu verstehen, so dass man nur die Wahl „ganz oder gar nicht“ hat.
Fjodor Dostojewskij: Die Brüder Karamasow. Aus dem Russischen von Swetlana Geier. Zürich: Ammann, 2003. Leinenband, Fadenheftung, 1279 Seiten. Lieferbar als Fischer Taschenbuch für 18,– €.