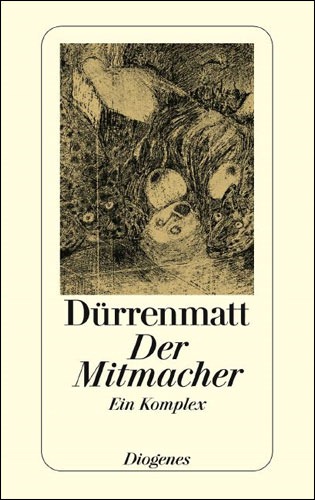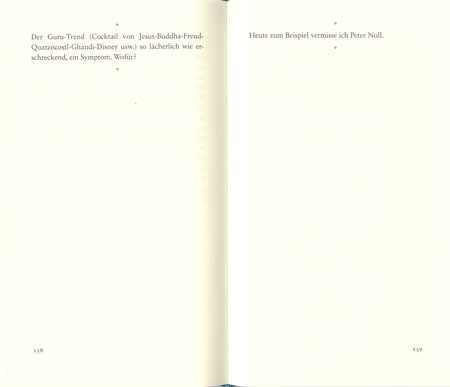Im Jahr 1972 entstand Friedrich Dürrenmatts Theaterstück Der Mitmacher, das 1973 in Zürich und noch im selben Jahr auch in Mannheim in direkter Zusammenarbeit mit dem Autor ohne Erfolg inszeniert wurde. Dieser Misserfolg veranlasste Dürrenmatt zu einer umfassenden Reflexion des Stückes in einem umfangreichen Nachwort; dieser ungewöhnliche Vorgang wiederum löste einen weiteren Durchgang der Reflexion in einem Nachwort zum Nachwort aus.
Beim Protagonisten von Der Mitmacher handelt es sich um einen promovierten Biologen, Doc genannt, der während einer Wirtschaftskrise entlassen wurde und sich daher als Taxifahrer seinen Lebensunterhalt verdiente. Er kommt dabei zufällig in Kontakt mit Boss, einem mächtigen Gangster, dem er sich nützlich macht, indem er ein Verfahren erfindet, Leichen zu verflüssigen und in der Kanalisation verschwinden zu lassen. Doc lebt in einem Untergeschoss eines alten Lagerhauses, wo er auch seiner Arbeit nachgeht und das er nur selten verlässt. Er hat aber dennoch ein Verhältnis mit Ann, der Geliebten von Boss, wobei weder Doc noch Ann ahnen, dass der jeweils andere ebenfalls für Boss arbeitet. Dürrenmatt versucht etwas ähnliches wie eine dramatische Handlung zu entwickeln, in dem er Cop auftreten lässt, einen scheinbar korrupten Polizeichef, der sich in das Geschäft um die verschwindenden Leichen hineindrängt. Außerdem tritt auch noch Bill, der Sohn Docs, auf, der die Chemiewerke geerbt hat, die Doc einst entlassen haben, und der seinen Reichtum dazu nutzen will, jährlich den Staatspräsidenten umbringen zu lassen. Das ganze Stück zeichnet sich durch denkbar knapp gehaltene Dialoge aus, in denen die Figuren versuchen, einander ihre wirklichen Motive zu verheimlichen; all das klingt wie eine schlechte Parodie auf billige amerikanische Gangster-Filme. Durchbrochen werden diese Dialoge durch Monologe der Hauptfiguren, in denen sie dem Publikum ihre wahren Motive oder ihre wirkliche Geschichte offenbaren.
Wahrscheinlich ist schon aus dieser Beschreibung heraus gut zu erkennen, warum das Stück durchgefallen ist. Im Nachwort finden sich Dürrenmatts Gedanken über die Gestaltung der einzelnen Figuren, ihrer Monologe und ihrer Beziehungen zueinander sowie über die dramaturgischen Probleme der Zürcher und Mannheimer Inszenierungen. Dürrenmatt spricht davon, dass er damit versuche, zu seinem Stück die Partitur nachzuliefern. Die Reflexionen des Nachworts sind durchweg einleuchtender und interessanter als die Szenen und Dialoge des Stückes, die sie erläutern. Das Stück leidet nicht unter einem Mangel an Intention und Konzeption, sondern im Gegenteil an einem Übermaß an beidem, das weder dem Zuschauer noch dem Leser ausreichend kommuniziert wird.
Das Nachwort zum Nachwort wiederum liefert im Wesentlichen allgemeine dramaturgische Gedanken insbesondere zu den Bühnenkonzepten Schicksal und Zufall sowie zwei Erzählungen: Eine, die die stoffliche Grundlage des Mitmachers liefert – sie ist wahrscheinlich ein wichtiger Wendepunkt für die Entwicklung der Dürrenmattschen Stoffe –, und das Punkstück des ganzen Mitmacher-Komplexes: Das Sterben der Pythia. Hier finden sich wesentliche Teile von Dürrenmatts Auseinandersetzung mit der antiken Tragödie, dem Drama Shakespeares und Brechts und seiner eigenen Dramaturgie des Zufalls.
Insgesamt handelt es sich bei Der Mitmacher wohl um einen der ungewöhnlichsten Texte der Nachkriegsliteratur. Man wird wohl keine vergleichbare Auseinandersetzung eines Autors mit einem seiner Misserfolge finden. Außerdem ist einmal mehr festzustellen, dass der die Zeiten überdauernde Teil von Dürrenmatts Werk der essayistische zu sein scheint. In seinen theoretischen Schriften, nicht in seinem Stücken beweist der Autor seine Qualitäten: Originalität des Gedankens, Reflexion der modernen Welt und ihrer Verstrickungen von Naturwissenschaften und Politik und Kritik von Macht und denen, die sie inne haben.
Der Mitmacher-Komplex stellt einen ungewöhnlichen Zugang zum Denken Dürrenmatts zur Verfügung, der sowohl eine Einführung in seine Dramaturgie als auch in die Stoffe bietet. Eine Empfehlung für alle, die sich ernsthaft mit Dürrenmatt auseinandersetzen wollen.
Friedrich Dürrenmatt: Der Mitmacher. Ein Komplex. detebe 23054. Zürich: Diogenes, 1998. 352 Seiten. 9,90 €.
 Umfangreiche Bild-Biografie anlässlich des 100. Geburtstags Frischs. Der Band enthält rund 300 Fotos, großteils in Schwarz-Weiß, die die gesamte Lebensspanne Frischs dokumentieren. Begleitet werden die Fotos durch sparsame, aber informative Texte, die einmal mehr Hages Kennerschaft belegen. Außerdem findet sich im Anhang drei umfangreiche Interviews, die Hage 1981 und 1982 mit Frisch geführt hat.
Umfangreiche Bild-Biografie anlässlich des 100. Geburtstags Frischs. Der Band enthält rund 300 Fotos, großteils in Schwarz-Weiß, die die gesamte Lebensspanne Frischs dokumentieren. Begleitet werden die Fotos durch sparsame, aber informative Texte, die einmal mehr Hages Kennerschaft belegen. Außerdem findet sich im Anhang drei umfangreiche Interviews, die Hage 1981 und 1982 mit Frisch geführt hat.