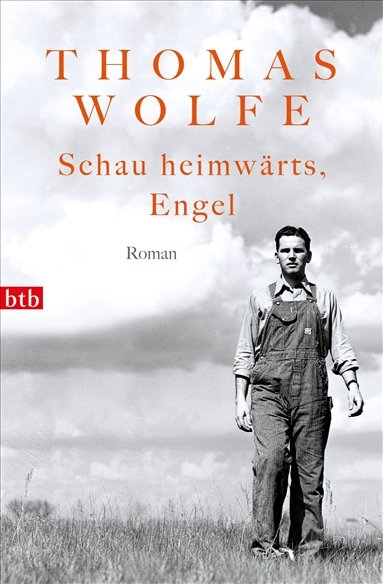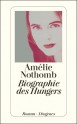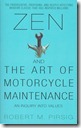Unter solchen Erzählungen also oder, richtiger gesagt, unter solchem Geschwätz verging manchmal die Zeit, die uns so langweilig war. Hergott, was war das für eine Langeweile! Die langen, schwülen Tage waren einander so ähnlich wie ein Ei dem anderen. Wenn man doch wenigstens ein Buch gehabt hätte!
Der junge Autor Fjodor Dostojewskij war im April 1849 verhaftet worden, da er an Treffen des Kreises um Michail Petraschewski teilgenommen hatte und damit in den Verdacht geraten war, ein Staatsfeind zu sein. Die Verhaftung stellte eine hysterische Reaktion des russischen Staates auf die europäischen Revolutionen von 1848/1849 dar, von denen man fürchtete, sie würden auch in Russland eine entsprechende Fortsetzung finden. Dostojewskij wurde zusammen mit anderen sogenannten Verschwörern zum Tode verurteilt und erst nach der Inszenierung einer Scheinhinrichtung zu vier Jahren Zwangsarbeit in Sibirien und anschließendem Militärdienst begnadigt.
Die Aufzeichnungen aus einem Totenhause sind nicht nur eine Verarbeitung der sibirischen Haftzeit, sie sind auch ein wichtiger Schritt für den Autor zurück in das literarische Leben Russlands. Dostojewskij war sich sicher, dass das Buch ein Erfolg werden würde, da bis dahin in der russischen Literatur keine Beschreibung des Gefangenenlebens in Sibirien existierte und das Buch deshalb allein stofflich auf großes Interesse stoßen werde. Ab Herbst 1861 erschien der Text in Fortsetzungen in der Monatszeitschrift Wremja, die von Dostojewskijs Bruder Michail herausgegeben wurde. Dass der Text hier erscheinen konnte, zeigt die inzwischen eingetretene Liberalisierung der russischen Verhältnisse unter Zar Alexander II.
Die Aufzeichnungen bedienen sich äußerlich der damals beliebten Form der Reiseerzählung: In einer Mischung aus objektivierender Erzählung und tagebuchartig präsentierten subjektiven Erlebnissen wird dem Leser ein Blick in eine ihm unbekannte Welt geboten. Normalerweise galt das Interesse exotischen Orten – der Südsee, der Wildnis ferner Kontinente etc. –, aber Dostojewskij begriff, dass diese Form zu weit mehr geeignet war. Um den autobiographischen Bezug abzuschwächen, benutzte er die im 19. Jahrhundert beliebte Herausgeber-Fiktion: Der Erzähler gerät zufällig an den schriftlichen Nachlass des ehemaligen Sträflings Alexander Petrowitsch Gorjantschikow, der wegen der Ermordung seiner Frau zur Zwangsarbeit in Sibirien verurteilt worden war und nach der Haft dort als Ansiedler sein Leben fristete. Wie wenig diese Herausgeber-Fiktion allerdings wahrgenommen wurde, zeigt sich darin, dass Dostojewskij sich für den Rest seines Lebens mit dem Verdacht herumschlagen musste, er selbst sei wegen Ermordung seiner Gattin nach Sibirien geschickt worden.
Dass die äußere Form nur als Hilfsmittel dient, wird besonders im zweiten Teil des Buches deutlich, dass in einzelnen Kapiteln zum Teil deutlich von diesem Muster abweicht. Am bekanntesten und berühmtesten dürfte die Binnenerzählung Akulinas Mann sein, die von der Karriere eines Trinkers erzählt, der aus finanziellen Motiven heraus eine unehrenhafte Frau heiratet, nach der Hochzeit ihre Unschuld erkennen muss und sie schließlich in einer Mischung aus Trunksucht, Wut und Selbstverachtung in einem Akt ungehemmter Gewalt ermordet. Dostojewskij nutzt hier nicht nur das allgemeine Interesse seiner Zeitgenossen an der vergleichsweise neuen Form der Kriminalerzählung, sondern dringt auch in Bereiche der Wirklichkeit vor, die literarisch zuvor nie geschildert worden waren. Das Buch besticht hier in jedem Detail durch Authentizität und Schonungslosigkeit der Darstellung. Es stellt eine wichtige Zwischenstufe zu Dostojewskijs späterer Auseinandersetzung mit Fragen der Moral und des Verbrechens dar.
Ein faszinierendes Buch, von dem ich bereue, es nicht schon früher gelesen zu haben, doch hatte ich immer Schwierigkeiten mit den älteren Übersetzungen Dostojewskijs ins Deutsche. Die bei Reclam vorliegende Übersetzung von Hermann Röhl stammt von 1921 und sollte besser durch eine aktuelle ersetzt werden.
Fjodor Dostojewskij: Aufzeichnungen aus einem Totenhause. Aus dem Russischen von Hermann Röhl. RUB 2647. Stuttgart: Reclam, 1999/2017. Broschur, 511 Seiten. 9,– €.