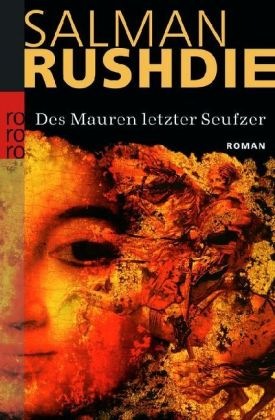Der Roman eines Tages, des 15. Februar 2003 in London, eines Samstags, wie der Titel schon verrät. Für den Protagonisten, den erfolgreichen und renommierten Neurochirurgen Henry Perowne, beginnt der Tag merkwürdig genug: Er wacht viel zu früh auf und beobachtet, am Fenster stehend, ein brennendes Flugzeug, das zur Landung in Heathrow ansetzt. Es wird sich erweisen, dass dies am Ende so harmlos ist, wie der ganze Roman.
Der Roman eines Tages, des 15. Februar 2003 in London, eines Samstags, wie der Titel schon verrät. Für den Protagonisten, den erfolgreichen und renommierten Neurochirurgen Henry Perowne, beginnt der Tag merkwürdig genug: Er wacht viel zu früh auf und beobachtet, am Fenster stehend, ein brennendes Flugzeug, das zur Landung in Heathrow ansetzt. Es wird sich erweisen, dass dies am Ende so harmlos ist, wie der ganze Roman.
Henry Perowne ist 48 Jahre alt, mit einer Anwältin verheiratet, hat zwei wundervolle, hochbegabte Kinder und kommt selbst mit seinem berühmten Schwiegervater, einem Dichter, irgendwie zurecht. Henry ist Rationalist, Squash-Spieler, Mercedes-Fahrer, Bach-Liebhaber, Hobby-Koch und auch sonst ein blitzgescheiter Kerl.
Leider passiert ihm auf dem Weg zum Squash ein kleines Malheur: Durch eine Zusammenrottung unglücklicher Umstände hat er in seinem Mercedes 500 einem leichten Zusammenstoß mit einem roten BMW. Damit ist die Konflikthöhe einer klassisch griechischen Tragödie erreicht: Dem BMW entsteigt ein neurologisch erkrankter Kleinkrimineller – im Folgenden Baxter genannt – mit zwei Schlägern. Doch das diagnostische Genie Perownes hilft ihm aus der Patsche: Sofort erkennt er das Krankheitsbild Baxters, der daraufhin verwirrt und gedemütigt das Weite sucht. Nach einem knapp verlorenen Squash-Spiel gegen seinen Chef-Anästhesisten kauft Perowne Fisch ein, besucht seine demente Mutter im Pflegeheim, wohnt einer Probe seines Gitarre spielenden Sohnes bei und fährt dann heim, um zu kochen.
Dort trifft zuerst seine in Paris studierende Tochter ein, die unmittelbar vor der Veröffentlichung ihres ersten Gedichtbandes steht, anschließend der ebenfalls dichtende Schwiegervater, dann der Sohn. Schließlich treffen auch Henrys Frau und mit ihr zusammen der lang erwartete Baxter ein, der sich zuerst bedrohlich gibt, dann aber von einem Gedicht verzaubert und anschließend von Vater und Sohn gemeinsam die Treppe heruntergeworfen wird.
Es kommt, wie es kommen muss: Baxter wird in das Krankenhaus eingeliefert, in dem Perowne arbeitet; der wird vom Squash spielenden Anästhesisten angerufen und fährt ins Krankenhaus, um dort gänzlich leidenschaftslos die Operation Baxters durchzuführen. Alles wird gut! Nach alles in allem etwa 24 Stunden kehrt Perowne in sein Haus zurück, tröstet noch kurz seine Frau, sieht noch ein Flugzeug, das diesmal aber nicht brennt, und schläft mit dem Gedanken ein, dass dieser Tag vorbei ist.
Das Buch ist in seinem Gehalt so albern, wie hier dargestellt. Daran ändert auch nichts, dass die Londoner Großdemonstration gegen den Krieg im Irak den Hintergrund bildet oder sich Perowne Sorgen um die Sicherheitslage der Welt und seiner Familie macht. Der Roman brilliert dagegen auf zwei Ebenen: Zum einen beherrscht McEwan sein Handwerk, wenn es ihm problemlos gelingt, die Lebensgeschichte seines Protagonisten glatt und bruchlos in den Ablauf eines einzigen Tages einfließen zu lassen. Hier steht natürlich der Joycesche Ulysses im Hintergrund und McEwans trivialisierte Fassung beweist einmal mehr sein schriftstellerisches Geschick. Zum anderen sind die Details einzelner Szenen mit beeindruckender Präzision geschildert, was man insbesondere daran merkt, dass diese Sequenzen auch einen Leser fesseln, der sich mit diesen Dingen nicht auskennt oder sich nicht für sie interessiert. Perownes Diagnosen langweilen nicht, auch wenn man nicht in der Lage ist, jeden Terminus technicus zu verstehen und einzuordnen. Und ich hätte niemals geglaubt, mit Interesse der Beschreibung eines Squash-Spiels folgen zu können, aber hier hat mich die entsprechende Passage nicht gestört.
Dass der Autor allerdings die Chuzpe hat, indirekt zu behaupten, er unternehme in diesem Buch nichts anderes als das, was Flaubert und Tolstoi auch gemacht hätten, macht die Sache nicht wirklich besser:
Unter Daisys Anleitung hatte Henry immerhin Anna Karenina und Madame Bovary gelesen, zwei anerkannte Meisterwerke. Obwohl er seine Denkvorgänge verlangsamen und viele Stunden kostbarer Zeit aufwenden mußte, hatte er sich den wechselnden Komplikationen dieser anspruchsvollen Märchen anvertraut. Doch welche Einsichten hielten sie letztlich bereit? Daß Ehebruch zwar verständlich, aber falsch ist, daß es Frauen im neunzehnten Jahrhundert nicht besonders leicht gehabt haben und daß Moskau, die russische Landschaft und die französische Provinz so und nicht anders ausgesehen hatten? Falls, wie Daisy behauptete, das Genie im Detail lag, dann war er keineswegs beeindruckt. Die Details waren angemessen und überzeugend beschrieben, doch jeder auch nur halbwegs aufmerksame Beobachter sollte sie geordnet wiedergeben können und dürfte, wenn er die nötige Geduld besaß, es wohl kaum besonders schwierig finden, derlei niederzuschreiben. Diese Bücher waren das Ergebnis eines unerbittlichen, fachkundigen Sammeleifers.
Immerhin erlaubt er wenig später einer seiner Figuren, leise Zweifel am Lektüreansatz seines Protagonisten anzumelden.
All dies ändert aber nichts an der Tatsache, dass Henry Perowne ein alberner Supermann von einem Protagonisten und die Fabel von dummer Berechenbarkeit ist und der Autor mit keinem seiner angerissenen Konflikte auch nur für einen einzigen Augenblick Ernst macht. Selbst wenn man unterstellen wollte, McEwan habe einen Roman schreiben wollen, wie ihn etwa sein Protagonist gerade noch zu schreiben in der Lage wäre, überzeugt die einfältige und zu durchschaubare Konstruktion nicht. Eine Schauerkomödie der Besserverdienenden, Schönen und Erfolgreichen.
Ian McEwan: Saturday. Aus dem Englischen von Bernhard Robben. detebe 23627. Zürich: Diogenes, 2007. 390 Seiten. 10,90 €.