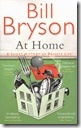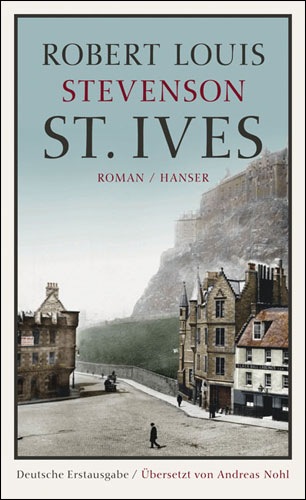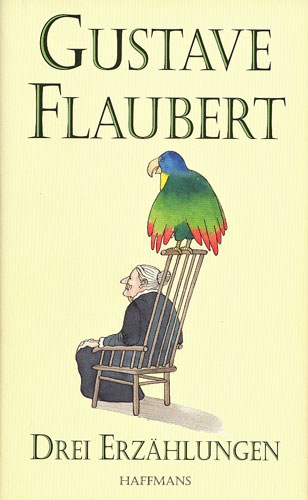Nach dem doch etwas schwächelnden achten Band der Rougon-Macquart trumpft Zola im neunten Band auf: Mit »Nana« liefert er einen ersten Höhepunkt des Zyklus, der nicht nur als Skandalbuch bereits bei der Auslieferung der ersten Auflage komplett verkauft war, sondern sich bis heute als einer der bekanntesten Romane Zolas durchgesetzt hat. Die Erzählung schließt direkt an »Der Totschläger« an: Nana ist die Tochter des Ehepaars Coupeau, deren Niedergang dieser siebte Band des Zyklus thematisiert hatte. Die Handlung setzt im Jahr 1867 ein; Nana ist – so behauptet es wenigstens der Roman – achtzehn Jahre alt (gemäß der inneren Chronologie der Romane dürfte sie allerdings erst 15 sein, da sie 1852 geboren wurde) und feiert einen Skandalerfolg auf der Bühne des Théâtre des Variétés in einer etwas wirren Parodie auf Offenbachs »Orfeus in der Unterwelt«, allerdings nicht aufgrund ihrer schauspielerischen oder sängerischen Begabung, sondern weil sie als Venus beinahe nackt auf der Bühne erscheint.
Nach dem doch etwas schwächelnden achten Band der Rougon-Macquart trumpft Zola im neunten Band auf: Mit »Nana« liefert er einen ersten Höhepunkt des Zyklus, der nicht nur als Skandalbuch bereits bei der Auslieferung der ersten Auflage komplett verkauft war, sondern sich bis heute als einer der bekanntesten Romane Zolas durchgesetzt hat. Die Erzählung schließt direkt an »Der Totschläger« an: Nana ist die Tochter des Ehepaars Coupeau, deren Niedergang dieser siebte Band des Zyklus thematisiert hatte. Die Handlung setzt im Jahr 1867 ein; Nana ist – so behauptet es wenigstens der Roman – achtzehn Jahre alt (gemäß der inneren Chronologie der Romane dürfte sie allerdings erst 15 sein, da sie 1852 geboren wurde) und feiert einen Skandalerfolg auf der Bühne des Théâtre des Variétés in einer etwas wirren Parodie auf Offenbachs »Orfeus in der Unterwelt«, allerdings nicht aufgrund ihrer schauspielerischen oder sängerischen Begabung, sondern weil sie als Venus beinahe nackt auf der Bühne erscheint.
Den aus diesem Skandal folgenden Ruhm nutzt sie allerdings vorerst nur für kurze Zeit, denn sie verliebt sich in einen Kollegen, für den sie zeitweilig alle anderen Männer ignoriert und mit dem sie eine gemeinsame Wohnung bezieht. Nachdem allerdings ihr Geld aufgebraucht ist, erweist sich dieser Liebhaber rasch als tyrannischer und meistens schlecht gelaunter Patron, der Nana zudem auch noch betrügt. Als von ihr finanziell nichts mehr weiter zu erwarten ist, setzt er sie von jetzt auf gleich vor die Tür.
Nana kehrt noch einmal kurz und erfolglos auf die Bühne zurück, wo sie sich vergeblich als ernsthafte Schauspielerin in der Rolle der Dame von Welt zu etablieren versucht, vom Publikum aber schlicht ausgelacht wird. Allerdings gelingt es ihr zugleich, sich einen neuen, finanzkräftigen Verehrer zu sichern: Graf Muffat, ein bislang tugendhafter und gut katholischer Spießer verfällt Nana komplett:
Jeder Kampf in ihm hatte aufgehört. Eine Woge von neuem Leben ertränkte seine Vorstellungen und seine Glaubenssätze von vierzig Jahren. Während er die Boulevards entlangging, dröhnte ihm beim Rollen der letzten Wagen Nanas Name in den Ohren, ließen die Gaslampen nackte Stellen, die geschmeidigen Arme und die weißen Schultern Nanas, vor seinen Augen tanzen; und er fühlte, daß er ihr verfallen war; er hätte alles verleugnet, alles verkauft, um sie noch an diesem Abend eine Stunde lang zu besitzen. Seine Jugend war es, die endlich erwachte, eine gierige jünglinghafte Pubertät, die plötzlich in seiner Kälte eines Katholiken und in seiner Würde eines reifen Mannes brannte.
Mit dem Vermögen des Grafen und einiger anderer Männer tritt Nana nun ihren gesellschaftlichen Siegeszug an: Dem Stand nach immer noch eine Prostituierte wird sie innerhalb weniger Monate durch eine maßlose Verschwendung zum Mittelpunkt der Pariser Gesellschaft. Als schließlich auch noch ein auf ihren Namen getauftes Pferd unerwartet den Großen Preis von Paris gewinnt, steigt sie zu einer bis dahin unbekannten Prominenz auf. Sie betrügt nun den Grafen in aller Offenheit, nimmt ihn und seine Nebenbuhler systematisch aus, wobei ihr das Geld von einem Augenblick zum anderen zwischen den Fingern verrinnt – so ist sie in einer Sequenz nicht in der Lage, einem Bäcker seine Rechnung über 133 Francs zu bezahlen, obwohl sie gleichzeitig zehntausende für ein neues Bett ausgibt – und treibt ihr Spiel aus Gier und Langeweile am Ende soweit, dass sie nicht nur mehrere der ihr zu Füßen liegenden Herren komplett ruiniert hat, sondern von dem ihr hörigen Grafen auch noch beim Geschlechtsakt mit seinem Schwiegervater, einem musterhaften Adeligen alter Schule, überrascht wird.
Gleich jenen antiken Ungeheuern, deren gefürchteter Bereich mit Gebeinen bedeckt war, setzte sie die Füße auf Schädel; und Katastrophen umgaben sie: der wilde Flammentod Vandeuvres, die Schwermut Foucarmonts, der in den Meeren Chinas umherirrte, der völlige Bankrott Steiners, der gezwungen war, als ehrbarer Mensch zu leben, der befriedigte Schwachsinn La Faloises, der tragische Zusammenbruch der Muffats und der weiße Leichnam Georges, an dem Philippe, der gestern aus dem Gefängnis gekommen war, Wache hielt. Ihr Zerstörungs- und Todeswerk war vollbracht; die vom Unrat der Vorstädte aufgeflogene Fliege, die den Gärungsstoff der gesellschaftlichen Fäulnis mit sich führte, hatte alle diese Männer durch ihre bloße Berührung vergiftet. Das war gut, das war gerecht; sie hatte ihre Welt, die Bettler und die Verlassenen, gerächt. Und während ihr Geschlecht in einem Glorienschein emporstieg und gleich einer aufgehenden Sonne, die die Stätte eines Blutbades bescheint, über seinen hingestreckten Opfern strahlte, bewahrte sie, stets gutmütig, ihre Ahnungslosigkeit eines prächtigen Tieres, das nichts von dem weiß, was es angerichtet hat. Sie blieb dick, sie blieb fett, bei guter Gesundheit und strahlender Heiterkeit. Das alles zählte nicht mehr, ihr Haus erschien ihr blöde, zu klein und voller Möbel, die sie behinderten. Eine Erbärmlichkeit, gerade gut genug für den Anfang. So träumte sie denn auch von etwas Besserem; und sie brach in großer Toilette auf, um Satin ein letztes Mal zu küssen, sauber, kräftig, ganz frisch aussehend, als sei sie völlig unverbraucht.
Doch ist dies der letzte Höhepunkt vor dem Untergang. Nana verkauft all ihren Besitz und verschwindet aus Paris, nur um im Juli 1870, am Fuß des deutsch-französischen Krieges zurückzukehren, sich bei ihrem in Paris zurückgebliebenen Kind mit Blattern anzustecken und binnen Kurzem das Zeitliche zu segnen. Mit ihrem Tod geht auch das Zweite Kaiserreich seinem Ende entgegen: Während Nana in einem Hotelzimmer umgeben von ihren alten Kolleginnen mit dem Tod kämpft, erschallen unten auf der Straße die Rufe »Nach Berlin! Nach Berlin! Nach Berlin!«
Ohne jede Einschränkung ist dieser bitterböse Gesellschaftsroman ein Meisterstück zu nennen. Er verfügt trotz seiner beinahe 500 Seiten über ein furioses Tempo, ist von einer brillanten Konstruktion und einer bis dahin wohl unerreichten Wahrhaftigkeit in der Darstellung der gutbürgerlichen Gesellschaft des 19. Jahrhunderts. Es ist daher kein Wunder, dass selbst Gustave Flaubert, der alles andere als leicht zu beeindrucken war, diesen Roman in den höchsten Tönen gelobt hat. Oder um es mit Lichtenberg zu sagen: »Wer zwei Paar Hosen hat, mache eins zu Geld und schaffe sich dieses Buch an.«
Übersichtsseite zur Rougon-Macquart
Émile Zola: Die Rougon-Macquart. Natur- und Sozialgeschichte einer Familie unter dem zweiten Kaiserreich. Hg. v. Rita Schober. Berlin: Rütten & Loening, 1952–1976. Digitale Bibliothek Bd. 128. Berlin: Directmedia Publ. GmbH, 2005. 1 CD-ROM. Systemvoraussetzungen: PC ab 486; 64 MB RAM; Grafikkarte ab 640×480 Pixel, 256 Farben; CD-ROM-Laufwerk; MS Windows (98, ME, NT, 2000, XP oder Vista) oder MAC ab MacOS 10.3; 256 MB RAM; CD-ROM-Laufwerk. 10,– €.
 Johannes Willms setzt die Reihe seiner französischen Biographien fort, diesmal mit einem Seitenstück zu seiner umfangreichen Napoleon-Biographie. Talleyrand ist wohl eine der schillerndsten politischen Figuren der Wendezeit zur europäischen Moderne. Er hat es verstanden sowohl vor und während der Französischen Revolution als auch unter Napoleon und der auf ihn folgenden Restauration bedeutende politische Positionen einzunehmen. Keine seiner politischen Niederlagen hat ihn wirklich zu Fall gebracht, jeder seiner Rücktritte markiert nur eine Phase des Übergangs bis zum nächsten Aufstieg in Amt und Würden. Selbst als er sich mit guten Gründen und aus freien Stücken endgültig ins Privatleben zurückziehen wollte, erwies sich sein Drang zu Macht und Einfluss als zu stark, und er betrat binnen Kurzem wieder die politische Bühne. Dabei muss er im persönlichen Umgang ein bestrickender Gesprächspartner voller Esprit gewesen sein.
Johannes Willms setzt die Reihe seiner französischen Biographien fort, diesmal mit einem Seitenstück zu seiner umfangreichen Napoleon-Biographie. Talleyrand ist wohl eine der schillerndsten politischen Figuren der Wendezeit zur europäischen Moderne. Er hat es verstanden sowohl vor und während der Französischen Revolution als auch unter Napoleon und der auf ihn folgenden Restauration bedeutende politische Positionen einzunehmen. Keine seiner politischen Niederlagen hat ihn wirklich zu Fall gebracht, jeder seiner Rücktritte markiert nur eine Phase des Übergangs bis zum nächsten Aufstieg in Amt und Würden. Selbst als er sich mit guten Gründen und aus freien Stücken endgültig ins Privatleben zurückziehen wollte, erwies sich sein Drang zu Macht und Einfluss als zu stark, und er betrat binnen Kurzem wieder die politische Bühne. Dabei muss er im persönlichen Umgang ein bestrickender Gesprächspartner voller Esprit gewesen sein.