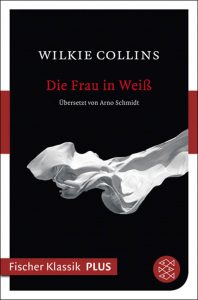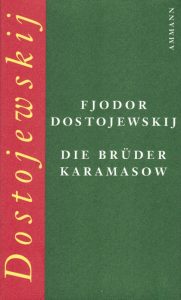Diesen Roman habe ich zusammen mit den meisten anderen Übersetzungen Arno Schmidts am Ende meiner Studienzeit während der Niederschrift meiner Dissertation nebenbei gelesen. Nun hat mich die Schmidt-Biografie von Sven Hanuschek noch einmal neugierig gemacht, meinen damaligen, nicht so sehr guten Eindruck noch einmal zu überprüfen. Und es hat sich wenigstens teilweise gelohnt: Während ich vor 25 Jahren den Roman durchgehend bemüht und langweilig fand, habe ich mich diesmal wenigstens über einige Strecken hinweg durchaus amüsiert, wenn der Roman auch nicht so ist, dass er eine zweite Lektüre wirklich vertragen würde.
Erzählt wird in der Hauptsache die Geschichte des Zeichenlehrers Walter Hartrights und seiner Liebe zu seiner Schülerin Laura Fairlie, einer jungen Frau, die als potenzielle Erbin eines großen Vermögens als Gattin Walters zumindest zu Beginn des Romans nicht in Frage kommt. Ganz getreu dem Motto, Literatur habe zu erzählen, was wahrscheinlich passiert, wenn etwas Unwahrscheinliches passiert, begegnet Walter in der Nacht, bevor er seine Stelle als Zeichenlehrer bei den Fairlies antritt, auf dem nächtlichen Heimweg einer geheimnisvollen Frau in weißen Kleidern, die sich nicht nur als Doppelgängerin Lauras erweist, sondern mit ihr auch in der Kindheit eine Zeitlang zusammengelebt hat. Den eigentlichen Handlungsknoten aber schürzt dann die Hochzeit Lauras mit Sir Percival Glyde, dem es offensichtlich nur darum geht, an das Vermögen Lauras zu kommen, um seine drängenden Schulden zu bezahlen. Es dürfte nicht zuviel verraten sein, wenn man sagt, dass etwa in der Mitte des Buches die Katastrophe eintritt, Laura beerdigt wird, ohne gestorben zu sein, und Sir Percival in den Besitz des Geldes kommt, das ihn aber auch nicht vor dem Untergang retten kann. Die zweite Hälfte des Buches wird auf’s Umständlichste damit verbracht, den bis dahin erzielten Schaden wenigstens einigermaßen wieder gut zu machen.
Trotz seiner Länge und Behäbigkeit besonders im zweiten Teil scheint sich das Buch seit über 150 Jahren ungebrochen der Sympathie der Leser zu erfreuen. Das mag zum einen an seiner Vielfalt von Erzählerfiguren liegen, die Abwechslung in der Einöde vortäuscht, zum anderen aber sicherlich auch an seiner wichtigsten Nebenfigur, dem Italiener Conte Fosco, der zwischen gebildetem Gentleman und schmierigem Intriganten changiert. Schmidts Übersetzung ist, wie viele seiner späten Übersetzungen, ein wenig manieristisch, insgesamt aber gut lesbar.
Wilkie Collins: Die Frau in Weiß. Aus dem Englischen von Arno Schmidt. Kindle-Edition. Frankfurt/M.: Fischer E-Books, 2014. 896 Seiten (Druck-Ausgabe). 9,99 €.