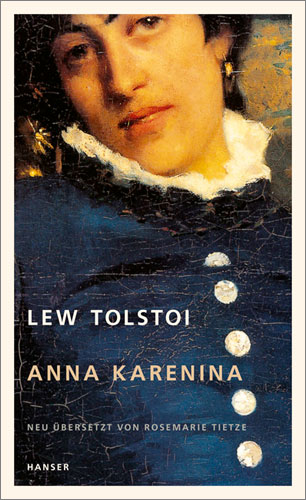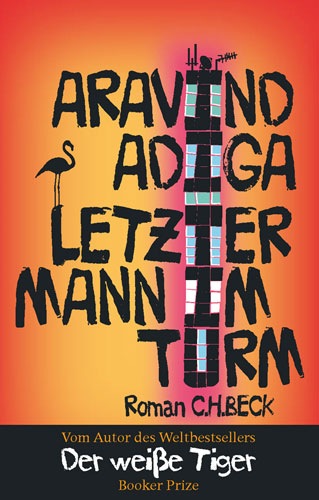Zum ersten Mal habe ich „Anna Karenina“ noch zu Schulzeiten gelesen, so habe ich damals wenigstens geglaubt. Es handelte sich um eine Ausgabe des Lingen-Verlages, der damals schon preiswerte Lizenzausgaben für Zeitungsverlage herstellte. Unter anderem gab es auch eine ganze Reihe von Klassikern der Weltliteratur, alle in sehr hässliches grünes Kunstleder eingebunden und auf sehr handfestem Papier gedruckt. Die Ausgabe der „Anna Karenina“ hatte in dieser Reihe knapp 430 Seiten. Als ich das Buch dann zum zweiten Mal während des Studiums las – ich versuchte, mir einen Überblick über die wichtigen Ehe-Romane des 19. Jahrhunderts zu verschaffen – war es der Text der Winkler-Ausgabe, übersetzt von Fred Ottow, im Einband der dtv-Weltliteratur. Hierbei handelte es sich angeblich um eine vollständige Ausgabe und sie hatte immerhin gut 970 Seiten, also deutlich mehr als das Doppelte an Text. Damals ist mir die Lektüre ungewöhnlich schwer gefallen, denn in Ottows Übersetzungen erschienen mir alle Hauptfiguren wie Karikaturen wirklicher Menschen und so die gesamte Konstruktion des Romans wenig überzeugend. Ob das an meiner damaligen Verfasstheit oder tatsächlich an der Übersetzung lag, habe ich nicht noch einmal geprüft. Bei der jetzigen, dritten Lektüre habe ich die Neuübersetzung durch Rosemarie Tietze gelesen, in der es der Roman auf stattliche 1227 Seiten bringt. Dieser Ausgabe glaube ich nun auch, dass sie tatsächlich vollständig ist.
Allerdings muss ich gleich eingestehen, dass ich mich mit dieser dritten Lektüre recht schwer getan habe und sie, läge ihr nicht eine didaktische Verpflichtung zugrunde, wahrscheinlich nicht abgeschlossen hätte. Es lag nicht allein an der Länge des Buches, aber auch. Denn es erscheint mehr als verständlich, dass gerade „Anna Karenina“ ein massives Opfer der Textbearbeitung bzw. -kürzung geworden ist: Tolstoi verschränkt in diesem Buch zwei Romane miteinander, von denen nur einer zu Recht den Titel „Anna Karenina“ trägt. Die Fabel um Konstantin Lewin, die den anderen Roman ausmacht, kann für sich allein kaum einen berechtigten Anspruch auf Interesse machen und ist zudem so mit Reflexionen über Religion, Ökonomie und Philosophie überladen – immer durch den nicht wirklich umfassenden Horizont Tolstois beschränkt –, dass die meisten Leser sicherlich dankbar sind, nur den Roman um die Titelfigur vorgelegt zu bekommen und von all dem anderen weitgehend verschont zu bleiben. Andererseits muss man natürlich respektieren, dass Tolstoi die tragische Skandalgeschichte um Anna als Vehikel benutzt hat, um eine ihm wichtige Position zum Prozess der Säkularisierung der europäischen Kultur zu thematisieren. Dass gerade dieser Anteil für den überwiegenden Teil seiner heutigen Leser eher obsolet geworden ist, hat er zwar ahnen, aber nicht wirklich berücksichtigen können.
Es werden also eigentlich zwei Geschichten erzählt: Die bekanntere und vielfach verfilmte ist die der Ehebrecherin Anna Karenina. Anna verliebt sich wider Willen in den jungen, noch etwas unreifen Offizier Wronski, der eigentlich ihrer Nichte Kitty den Hof macht. Auch Wronski, der zu Anfang glaubt, sich auf ein gewöhnliches Abenteuer einzulassen, wird bald von seinen Gefühlen überwältigt. Die Affäre gerät zum Skandal, als Anna schwanger wird und in einem Moment emotionaler Aufgeregtheit ihrem Mann bestätigt, was dieser längst vermutet. Was folgt, ist das lange Leiden und schließlich der Zusammenbruch Annas: Sie stirbt beinahe bei der Geburt ihrer Tochter mit Wronski, erholt sich aber wieder, geht mit Wronski nach Italien, kehrt nach Russland zurück, versucht von ihrem Mann die Scheidung zu erreichen, leidet immer mehr daran, dass sie Wronski nicht durch eine Heirat an sich binden kann und tötet sich schließlich in einem sich wahnhaft zuspitzenden Anfall von Eifersucht und Verzweiflung, indem sie sich unter einen Zug wirft.
Die Geschichte Konstantin Lewins dagegen hängt mit der Annas nur darüber zusammen, dass Lewin wie Wronski einer der Bewerber um Kittys Gunst ist. Sein Antrag wird von Kitty abgewiesen, die zu dem Zeitpunkt noch glaubt, sie werde Wronski heiraten. Als diese Hoffnung in der Affäre Wronskis mit Anna untergeht, erkrankt Kitty ernsthaft und wird von ihrer Familie zur Erholung nach Westeuropa gebracht. Es dauert sehr lange, bis sich Kitty und Lewin wiedersehen; in dieser Zeit lässt der Autor seinen Zweithelden auf seinem Gut ökonomischen Theorien nachhängen und diese mit anderen Gutsbesitzern diskutieren. Als sich die beiden vom Autor für einander Bestimmten endlich erneut treffen, einigt man sich rasch. Anschließend muss die Hochzeit vorbereitet und abgehalten werden, und dann müssen die Eheleute ein Eheleben für sich finden. Zwischzeitlich stirbt ein Bruder Lewins, was ihn auf die Frage nach dem Leben nach dem Tode stößt. Schließlich durchläuft Lewin eine intensive Phase von Selbstzweifel und Sinnsuche, die sich am Ende des Romans in eine Epiphanie christlicher Einsicht auflöst. Es kann wenig Zweifel daran bestehen, dass Tolstoi gerade dieser letzte Teil, der seine eigene Rückwendung zum Christentum thematisiert, der wichtigste Teil des Romanes war. Es kann ebensowenig Zweifel daran bestehen, dass er schon 1878 obsolet und wenig überzeugend war und bis heute nicht an Kraft gewinnen konnte. Natürlich ist die Säkularisierung der europäischen Kultur eines der gewichtigsten Themen der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, aber Tolstois Lösung ist letztlich resigantiv und rückwärtsgewandt. Es nimmt wenig Wunder, dass Tolstoi mit dieser Position einer der säkularen Heiligen des späten 19. Jahrhunderts geworden ist.
Die neue Übersetzung von Rosemarie Tietze ist gut zu lesen und bietet einem Leser wie mir, der das Original nicht zum Vergleich heranziehen kann, kaum Widerstände. Der Gesamteindruck hat sich – sieht man von der oben bereits gemachten Einschränkung ab – um Welten von dem der Übersetzung Ottows unterschieden; nur ist der Roman eben unmäßig lang geraten. Was kein Plädoyer für die gekürzten Ausgaben darstellt; wer Tolstoi lesen will, muss schlicht in den sauren Apfel der ausschweifenden Philosopheme beißen, sonst soll er sich eben eine der zahlreichen Verfilmungen des Stoffs ansehen oder etwas anderes lesen.
Lew Tolstoi: Anna Karenina. Übersetzt von Rosemarie Tietze. München: Hanser, 2009. Leinen, Fadenheftung, Lesebändchen, 1285 Seiten. 39,90 €. Auch als Taschenbuch (dtv 13995) lieferbar.