Laut dem »Blättchen« fällt Georg Kreisler
zu Theodor W. Adornos Verdikt, daß es barbarisch sei, nach Auschwitz noch Gedichte schreiben, nur ein Satz ein: „So ein intelligenter Mensch und so ein Unsinn!“
So ein intelligenter Mensch und so ein Unsinn!
Lektüren eines Nachtwächters
Laut dem »Blättchen« fällt Georg Kreisler
zu Theodor W. Adornos Verdikt, daß es barbarisch sei, nach Auschwitz noch Gedichte schreiben, nur ein Satz ein: „So ein intelligenter Mensch und so ein Unsinn!“
So ein intelligenter Mensch und so ein Unsinn!
 Der vierte Roman der Rougon-Macquart: Nachdem die Teile 2 und 3 des Zyklus in Paris spielen, kehrt der 4., wie bereits der Titel anzeigt, in die französische Provinz zurück. Die Romanhandlung umfasst die Jahre 1857 bis 1863 und erzählt im Wesentlichen die Geschichte des Abbé Faujas, der offensichtlich mit einer politischen Agenda nach Plassans kommt. Er wird Mieter bei François und Marthe Mouret, Cousin und Cousine aus der Familie Rougon-Macquart, die miteinander verheiratet sind und drei Kinder haben. Ihre beiden Söhne Octave und Serge gehen zu Anfang des Romans noch zur Schule, die Tochter Désirée ist geistig etwas zurückgeblieben und verbringt ihre Zeit hauptsächlich zusammen mit ihrer Mutter im Haus. Vater Mouret hat sich als Kaufmann zur Ruhe gesetzt, lebt im Wesentlichen von seinem Vermögen, das er hier und da durch ein lukratives Geschäft aufbessert.
Der vierte Roman der Rougon-Macquart: Nachdem die Teile 2 und 3 des Zyklus in Paris spielen, kehrt der 4., wie bereits der Titel anzeigt, in die französische Provinz zurück. Die Romanhandlung umfasst die Jahre 1857 bis 1863 und erzählt im Wesentlichen die Geschichte des Abbé Faujas, der offensichtlich mit einer politischen Agenda nach Plassans kommt. Er wird Mieter bei François und Marthe Mouret, Cousin und Cousine aus der Familie Rougon-Macquart, die miteinander verheiratet sind und drei Kinder haben. Ihre beiden Söhne Octave und Serge gehen zu Anfang des Romans noch zur Schule, die Tochter Désirée ist geistig etwas zurückgeblieben und verbringt ihre Zeit hauptsächlich zusammen mit ihrer Mutter im Haus. Vater Mouret hat sich als Kaufmann zur Ruhe gesetzt, lebt im Wesentlichen von seinem Vermögen, das er hier und da durch ein lukratives Geschäft aufbessert.
In dieses bürgerlich ruhige, wenn auch etwas enge Familienleben kommt durch die Ankunft des Abbés und seiner Mutter Bewegung. Während diese beiden Mieter sich zu Anfang sehr zurückhaltend und diskret verhalten, beginnt im Laufe der Zeit das, was der Titel des Romans bereits besagt: Abbé Faujas, der zuerst als etwas obskure Gestalt in fadenscheiniger Kleidung auftritt, gewinnt langsam aber sicher mehr und mehr Sympathien in Plassans. Damit einher geht, dass er und seine Mutter in immer familiäreren Umgang mit der Familie Mouret kommen, was zu dramatischen Veränderungen in deren Familienleben führt. Vater Mouret, bislang ein unangefochtener Patriarch, wird durch den Einfluss des Priesters auf Marthe und die Köchin zur Randfigur im eigenen Haus. Marthe entschlüpft der atheistischen und antiklerikalen Indoktrination ihres Ehemannes und entwickelt als Ausdruck ihrer Verliebtheit in den Abbé eine schwärmerische Religiosität, der Sohn Serge geht sogar ins Priesterseminar, Tochter Désirée kommt in Pflege zu ihrer Amme, kurz gesagt: Der Haushalt Mouret löst sich peu à peu auf.
Was die gute Gesellschaft Plassans angeht, so vermeidet es Abbé Faujas sorgfältig, sich einer der politischen Parteien anzuschließen. Er hat das Haus der Mourets überhaupt nur als Wohnung ausgewählt, weil der Garten der Mourets genau zwischen zwei anderen Gärten liegt, in denen regelmäßig die beiden politisch führenden Gruppen Plassans zusammenkommen. Der eigentliche Grund für Faujas Anwesenheit in Plassans ist, wie schon gesagt, ein politischer, der aber von Zola bemerkenswert zurückhaltend dargestellt wird. Der Abbé ist offenbar ein Agent von Eugène Rougon, der es in Paris zum Innenminister gebracht hat und dem daran gelegen ist, den derzeitigen Abgeordneten von Plassans in der Nationalversammlung, einen Marquis de Lagrifoul, der im Roman sonst keine Rolle spielt, durch eine politisch unbedeutende Figur ersetzen zu lassen. Es genügt zu sagen, dass es dem Abbé gelingt, seinen Stellung in Plassans soweit auszubauen, dass es ihm ein Leichtes ist, die nächste Wahl entsprechend zu beeinflussen. Allerdings endet der Roman in einer unvorhersehbaren Katastrophe.
Der Roman gewinnt seinen Reiz im Wesentlichen daraus, dass Zola drei soziale Modelle parallel beschreibt: Die Familie Mouret, deren Haushalt durch ihre Mieter komplett zerstört wird, die Kleriker von Plassans und ihre Intrigen um Anerkennung und Macht und schließlich die Oberen 50 von Plassans mit ihren Eitelkeiten und ihrem kleinkarierten Geschwätz. Dass der Roman zu den eher unbekannten Zolas gehört, mag daran liegen, dass der Leser längere Zeit nicht genau weiß, wohin sich die Handlung entwickeln wird und warum er diesen Figuren folgt. Weder der Abbé noch die Familie Mouret sind für sich genommen interessant genug, um die Spannung aufrecht zu erhalten. Man muss dem Roman also gutwillig eine Weile lang folgen, bis sich die Motive zu einem Gesamtbild runden.
Übersichtsseite zur Rougon-Macquart
Émile Zola: Die Rougon-Macquart. Natur- und Sozialgeschichte einer Familie unter dem zweiten Kaiserreich. Hg. v. Rita Schober. Berlin: Rütten & Loening, 1952–1976. Digitale Bibliothek Bd. 128. Berlin: Directmedia Publ. GmbH, 2005. 1 CD-ROM. Systemvoraussetzungen: PC ab 486; 64 MB RAM; Grafikkarte ab 640×480 Pixel, 256 Farben; CD-ROM-Laufwerk; MS Windows (98, ME, NT, 2000, XP oder Vista) oder MAC ab MacOS 10.3; 256 MB RAM; CD-ROM-Laufwerk. 10,– €.
Die Berliner Wochenzeitung »Der Freitag« bringt in ihrer aktuellen Ausgabe ein umfangreiches Portrait des französischen Literatur-Bloggers Pierre Assouline und seines Blogs La république des livres; Autor ist Frank Fischer vom Umblätterer. Die gedruckte Fassung des Artikels wird von einem Kasten begleitet, der Hinweise auf einige deutsche Literatur-Blogs enthält, darunter eben auch auf Bonaventura, worüber sich der Nachtwächter aufrichtig freut und wofür er herzlich dankt.
 Nicht ganz runder Roman auf der Grenze zwischen Science-Fiction und Alternativer Geschichte. Erzählt wird über eine nur lose miteinander verbundene Handvoll von Menschen, die 1962 im Westen der ehemaligen USA leben. Die Fiktion geht davon aus, dass der Zweite Weltkrieg 1948 vom Deutschen Reich und den Japanern gewonnen wurde. Die Japaner haben im Westen der USA eine Besatzungszone errichtet, die Nazis eine Vichy-ähnliche Regierung im Osten der USA etabliert. Dazwischen liegen als Pufferzone die sogenannten Rocky Mountain States. Hier und in der japanischen Besatzungszone, genauer in San Francisco spielt der Roman hauptsächlich.
Nicht ganz runder Roman auf der Grenze zwischen Science-Fiction und Alternativer Geschichte. Erzählt wird über eine nur lose miteinander verbundene Handvoll von Menschen, die 1962 im Westen der ehemaligen USA leben. Die Fiktion geht davon aus, dass der Zweite Weltkrieg 1948 vom Deutschen Reich und den Japanern gewonnen wurde. Die Japaner haben im Westen der USA eine Besatzungszone errichtet, die Nazis eine Vichy-ähnliche Regierung im Osten der USA etabliert. Dazwischen liegen als Pufferzone die sogenannten Rocky Mountain States. Hier und in der japanischen Besatzungszone, genauer in San Francisco spielt der Roman hauptsächlich.
Der Roman unterscheidet sich durch seine thematische Vielfalt und seinen Reichtum an Reflexionen wohltuend von üblichen Beispielen der Genre-Literatur. Man muss es Dick wohl zugutehalten, dass er sich für die gut 220 Seiten des Romans zu viel vorgenommen hat. Nicht nur versucht er, ein authentisches Bild einer Nachkriegswelt zu entwickeln, in der Japan und der Nazi-Staat die führenden und miteinander konkurrierenden politischen Kräfte sind, es wird auch die grundsätzliche Schwierigkeit der US-Amerikaner dargestellt, japanische Kultur und Umgangsformen zu begreifen, ein Diskurs über Historizität und Originalität als ästhetische Kriterien geführt, das I Ging ausführlich benutzt und zitiert, eine Poetik des Buches anhand eines Buches im Buch geliefert, wobei das Buch im Buch eine weitere alternative Fassung der Nachkriegsgeschichte liefert sowie eine Agenten-Geschichte mit Sex and Crime erzählt. Und das sind nicht einmal alle Handlungsfäden, die das Buch verfolgt.
Es ist verständlich, dass Dick nur einen der Handlungsstränge einigermaßen einem Ende zuführen kann und auch das nur auf einer eher allegorischen Ebene, indem er den Autor des Buches im Buch, bei dem es sich um den Titel gebenden Man in the High Castle handelt, auftreten und den ganzen Roman als Fiktion entlarven lässt. Dieser Abschluss ist nicht wirklich überzeugend, ist aber natürlich dem Widerspruch zwischen literarischem Anspruch und begrenzter Seitenzahl geschuldet. Von daher ist der Roman zwar etwas kurzatmig geraten, insgesamt aber durchaus lesenswert.
Philip K. Dick: The Man in the High Castle. In: Four Novels of the 1960s. New York: Library of America, 2007. Leinen, fadengeheftet, Lesebändchen. 225 von insgesamt 831 Seiten. Ca. 30,– €.
Ich liebe Jünglinge, die so wie du, mein Balthasar, Sehnsucht und Liebe im reinen Herzen tragen, in deren Innerm noch jene herrlichen Akkorde widerhallen, die dem fernen Lande voll göttlicher Wunder angehören, das meine Heimat ist. Die glücklichen, mit dieser inneren Musik begabten Menschen sind die einzigen, die man Dichter nennen kann, wiewohl viele auch so gescholten werden, die den ersten besten Brummbaß zur Hand nehmen, darauf herumstreichen und das verworrene Gerassel der unter ihrer Faust stöhnenden Saiten für herrliche Musik halten, die aus ihrem eignen Innern heraustönt.
E.T.A. Hoffmann
Klein Zaches genannt Zinnober
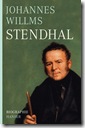 Wie schon bei seiner Balzac-Biografie liefert Johannes Willms auch für Stendhal in der Hauptsache die biografischen Daten und nur wenig zum Werk. Das ist in diesem Fall um so bedauerlicher, weil ein Großteil des Lebens von Stendhal ein sich wiederholendes Muster aufweist, das mit geringer Variationsbreite immer erneut abgearbeitet wird: Stendhal verliebt sich unglücklich, belagert das »obskure Objekt der Begierde« eine längere Weile, kommt mehr oder weniger zum Erfolg und wechselt dann das Objekt, kaum aber sein Empfinden oder seine Methoden. Natürlich kann man seinem Biografen nicht vorwerfen, dass dies auch weite Teile der Lebensbeschreibung ziemlich eintönig macht.
Wie schon bei seiner Balzac-Biografie liefert Johannes Willms auch für Stendhal in der Hauptsache die biografischen Daten und nur wenig zum Werk. Das ist in diesem Fall um so bedauerlicher, weil ein Großteil des Lebens von Stendhal ein sich wiederholendes Muster aufweist, das mit geringer Variationsbreite immer erneut abgearbeitet wird: Stendhal verliebt sich unglücklich, belagert das »obskure Objekt der Begierde« eine längere Weile, kommt mehr oder weniger zum Erfolg und wechselt dann das Objekt, kaum aber sein Empfinden oder seine Methoden. Natürlich kann man seinem Biografen nicht vorwerfen, dass dies auch weite Teile der Lebensbeschreibung ziemlich eintönig macht.
Erst relativ spät tauchen in Stendhals Leben einige andere interessante Leute auf, und wir erfahren etwas über die literarische Kultur und die Salons in Paris im frühen 19. Jahrhundert. Aber schon muss Stendhal wieder fort nach Italien, um im provinziellen Civitavecchia den Posten eines Konsuls zu bekleiden. Nach der Lektüre des Buches musste wenigstens ich feststellen, dass die Romane Stendhals unvergleichlich viel interessanter sind als sein Leben. Von daher ist es ein wenig Schade, dass sich Johannes Willms nur vergleichsweise knapp mit der literarischen Produktion Stendhals auseinandersetzt, zum Ausgleich aber sehr ausführlich mit dessen narzisstischer Veranlagung.
Johannes Willms: Stendhal. München: Hanser, 2010. Pappband, 333 Seiten. 24,90 €.
Der  dritte Band der Karl-Kraus-Werkausgabe, der den Fokus auf Literaturkritik legt. Neben einigen positiven Essays etwa zu Peter Altenberg oder Frank Wedekind stehen in der Hauptsache negative Kritiken des zeitgenössischen Literaturbetriebs und der Literaturgeschichte gegenüber. Nicht in allen Fällen scheint dem heutigen Leser der von Kraus betriebene kritische Aufwand der Bedeutung der Anlässe dieser Kritik angemessen; anders gesagt: Kraus scheint des öfteren mit Kanonen auf Spatzen zu schießen.
dritte Band der Karl-Kraus-Werkausgabe, der den Fokus auf Literaturkritik legt. Neben einigen positiven Essays etwa zu Peter Altenberg oder Frank Wedekind stehen in der Hauptsache negative Kritiken des zeitgenössischen Literaturbetriebs und der Literaturgeschichte gegenüber. Nicht in allen Fällen scheint dem heutigen Leser der von Kraus betriebene kritische Aufwand der Bedeutung der Anlässe dieser Kritik angemessen; anders gesagt: Kraus scheint des öfteren mit Kanonen auf Spatzen zu schießen.
Immer noch vergnüglich zu lesen sind die »Übersetzungen aus Harden« oder Kraus’ Dokumentation der zeitgenössischen Vorurteile der Literarhistoriker,
die in keinem Zusammenhang mit der Literatur stehen und darum nur Literarhistoriker heißen.
Auch der Essay zu Arthur Schnitzler enthält immer noch gültige und nötige Anmerkungen zur Einordnung dieses überschätzten Autors:
Es ist das Los der Süßwasserdichter, daß sie die Begrenzung spüren, sich unbehaglich fühlen und dennoch drin bleiben müssen.
Insgesamt hat aber auch die Lektüre dieses Bandes den Eindruck verdichtet, dass man Kraus mit größeren Pausen lesen sollte, damit er einem nicht mit seiner stets gleichbleibenden Intensität auf die Nerven geht.
Karl Kraus: Literatur und Lüge. st 1313. Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1987. 381 Seiten. 10,– €.
Je älter ich werde, desto schwerer fällt mir die Bewertung von Nachlass-Editionen. Das mag vielleicht daran liegen, dass mit den Jahren das Empfinden für die Vorläufigkeit von Entwürfen zunimmt, vielleicht auch das Wissen, dass einiges, und nicht immer unbedingt das Unwesentliche, spät und zufällig seinen Platz finden kann, und nicht zuletzt auch das Bewusstsein, dass für ein gelungenes Werk manchmal viel ausprobiert werden muss.
Die nun bei Suhrkamp vorgelegten Entwürfe Max Frischs zu einem dritten Tagebuch wurden von ihm in den Jahren 1982 und 1983 erstellt. Erhalten geblieben ist nicht Frischs Arbeitsexemplar, sondern ein Durchschlag seiner Sekretärin. Frisch hat den Versuch wohl abgebrochen, als sein zweiter Versuch einer Beziehung zu Alice Locke-Carey (dem Vorbild für Lynn aus »Montauk«) im April 1983 endete; ihr sollte das »Dritte Tagebuch« ursprünglich auch gewidmet sein.
Das »Dritte Tagebuch« setzt die Form der ersten beiden fort: Um eine bestimmt Anzahl von Themen entwickelt Frisch in essayistischen Bruchstücken und kurzen Erzählungen ein Mosaik von Meinungen, Zugriffen und Positionen. Als Hauptthemen kristallisieren sich heraus:
Besonders die politische Ebene ist geprägt von einer überraschenden Naivität; ich müsste nun das »Tagebuch 1966–1971« noch einmal anschauen, um zu sehen, ob diese Einschätzung einer Entwicklung von Frischs oder meiner Perspektive geschuldet ist.
Es stellt sich beim Lesen – wie zu Erwarten ist – kein gerundetes Bild ein, auch nicht die Vorstellung, ein gerundetes Werk habe dem Autor vorgeschwebt, als er das vorhandene Material schrieb. Im Gegenteil sind seine Reflexionen über das Anstreichen von Säulchen und Fensterläden eindrücklicher als seine Gedanken zu den USA und ihrer Politik. Das Buch ist also nur jenen alten Frisch-Lesern ans Herz zu legen, die aus Verbundenheit auch diesen letzten Schritt mit dem Autor noch gehen wollen.
Allen anderen sei vor dem Kauf ein Blick auf die Seiten 138 und 139 empfohlen:
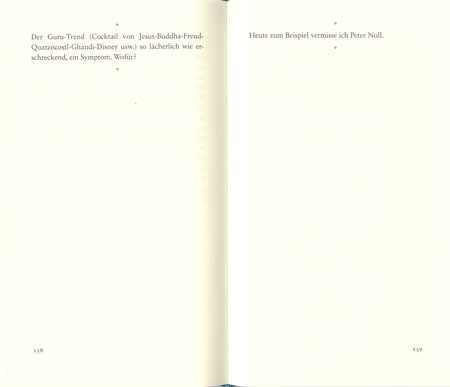
Wollen Sie für eine solche Seitenschinderei tatsächlich Geld ausgeben?
Max Frisch: Entwürfe zu einem dritten Tagebuch. Berlin: Suhrkamp, 2010. Pappband, 215 Seiten. 17,80 €.
 Roman um einen jungen, jüdischen Tausendsassa, der in den Nachkriegsjahren in Montreal eine fieberhafte geschäftliche Tätigkeit entwickelt, um in den Besitz eines Sees zu gelangen, an dem er Hotels und ein Ferienlager errichten möchte. Er gründet zu diesem Zweck eine Filmproduktion, die Hochzeiten und Bar-Mizwa-Feiern dokumentiert. Da Duddy jedoch einen in Hollywood durchgefallenen, avantgardistischen Regisseur anheuert, muss er all seine Überredungskünste aufbringen, um seinen ersten Film als Kunstwerk verkaufen zu können. Nebenbei holt er seinen weggelaufenen Bruder Lennie wieder zurück und rettet dessen Medizinstudium, fährt, wenn das Geld mal wieder knapp wird, zusätzliche Schichten im Taxi seines Vaters, vereinigt seinen totktranken Onkel wieder mit dessen Frau, vermittelt hier und da einige kleinere Geschäfte, wird unfreiwillig als Drogenkurier eingesetzt und erleidet, wie nicht anders zu erwarten, einen ordentlichen Nervenzusammenbruch. Und natürlich kommt auch die Liebe vor:
Roman um einen jungen, jüdischen Tausendsassa, der in den Nachkriegsjahren in Montreal eine fieberhafte geschäftliche Tätigkeit entwickelt, um in den Besitz eines Sees zu gelangen, an dem er Hotels und ein Ferienlager errichten möchte. Er gründet zu diesem Zweck eine Filmproduktion, die Hochzeiten und Bar-Mizwa-Feiern dokumentiert. Da Duddy jedoch einen in Hollywood durchgefallenen, avantgardistischen Regisseur anheuert, muss er all seine Überredungskünste aufbringen, um seinen ersten Film als Kunstwerk verkaufen zu können. Nebenbei holt er seinen weggelaufenen Bruder Lennie wieder zurück und rettet dessen Medizinstudium, fährt, wenn das Geld mal wieder knapp wird, zusätzliche Schichten im Taxi seines Vaters, vereinigt seinen totktranken Onkel wieder mit dessen Frau, vermittelt hier und da einige kleinere Geschäfte, wird unfreiwillig als Drogenkurier eingesetzt und erleidet, wie nicht anders zu erwarten, einen ordentlichen Nervenzusammenbruch. Und natürlich kommt auch die Liebe vor:
»Ich kapier’s nicht«, sagte Duddy nachher. »Stell dir mal vor, Kerle heiraten und hängen sich für ihr ganzes Leben an ein einziges Weib, dabei laufen so viele herum.«
»Menschen verlieben sich«, sagte Yvette. »Das kommt vor.«
»Es stürzen auch Flugzeuge ab«, sagte Duddy.
Erzählt wird all dies in einem hohen Tempo und mit einem ausgeprägten Sinn für Humor. Sowohl die Milieuschilderungen als auch die Charaktere sind durchweg überzeugend. Nur das Ende des Romans fällt ein klein wenig ab; hier scheint Richler der entscheidende Einfall gefehlt zu haben.
Erstaunlich ist, dass dieser Roman bereits 1959 erscheinen ist – er war Richlers Durchbruch –, seine Verfilmung 1975 sogar für einen Oscar nominiert war, er aber erst 2007 auf Deutsch erschienen ist. Das scheint dafür, dass Richler als einer der bedeutendsten Autor Kanadas gilt, eine ungewöhnlich lange Zeitspanne zu sein. Wollen wir hoffen, dass Richler auch spät noch die Leser findet, die er verdient.
Mordecai Richler: Die Lehrjahre des Duddy Kravitz. Aus dem Englischen von Silvia Morawetz. Fischer 18074. Frankfurt/M.: Fischer Taschenbuch Verlag, 2009. 432 Seiten. 9,95 €.
Lesen ist eine so wunderbare Tätigkeit, diese wenigen Buchstaben unseres lateinischen Alphabets, die in unseren Köpfen so viele verschiedene lebhafte Bilder erzeugen. Für mich ist das ein magischer Vorgang.
Friedrich Forssman
(via ASml-News)