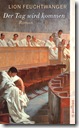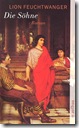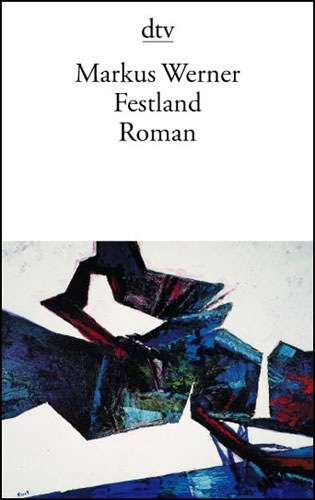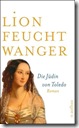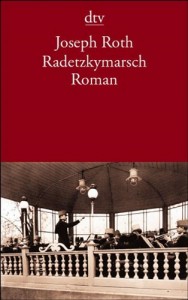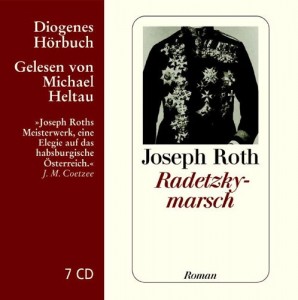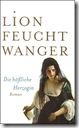 Auf eine Empfehlung hin als vorläufig letzten der historischen Romane Feuchtwangers gelesen. Auch sonst kommt nun erst einmal wieder ein anderer Autor dran und das nicht nur, damit dies hier nicht zu einem Feuchtwanger-Blog ausartet. Zudem fällt mir die Rezension dieses Mal ausgesprochen schwer, denn es ist kein richtig schlechtes Buch, so richtig gelungen ist es aber auch nicht.
Auf eine Empfehlung hin als vorläufig letzten der historischen Romane Feuchtwangers gelesen. Auch sonst kommt nun erst einmal wieder ein anderer Autor dran und das nicht nur, damit dies hier nicht zu einem Feuchtwanger-Blog ausartet. Zudem fällt mir die Rezension dieses Mal ausgesprochen schwer, denn es ist kein richtig schlechtes Buch, so richtig gelungen ist es aber auch nicht.
Es beginnt damit, dass das Buch mehr eine historische Phantasie als einen historischen Roman liefert. Zwar werden die historischen Rahmenbedingungen im Großen weitgehend korrekt dargestellt, aber damit ist die Grenze auch schon erreicht. Es muss als Legende gelten, dass Margarete, Herzogin von Kärnten, ausnehmend hässlich gewesen sei, jedenfalls wissen die zeitgenössischen Quellen darüber nichts. Der Beiname Maultasch scheint überhaupt nicht auf die Körperbildung der Herzogin zurückzugehen, vielmehr scheint es sich dabei um gegnerische Propaganda gehandelt zu haben. Damit fällt zumindest schon einmal jeglicher Zusammenhang zwischen der von Feuchtwanger angesetzten Hässlichkeit der Herzogin und den tatsächlich geschehenen geschichtlichen Abläufen weg. Auch der den Großteil des Buches durchziehende Kampf der hässlichen Margarete gegen die schöne Agnes gerät so zur reinen Phantasie und muss ganz für sich selbst, ohne die Weihe der historischen Wahrhaftigkeit bestehen.
Hier aber kommt die bereits bei der Josephus-Trilogie angemerkte Schwäche in der Figurenentwicklung zum Tragen. Feuchtwangers Figuren mögen sich für die Bühne eignen, für einen Roman sind sie deutlich zu eindimensional und statisch. Alles an Maragrete und was sie tut, erklärt sich letztlich aus ihrer Hässlichkeit, der Frauenberger ist ein skrupelloser Intrigant und sonst eben gar nichts, der Schenna treu, Prinz Friedrich ein verantwortungsloser Hallodri usw. usf. Jede Figur bleibt in ihrem Muster, erfüllt brav die ihr zugedachte Funktion, aber keine einzige Figur hat wirklich Leben, changiert, wird ihrer Eintönigkeit selbst einmal müde oder gerät gar zu sich selbst in einen Widerspruch. Alle Figuren sind ordentlich, funktional und langweilig.
Zudem ist das Buch an einigen Stellen flüchtig und lieblos gearbeitet. So wird etwa das Giftfläschchen, das Margarete dem Frauenberger auf S. 181 in die Hand drückt, auf S. 179 eingeführt, und der darin befindliche »Saft« verwandelt sich auf S. 234 mir nichts dir nichts in ein »Pulver«. Da wird dem Sohn der Maragrete, Meinhard, wohl wegen des charakterisierenden Namens ein Siebenschläfer als Schmusetier beigesellt, von dem nicht nur wiederholt behauptet wird, es handele sich dabei um ein Murmeltier – das nun wieder einer ganz anderen Tierfamilie angehört –, sondern das auch sonst als Haustier denkbar ungeeignet ist:
Der Siebenschläfer wird verhältnismäßig selten in der Gefangenschaft gehalten. Es läßt sich von vornherein erwarten, daß ein so großer Fresser geistig nicht sehr befähigt sein, überhaupt nicht viele gute Eigenschaften haben kann. Sein Wesen ist nicht gerade angenehm, seine größte Tugend die Reinlichkeit; im übrigen wird er langweilig. Er befindet sich fortwährend in gereizter Stimmung, befreundet sich durchaus nicht mit seinem Pfleger und knurrt in eigenthümlich schnarchender Weise jeden wüthend an, welcher sich erfrecht, ihm nahe zu kommen. Dem, welcher ihn ungeschickt angreift, beweist er durch rasch aufeinanderfolgende Bisse in sehr empfindlicher Weise, daß er keineswegs geneigt sei, sich irgendwie behelligen zu lassen. Nachts springt er wie rasend im Käfige umher und wird schon deshalb seinem Besitzer bald sehr lästig. Er muß auf das sorgfältigste gepflegt, namentlich gefüttert werden, damit er sich nicht durch den Käfig nagt oder einen und den andern seiner Gefährten auffrißt; denn wenn er nicht genug Nahrung hat, geht er ohne weiteres andere seiner Art an und ermordet und verzehrt sie ebenso ruhig wie andere kleine Thiere. Auch die im Käfige geborenen Jungen sind und bleiben ebenso unliebenswürdig wie die Alten.
Brehms Tierleben (1882 ff.)
Solche Patzer sind ärgerlich und mit ein wenig Sorgfalt und Recherche vermeidbar.
Wer sich nur für die geschichtlichen Abläufe des 14. Jahrhunderts im Großen interessiert, findet ein ganz nettes Lesebuch; mehr sollte man aber nicht erwarten.
Lion Feuchtwanger: Die häßliche Herzogin. Aufbau Taschenbuch 5627. Berlin: Aufbau, 72008. 270 Seiten. 8,95 €.