Die Wahrheit ist selten rein und niemals schlicht. Unser zeitgenössisches Leben wäre sehr uninteressant, wenn sie auch nur eins von beiden wäre, und zeitgenössische Literatur ein Ding der völligen Unmöglichkeit.
Der hier besprochene Band entstammt der etwas merkwürdigen, fünfbändigen Werkauswahl Oscar Wildes, die 1999 im Vorfeld des 100. Todestages bei Haffmans in Zürich erschienen ist. Die Ausgabe ist auf der einen Seite fraglos sehr hübsch gestaltet, durchweg neu übersetzt, auf Dünndruckpapier gedruckt und fadengeheftet, in ein schillerndes, silbergraues Leinen gebunden und mit ungewöhnlichen, wachspapiernen Schutzumschlägen versehen. Auf der anderen Seite kommt sie mit dem – möglicherweise selbstironischen – Anspruch daher, sie verstehe sich „als die definitive deutsche OSCAR WILDE WERKAUSGABE für das nächste Jahrtausend.“
Selbst wenn man davon absieht, dass der Verlag gleich im ersten Jahr dieses nächsten Jahrtausends Konkurs angemeldet hat, ist auch die Auswahl aus den Werken von der Art, dass von definitiver Werkausgabe kaum die Rede sein kann: Keines der Gedichte Wildes wurde übersetzt, bei den Theaterstücken liefert man nur die vier Komödien, “De Profundis” fehlt ebenso wie alle frühen essayistischen Schriften; die Frage, ob “The Portrait of Mr. W.H.” überhaupt unter die Essays gehört, ließe sich immerhin diskutieren.
Wie dem auch sei, Haffmans legte in Band 5 der Werkauswahl die vier Gesellschaftskomödien, die in England Wildes populären Ruhm begründeten, in einer frischen Übersetzung durch Bernd Eilert vor. Eilerts Texte sind auf der Höhe des Wildeschen Humors, was für die Komödien das wichtigste Kriterium der Übersetzung zu sein scheint; da ich seit langem nicht mehr ins Theater gehe, habe ich leider keine Ahnung, inwieweit sich Eilerts Übersetzung auf den deutschen Bühnen durchgesetzt hat, bzw. ob man Wilde dort überhaupt noch in bedeutendem Umfang spielt.
Die Komödien sind im Einzelnen:
— Lady Windermeres Fächer ist eine moralische Gesellschaftskomödie, deren titelgebende Protagonistin ihren Mann einer Affäre verdächtigt. Der Knoten des Stücks wird geschürzt, indem Lord Windermere seine misstrauische Gattin dazu nötigt, seine mutmaßliche Geliebte Mrs. Erlynne zu einer Abendgesellschaft einzuladen, um sie gesellschaftsfähig zu machen und ihr die Heirat mit dem in sie vernarrten Lord Augustus Lorton zu ermöglichen. Windermeres Absicht ist es im Wesentlichen, Mrs. Erlynne loszuwerden, die ihn damit erpresst, dass sie öffentlich bekannt machen könnte, die Mutter von Lady Windermere zu sein und so deren Ruf gesellschaftlich zu ruinieren.
Die Komödie arbeitet in der Hauptsache mit den üblichen Tricks der Halb- und Uninformiertheit ihrer Figuren, die in einem vom Publikum vollständig durchschauten Labyrinth der Missverständnisse herumtaumeln. Die hohe Moralität Lady Windermeres wird von der mütterlichen Aufopferung der vermeintlich bösen Mrs. Erlynne übertrumpft, mit der dann aber auch nicht so endgültig ernst gemacht wird, damit das Stück nicht nur alles in allem, sondern auch im Detail gut ausgeht. Eine wirkliche Auflösung fehlt: Wilde hält das System von Lügen, auf dem die Moralität der vorgeführten Gesellschaft beruht, aufrecht. Er spielt nur für einen kurzen Moment im 4. Akt mit dem Umschlagen der Handlung in eine Tragödie, die im Stück durchaus angelegt ist, um das Publikum wenigstens an einer Stelle aus dem Dusel der Überlegenheit aufzustören, glättet aber alles gleich wieder, wie es sich für eine Komödie gehört.
— Eine Frau ohne Bedeutung ist Wildes ernsteste und schwergängigste Komödie. Im Zentrum steht eine Variation der Mrs. Erlynne, Mrs. Arbuthnot, die aufgrund eines unehelichen Kindes, Gerald, aus der Gunst der Guten Gesellschaft herausgefallen ist. Gerald wird nun durch einen Zufall unwissentlich von seinem Vater Lord Illingworth als Sekretär angestellt, was dem jungen Mann nicht nur den Weg in die Bessere Gesellschaft öffnet, sondern ihm auch ermöglichen würde, der von ihm heimlich geliebten Miss Hester Worsley, einer jungen US-Amerikanerin, einen Heiratsantrag zu machen.
Die eigentliche Handlung spielt hauptsächlich auf dem Landsitz von Lord und Lady Pontrefact, auf dem sich alle relevanten und einige zusätzliche Figuren aufhalten. Mrs. Arbuthnot wohnt in der Nachbarschaft und wird, als Mutter des anwesenden Sekretärs Gerald, ebenfalls zu Besuch geladen. Es kommt natürlich zur entlarvenden Gegenüberstellung von Mrs. Arbuthnot und Lord Illingworth. Illingworth, ein in die Jahre gekommener, zynischer Dandy, reagiert ganz pragmatisch auf die vorgefundene Situation: Er ist bereit, die Mutter seines Sohnes zu heiraten, diesem ein Gutteil seines Nachlasses zu vermachen und ihm so wenigstens halbwegs die Anerkennung der Guten Gesellschaft zu verschaffen. Mrs. Arbuthnot lehnt diesen Vorschlag rundweg ab: Sie hat vor zusammen mit ihrem Sohn und ihrer künftigen Schwiegertochter nach Amerika zu gehen und dort ein von den Zwängen der englischen Gesellschaft befreites, neues Leben zu beginnen.
Über diese Entgegensetzung kommt die Komödie letztendlich nicht hinaus, im Komödiensinne findet keine Auflösung des zugrunde liegenden Konfliktes statt. Sicherlich geht es in einem ungewissen Sinne gut aus, und die Protagonistin bewahrt ihre moralische Integrität, aber dies nur um den Preis der endgültigen Ablösung von der Bühnengesellschaft. Das Stück geht überhaupt nur deshalb als Komödie durch, weil es einerseits mit einer breiten Parodie des gesellschaftlichen Lebens des englischen Adels beginnt und es andererseits das „Amerika, du hast es besser“ als utopischen Ausblick verkaufen kann. Wilde war mit der Moral seiner Komödie sicherlich zufrieden; mit der Komödie selbst hätte er es besser nicht sein sollen.
— Ein idealer Ehemann zeigt einen erheblichen Fortschritt Wildes als Komödienautor. Diesmal kehrt die Protagonistin seiner ersten Komödie als Lady Chiltern zurück. Auch sie ist von hoher, offiziöser Moral, hält die höchsten Stücke auf ihren politisch aktiven Ehemann, dem eine bedeutende politische Karriere bevorzustehen scheint. Auch diesmal taucht eine zwielichtige Frau im Leben von Sir Chiltern auf, die mit ihm durch seinen früheren Mentor verbunden ist. Diese Mrs. Cheveley besitzt einen Brief, der beweist, dass Chiltern seine politische Karriere und sein Vermögen auf den Verrat eines Staatsgeheimnis gegründet hat; sie will Chiltern dazu nötigen, sich in seiner Funktion als Unterstaatssekretär des Außenministeriums für eine Börsenspekulation stark zu machen, in die Mrs. Cheveley ihr Vermögen investiert hat. Chiltern steht aber unmittelbar davor, gerade diese Spekulation als Betrug zu entlarven. Er ist sich einerseits bewusst, dass das Bekanntwerden seines Verrats nicht nur seine politische Karriere, sondern auch die Ehe mit seiner hoch moralischen Frau beenden wird. Andererseits würde auch der von Mrs. Cheveley geforderte Meinungswechsel ihn in einen fatalen Konflikt mit seiner Ehefrau stürzen. Der geschürzte Knoten scheint unauflöslich und notwendig in eine Katastrophe zu führen.
Die Auflösung hängt Wilde an eine der gelungensten Nebenfiguren der Literatur des gesamten 19. Jahrhundert: Viscount Goring verkehrt im Hause der Chilterns nicht nur als enger Freund des Ehemannes, sondern er ist ebenso ein heimlicher Bewunderer Lady Chilterns und der Ehemann in spe von Roberts Schwester Mabel. Lord Goring ist der ideale Dandy, geistreich und zugleich oberflächlich, intellektuell und albern, in einem tiefen Sinne moralisch und zugleich jede Forderung der gesellschaftlichen Moral verwerfend. Er und die leichtlebige, witzige Mabel bilden das ideale Komödienpaar des Stücks. Goring ist aber nicht nur dies, sondern er ist auch ein früherer Liebhaber Mrs. Cheveleys und anscheinend deren einziger Schwachpunkt. Und Goring wiederum hat ein Mittel zur Erpressung der Erpresserin in der Hand, womit er die Herausgabe des belastenden Briefes erzwingt, den er sogleich verbrennt. Chiltern bewährt sich, ohne zu wissen, dass er bereits gerettet ist, aufs Beste und entlarvt, wie geplant, den Börsenbetrug, und nach ein paar weiteren Wendung und Drehung endet alles so gut, wie man es von einer Komödie erwarten darf; sogar eine Hochzeit zeichnet sich ab: Mabel und Lord Goring gehen fröhlich in das Glücksversprechen des 19. Jahrhunderts ein.
Man kann kaum umhin, Wilde für diese Komödie hohe Anerkennung zu zollen: Sowohl ist der zugrunde gelegte Konflikt ist in seiner scheinbaren Ausweglosigkeit mutig als auch ist die Art der Auflösung dieses und der zusätzlich mit Bedacht eingeführten kleineren Verwerfungen von einer Eleganz, die ihresgleichen sucht. Das ganze Stück läuft wie eine wohl geölte Maschine ab, obwohl der analytische Zuschauer nach dem 1. Akt fürchten muss, dass es dem Autor katastrophal missraten wird. Zudem zieht sich durch das ganze Stück nicht nur ein sprachlicher Witz, sondern zudem ein tief menschlicher Humor, der am Ende alle Figuren ein wenig demütig und wehmütig zurücklässt. Dieses Stück präsentiert ein ganz seltenes Zusammengehen von dramaturgischer Finesse und inhaltlicher Souveränität.
— Ernst – und seine tiefere Bedeutung ist Wildes leichteste und wahrscheinlich auch von daher beliebteste Komödie. Bereits der Untertitel „Eine triviale Komödie für ernsthafte Leute“ weist darauf hin, dass Wilde sich hier von dem Versuch verabschiedet, Moral auf der Bühne mit einiger Ernsthaftigkeit zu diskutieren. Stattdessen liefert er einen Komödienplot, wie er auch heute noch jede gute Boulevardkomödie ziert: John Worthing, als Findelkind von einem gutherzigen Adeligen großgezogen, lebt ein Doppelleben: Einerseits ist er ein verdienstvolles Mitglied der ländlichen Gesellschaft um seinen Herrensitz herum, andererseits führt er unter der Identität seines leichtlebigen Bruders Ernst ein lockeres Junggesellendasein in London. Dort ist er nicht nur eng befreundet mit dem finanziell etwas angestrengten Adeligen Algernon Moncrieff, er ist auch verliebt in dessen Cousine Gwendolen Fairfax, der er gleich zu Anfang des Stücks einen Heiratsantrag macht, der von ihr freudig angenommen, von ihrer Mutter Lady Bracknell aber aufgrund der unklaren Herkunft Worthings irritiert abgewiesen wird.
Nach dem diesen Knoten etablierenden 1. Akt verlegt Wilde die restliche Handlung auf den Landsitz Worthings, auf dem Algernoon am nächsten Tag auftaucht und sich als Johns Bruder Ernst ausgibt, den John in der Stadt verfehlt habe. Algernon verliebt sich augenblicklich in Johns Mündel Cecily, die wiederum längst eine Phantasie-Verlobung mit dem von ihr erträumten Ernst Worthing eingegangen ist. Natürlich verkompliziert die Ankunft zuerst Johns und dann Gwendolens die Lage, die durch das Eintreffen von Lady Bracknell abschließend auf die Spitze getrieben wird. Ebenso natürlich geht alles so gut aus, wie man das bei einem solchen Plot erwarten darf: Es hagelt geradezu glückliche Eheschließungen, alle, die sich kriegen sollen, kriegen sich und noch mehr, John und Algernon sind tatsächlich Brüder, und selbst Gwendolens Obsession mit dem Vornamen Ernst – die dem ganzen Stück seinen zweideutigen Titel gibt – wird zu einem guten Ende geführt. Nicht umsonst lässt Übersetzer Eilert Wildes Lady Bracknell ganz am Ende feststellen: „das sieht mir hier doch alles stark nach Volkstheater aus.“ (Einer der frechen Eingriffe in den Text; bei Wilde lautet Lady Bracknells abschließende Bemerkung weit weniger deutlich: “My nephew, you seem to be displaying signs of triviality.”)
Der Trivialität der Handlung und ihrer gänzlich unbesorgten Durchführung steht ein hohes Niveau sprachlichen und inhaltlichen Witzes zur Seite, die das Stück aus der Massenware der Trivialkomödien heraushebt. Der durchweg ironische Umgang der Hauptfiguren mit sich selbst und untereinander, die unsinnig sinnigen Dialoge, das konsequente, oft gewollte Aneinander-Vorbeireden und die durchgehend als reines Spiel markierte Handlung bilden den Kern des Erfolgs dieses Stückes.
Es ist sehr, sehr bedauerlich, dass Wildes Karriere durch den Hass und die Intoleranz seiner Zeit und Zeitgenossen so gewaltsam beendet worden ist. Er hätte mit Sicherheit noch zahlreiche Meisterstücke für die Bühne geliefert, vielleicht am Ende sogar noch erreichen können, dass man ihn auch in seiner Wahlheimat England als tragischen Dramatiker anerkannt hätte. So müssen wir wie immer Vorlieb nehmen mit dem, was wir haben.
Oscar Wilde: Komödien. Aus dem Englischen von Bernd Eilert. Werke in 5 Bänden, Bd. 5. Zürich: Haffmans, 1999. Leinen, Fadenheftung, Lesebändchen, 632 Seiten. Derzeit noch lieferbar in einer einbändigen Ausgabe der Werkauswahl bei Zweitausendeins.
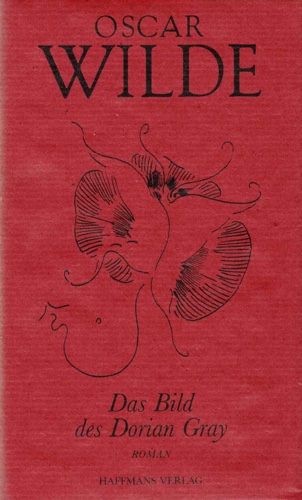
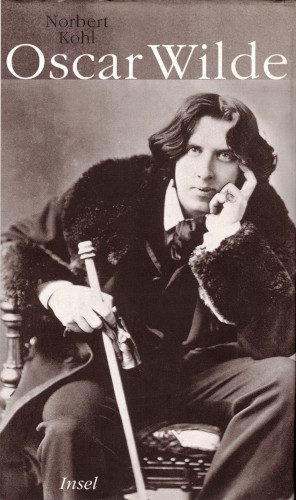
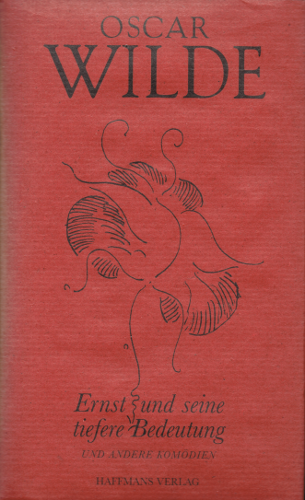
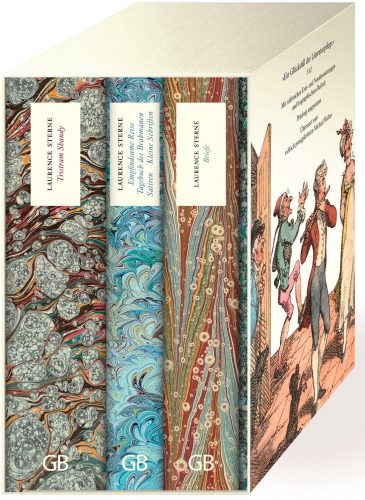

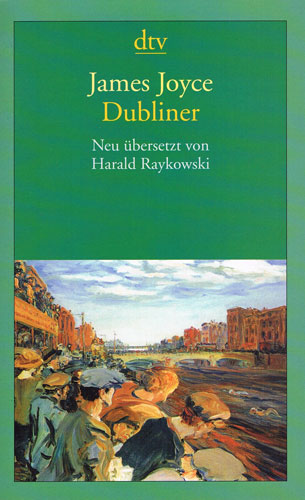




 Es folgt: 35.Tg2 (diesen feinen Zug findet Spethmann nicht selbst, sondern er wird ihm geschenkt) Txg2+ 36.Kxg2 Dc7 37.Df5+ Kh6 38.Df6+ Kh7 39.Kg3 Kg8 40.Kh4 Db6 41.Kh5 Kf8 42.Kh6 Ke8 43.Kh7 Dc5 44.Dg7 Ke7 45.Dg5+ Ke8 46.Kg8 Dc7 47.Dh6 De7 48.Dg7 a6 49.a3 a5 50.a4 (Diagramm unten). Angeblich erkennt Kopelzon erst an dieser Stelle, dass er nun in Zugzwang ist und den König vom Bauern entfernen müsse, was den Bauern und damit auch die Partie einstellt: »He had no choice but move the king away from the defence of the f-pawn.« Nun könnte man, wenn man denn schon seine Amateure von 1914 wie Profis des Jahres 2000 spielen lässt, auch den computergestützten Kommentar wagen, dass hier 50… Kd8 vielleicht nicht die zähste Verteidigung ist, sondern Schwarz mit 50… Dh4 noch auf einen späteren Fehler des Gegners
Es folgt: 35.Tg2 (diesen feinen Zug findet Spethmann nicht selbst, sondern er wird ihm geschenkt) Txg2+ 36.Kxg2 Dc7 37.Df5+ Kh6 38.Df6+ Kh7 39.Kg3 Kg8 40.Kh4 Db6 41.Kh5 Kf8 42.Kh6 Ke8 43.Kh7 Dc5 44.Dg7 Ke7 45.Dg5+ Ke8 46.Kg8 Dc7 47.Dh6 De7 48.Dg7 a6 49.a3 a5 50.a4 (Diagramm unten). Angeblich erkennt Kopelzon erst an dieser Stelle, dass er nun in Zugzwang ist und den König vom Bauern entfernen müsse, was den Bauern und damit auch die Partie einstellt: »He had no choice but move the king away from the defence of the f-pawn.« Nun könnte man, wenn man denn schon seine Amateure von 1914 wie Profis des Jahres 2000 spielen lässt, auch den computergestützten Kommentar wagen, dass hier 50… Kd8 vielleicht nicht die zähste Verteidigung ist, sondern Schwarz mit 50… Dh4 noch auf einen späteren Fehler des Gegners  spekulieren könnte. Der Rückzug des Königs kommt einer Resignation gleich, die vielleicht für Sokolov in einer Partie gegen King passt, für Kopelzon, der sich einem Patzer wie Spethmann gegenübersieht, aber ganz sicher nicht. Es folgt noch: 50… Kd8 51.Df8+ De8 52. Kg7 1-0. Wichtig ist natürlich auch hier, dass die Partie am Ende durch einen Zugzwang entschieden wird und sich auf diese Weise wenigstens oberflächlich dem vorgeblichen Generalbass einfügt.
spekulieren könnte. Der Rückzug des Königs kommt einer Resignation gleich, die vielleicht für Sokolov in einer Partie gegen King passt, für Kopelzon, der sich einem Patzer wie Spethmann gegenübersieht, aber ganz sicher nicht. Es folgt noch: 50… Kd8 51.Df8+ De8 52. Kg7 1-0. Wichtig ist natürlich auch hier, dass die Partie am Ende durch einen Zugzwang entschieden wird und sich auf diese Weise wenigstens oberflächlich dem vorgeblichen Generalbass einfügt. Partien schon deutlich fortgeschritten (»well under way«). Er entdeckt Rozental, der in der vierten Runde mit Schwarz gegen Lasker spielt, versteckt hinter einer Palme sitzend, während Lasker über seinen 60. Zug nachdenkt. Er zieht schließlich seinen Bauern nach b3, wodurch eine aus der Partie Rubinstein vs. Lasker bekannte Stellung entsteht, die auch im Buch abgebildet ist (Diagramm):
Partien schon deutlich fortgeschritten (»well under way«). Er entdeckt Rozental, der in der vierten Runde mit Schwarz gegen Lasker spielt, versteckt hinter einer Palme sitzend, während Lasker über seinen 60. Zug nachdenkt. Er zieht schließlich seinen Bauern nach b3, wodurch eine aus der Partie Rubinstein vs. Lasker bekannte Stellung entsteht, die auch im Buch abgebildet ist (Diagramm): Selbst der nicht besonders im Schachspiel bewanderte Leser könnte sich hier wenigstens einen Augenblick lang darüber wundern, warum Lasker schon wieder am Zug und Rozental hinter der Palme ist und von welchem Springer oder welcher Dame hier wohl die Rede ist, da in der abgebildeten Position offensichtlich keine der beiden Figuren vorhanden ist. Und er wunderte sich zu Recht: Denn diese Beschreibung bezieht sich offensichtlich auf eine ganz andere Stellung derselben Partie: Mit seinem 11. Zug hatte Rubinstein Laskers Springer auf d2 geschlagen (Diagramm) und der zitierte Absatz beschreibt nun die nächsten beiden Züge: 12.Dxd2 f6. Es scheint so zu sein, dass Bennett in einer älteren Fassung des Buchs ein viel früheres Stadium der Partie Lasker vs. Rubinstein verarbeiten wollte, sich aber angesichts des Einfalles, das Buch »Zugzwang« zu nennen, dann für die Stellung nach 60.b3 entschieden hat. Nur hat er leider vergessen, den zitierten Absatz aus dem Manuskript zu löschen oder umzuschreiben.
Selbst der nicht besonders im Schachspiel bewanderte Leser könnte sich hier wenigstens einen Augenblick lang darüber wundern, warum Lasker schon wieder am Zug und Rozental hinter der Palme ist und von welchem Springer oder welcher Dame hier wohl die Rede ist, da in der abgebildeten Position offensichtlich keine der beiden Figuren vorhanden ist. Und er wunderte sich zu Recht: Denn diese Beschreibung bezieht sich offensichtlich auf eine ganz andere Stellung derselben Partie: Mit seinem 11. Zug hatte Rubinstein Laskers Springer auf d2 geschlagen (Diagramm) und der zitierte Absatz beschreibt nun die nächsten beiden Züge: 12.Dxd2 f6. Es scheint so zu sein, dass Bennett in einer älteren Fassung des Buchs ein viel früheres Stadium der Partie Lasker vs. Rubinstein verarbeiten wollte, sich aber angesichts des Einfalles, das Buch »Zugzwang« zu nennen, dann für die Stellung nach 60.b3 entschieden hat. Nur hat er leider vergessen, den zitierten Absatz aus dem Manuskript zu löschen oder umzuschreiben.