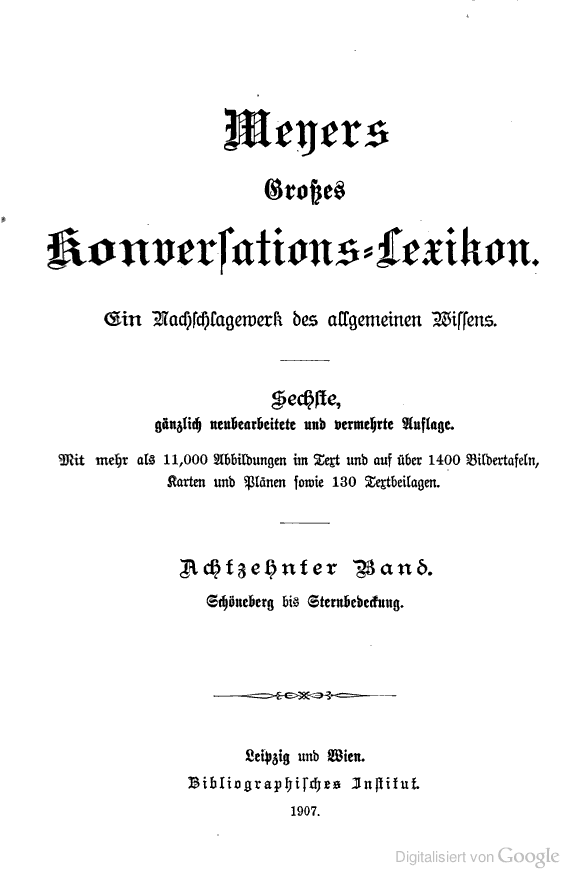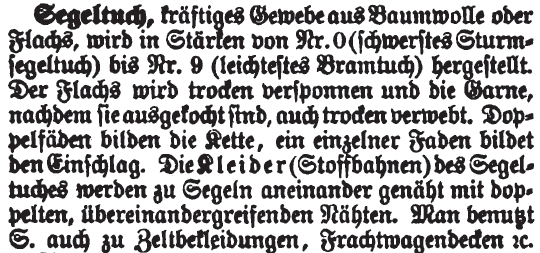Das Dichterische wirkt meist wie der Hintern der „Wirklichkeit“.
Carl Einstein
 Carl Einstein (nicht verwandt oder verschwägert) ist einer von einer ganzen Anzahl deutscher Schriftsteller der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die nach der Kulturkatastrophe des Nationalsozialismus nur noch am Rande wahrgenommen wurden und heute an der Grenze zum Vergessenwerden stehen. Sein einziger sogenannter Roman „Bebuquin“ (1912) – der Text umfasst nur etwa 13.000 Wörter und trägt die Gattungsbezeichnung ausschließlich, um klarzustellen, welche literarische Form hier konterkariert werden soll – war bis vor einiger Zeit noch bei Reclam lieferbar, wurde dort aber mittlerweile durch eine der kunsthistorischen Schriften Einsteins ersetzt.
Carl Einstein (nicht verwandt oder verschwägert) ist einer von einer ganzen Anzahl deutscher Schriftsteller der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, die nach der Kulturkatastrophe des Nationalsozialismus nur noch am Rande wahrgenommen wurden und heute an der Grenze zum Vergessenwerden stehen. Sein einziger sogenannter Roman „Bebuquin“ (1912) – der Text umfasst nur etwa 13.000 Wörter und trägt die Gattungsbezeichnung ausschließlich, um klarzustellen, welche literarische Form hier konterkariert werden soll – war bis vor einiger Zeit noch bei Reclam lieferbar, wurde dort aber mittlerweile durch eine der kunsthistorischen Schriften Einsteins ersetzt.
Jetzt hat der junge homunculus verlag Einsteins „Die schlimme Botschaft“ (1921) wieder aufgelegt. Der Titel ist eine bewusste Umkehrung des Evangeliums und das schmale Büchlein enthält 20 Szenen, in denen Jesus von Nazareth sich mit seinen Jüngern, Bürgern, Soldaten, einem Schriftsteller, zwei Juden, Pilatus und anderen mehr unterhält, wobei die Zeit, zu der diese Szenen spielen zwischen dem 1. und dem 20. Jahrhundert verschwimmt. Am Ende wird er natürlich wieder ans Kreuz geschlagen, wobei diesmal ein Manager seinem letzten Atem noch die Rechte an seinen Memoiren abgewinnen möchte, sich aber angesichts der geforderten 100 % vom Ladenpreis nur mit dem Wort „Blöd geworden“ von ihm abwenden kann. Einsteins Jesus kritisiert scharf die sogenannten Christen des 20. Jahrhunderts, sowohl die Religionsverwerter als auch die Taufchristen, deren Lebens- und Geschäftsgebaren mit der Lehre des Mannes, nach dem sie sich immerhin Christen nennen, nichts mehr zu tun hat. Der ethische Gehalt der Szenen ist dabei nicht leicht auf den Punkt zu bringen: Einsteins Jesus ist ein Leidender unter den Leidenden, ein Armer auf Seiten der Armen, ein Geschlagener und Rechtloser in einer Welt von Rechthabern, Beutelschneidern und Besserwissern.
Bekannt wurde „Die schlimme Botschaft“ aber nicht durch die 200 bis zu ihrem Verbot verkauften Exemplare, sondern durch den Gotteslästerungsprozess, der 1922 gegen den Autor und seinen Verleger Ernst Rowohlt geführt wurde und der mit der Verurteilung beider zu einer Gesamtgeldstrafe von 15.000 Mark (immerhin als Ersatz für eine eigentlich fällige Gefängnisstrafe) endete. Anzeige erstattet hatten ein schwäbischer Fabrikant und ein Thüringer Superintendent; die Staatsanwaltschaft Berlin erhob daraufhin Anklage, und obwohl die Verteidigung einiges Vernünftige dagegen vorbringen konnte, dass „Die schlimme Botschaft“ den Tatbestand der Gotteslästerung erfülle, folgte das Gericht den sogenannten Sachverständigen der Staatsanwaltschaft und verurteilte Buch, Autor und Verleger.
Der Prozess und sein Urteil wurden in der deutschen Presse durchaus kontrovers diskutiert; auch bildete er den Anlass für eine Umfrage unter Künstlern und Gelehrten, ob denn einerseits Einsteins Buch gotteslästerlich und andererseits der Gotteslästerungsparagraph im Strafgesetzbuch überhaupt noch zeitgemäß sei. All das ist ganz wundervoll vollständig dokumentiert in dem Artikel „Einstein, Carl“ im ersten Band von Heinrich Hubert Houbens – der wahrscheinlich noch ein Stück näher der Grenze zum Vergessen west als Einstein – „Verbotene Literatur“, der 1923 (vordatiert auf 1924) ebenfalls bei Rowohlt erschienen ist und sich also zur Zeit des Prozesses gerade im Entstehen befand. Houben konnte das im Archiv von Rowohlt gesammelte Material benutzen und so ein umfassendes Bild des Prozesses und der Reaktionen auf ihn liefern.
Für Einstein bedeutete dieser Prozess aber natürlich zuerst einmal einen schriftstellerischen Maulkorb, auf lange Sicht Exil in Frankreich (ab 1928) und in letzter Instanz den Freitod vor den heranrückenden Nationalsozialisten. Der ein oder andere versprengte Kunsthistoriker denkt heute noch an ihn, und eine kleine Schar von Germanisten versucht sein Werk im Bewusstsein der Lebenden zu halten. Das Bändchen im homunculus verlag liefert neben dem Text der „Schlimmen Botschaft“ auch den – soweit ich sehe kompletten – Artikel Houbens. Das kurze Vorwort ist leider anonym; auch erfährt der Leser nicht, welche Textgrundlage dieser Neudruck hat, was das Buch für die germanistische Arbeit ein wenig entwertet. Wollen wir hoffen, dass es wenigstens diesmal diejenigen in größerer Menge erreicht, die es 1921 schon hätte erreichen sollen: die Leser.
Carl Einstein: Die schlimme Botschaft. 20 Szenen. Erlangen: homunculus, 2015. Broschur, 167 Seiten. 17,90 €.