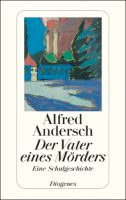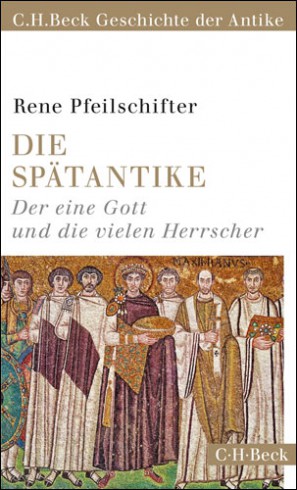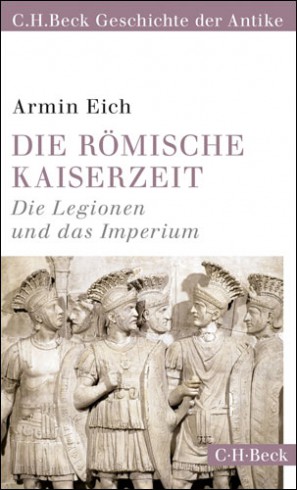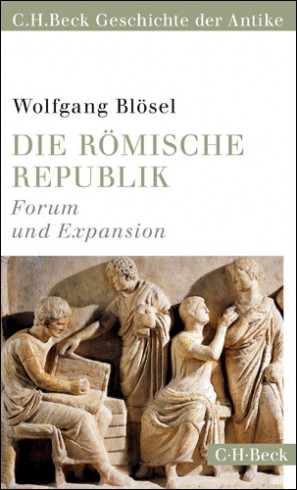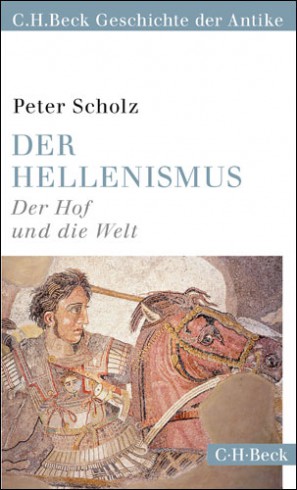3. Juni 1986, München
Diana Kempff ruft an. Ich hätte zu ihr einmal gesagt, nach meinem Tod soll sie anderen sagen: ich habe Gott geliebt. Ein anderer Ausbruch: Scheißkonjunktive, ScheißGötter. Aussprüche eines Richtigen? – Ich nütze nichts aus in diesem Leben. Das ist der Rest von Tugend. Sonst war ich immer bemüht, mich aus unguten, peinigenden oder auch belästigenden Empfindungen zu befreien. – Was ich Diana erzählte: Heute im Luitpoldpark ein Augenblick großer Ruhe, auch im Zusammenhang mit der Empfindung des Augenblicks (mehr kann ich darüber nicht sagen: vergessen). Meine Formulierung noch im Park: Das einzige aktuelle Erfassen dieser Welt ist mystisch. Man muß Mystiker werden. Ich werde es mir nicht erlauben. Diana sagte noch viel Gutes, Liebes zu mir.
Paul Wühr
Der faule Strick
Schlagwort: Deutsche Literatur
Alfred Döblin: Die drei Spünge des Wang-lun
 Es passiert einem doch vergleichsweise hartnäckigen und trainierten Leser wie mir selten, dass ich an einem Roman eines Autors, der mich interessiert, vollständig scheitere. Bei „Die drei Sprünge des Wang-lun“ habe ich nach einem Viertel des Romans aufgegeben, noch ein wenig im dritten und vierten Teil gestöbert und das Buch dann zur Seite gelegt mit dem deutlichen Eindruck, dass, was immer nun noch erzählt werden wird, mich einfach nicht interessiert.
Es passiert einem doch vergleichsweise hartnäckigen und trainierten Leser wie mir selten, dass ich an einem Roman eines Autors, der mich interessiert, vollständig scheitere. Bei „Die drei Sprünge des Wang-lun“ habe ich nach einem Viertel des Romans aufgegeben, noch ein wenig im dritten und vierten Teil gestöbert und das Buch dann zur Seite gelegt mit dem deutlichen Eindruck, dass, was immer nun noch erzählt werden wird, mich einfach nicht interessiert.
Dass Unverständnis beginnt schon damit, dass mir in Sekundärtexten gesagt wird, der Roman spiele im China des 18. Jahrhunderts. Das tut er nicht. Der Roman spielt nirgendwo und nirgendwann, in irgendwelchen Städten und Dörfern, Bergen und Tälern, Höhlen und Hütten, die alle vollkommen gesichtslos und einander gleich sind. Seine Charaktere sind flach wie die Hermann Hesses, ihre vorgeblichen Gedanken wuschig wie die Peter Sloterdijks und die Episoden der Handlung so zufällig aufgereiht wie die Lottozahlen. Es mag schon sein, dass das alles zusammen irgendetwas bedeutet, dass die Zahnräder des Romans an irgendeiner Stelle in irgendeine irgendwann existiert habende Wirklichkeit eingegriffen und etwas angetrieben haben, aber falls dem so sein sollte, ist es mir vollständig verschlossen geblieben.
So weit ich es beurteilen kann, wird im Roman die Geschichte Wang-luns erzählt: Sohn eines Fischers, ein wilder und unerzogener Knabe eines eingebildeten Vaters, der zu einem Kerl heranwächst, der stiehlt und sich über andere lustig macht. Dann wird ihm von der Polizei ein Freund erschlagen, er wiederum erwürgt den Polizisten, flieht in die Berge und wird ein frommer Mann. Viele Dummköpfe strömen ihm zu. Er ermordet einen Teil der Dummköpfe. Er geht fort, angeln. Der Kaiser ermordet einen anderen Teil der Dummköpfe. Da wendet sich Wang-lun an der Spitze der verbliebenen Dummköpfe gegen den Kaiser. Und dann lässt er es wieder bleiben. Das alles geschieht vor dem Hintergrund einer chinesisch dekorierten Märchenwelt. Hermann Hesses „Siddharta“ ist ähnlich undeutlich, aber viel, viel kürzer.
Das Buch gehört in die Reihe der China-Bücher vom Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts (Karl May, Elisabeth von Heyking, Klabund, Hans Bethge, Albert Ehrenstein, Bert Brecht), steht aber mit seiner Entstehungszeit 1912/13 relativ früh in dieser Reihe. Es ist für seinen abgehobenen Inhalt erstaunlich gut verkauft und noch vor 1933 ins Dänische und Französische übersetzt worden. Es muss also wohl was dran sein. Nur was, habe ich nicht herausfinden können.
Gelesen habe ich: Alfred Döblin: Die drei Sprünge des Wang-lun. Chinesischer Roman. Olten/Freiburg i.Br.: Walter, 1977. Leinen, Fadenheftung, 502 Seiten.
Lieferbar ist: Dass. Fischer-Tb. 90460. Frankfurt/M.: Fischer, 2013. Broschur, 528 Seiten. 10,99 €.
Alfred Andersch: Der Vater eines Mörders
Alfred Andersch ist einer meiner kleineren Hausheiligen. Einige seiner frühen Texte sind ideologisch unnötig deutlich, aber die positive Unbestimmtheit seiner Texte nimmt mit der Zeit erfreulich zu, und mit „Winterspelt“ hat er einen der wichtigen deutschsprachigen Romane des 20. Jahrhunderts geschrieben.
Bei „Der Vater eines Mörders“ handelt es sich um die letzte von sechs Erzählungen, die um den Protagonisten Franz Kien herum erfunden wurden. Bei Franz Kien handelt es sich gemäß dem Bekenntnis des Autors um sein literarisches Alter ego, und die Erzählungen verarbeiten daher direkt autobiographisches Material, persönliche Erinnerungen. In diesem speziellen Fall handelt es sich wesentlich um eine Schulstunde im Jahre 1928, genauer eine Griechisch-Stunde, in der Franz Kien vom Rektor des Wittelsbacher Gymnasiums in München geprüft und für zu faul befunden wird. Diese Stunde bildet deshalb einen Wendepunkt in der Lebensgeschichte Franz Kiens, weil aus ihr sein Verweis vom Gymnasium resultiert, er in eine kaufmännische Lehre wechseln und einer ungewissen Zukunft entgegen gehen muss. Er teilt dies Geschick mit seinem Bruder.
Die eigentliche Ursache der Schulverweise aber liegt woanders: Franz’ Vater, ein Offizier des Ersten Weltkriegs, ist erkrankt und ohne Arbeit und kann daher das Schulgeld für seine Söhne nicht aufbringen. Der Rektor lässt die beiden Brüder aus Einsicht in die Notlage ihres Vaters dennoch das Gymnasium weiterhin besuchen, doch kann eine solche Subvention der Knaben nur durch entsprechende schulische Leistungen gerechtfertigt werden. Da sich beide aber mehr oder weniger durch den Schulbetrieb durchmogeln, erbringt der Rex in der geschilderten Schulstunde den öffentlichen Beweis, dass Franz Kien als Schüler nicht zu halten ist. Insoweit ist die gesamte Stunde eine Inszenierung, eine Vorführung, in der der Schüler Kien seine Rolle zu spielen hat, und er schlägt sich, sieht man von seinen mangelhaften Griechisch-Kenntnissen einmal ab, dabei ganz respektabel.
Ihren für den oben geschilderten Inhalt eher merkwürdigen Titel bezieht die Erzählung aus der Tatsache, dass im Jahr 1928 der Rektor des Wittelbacher Gymnasiums Gebhard (der Vorname kommt bei Andersch nirgends vor) Himmler war, der Vater des späteren Anführers der SS und Massenmörders Heinrich Himmler. In diesem Detail ragt die Erzählung sozusagen in eine Wirklichkeit hinein, deren Fürchterlichkeit in ihr selbst nicht realisiert ist und nicht realisiert werden kann. Das Interessanteste an dem historischen Faktum, dass es Gebhard Himmler war, der entscheidend in Alfred Anderschs Lebenslauf eingegriffen hat, ist aber, dass Andersch sich selbst nicht darüber klar ist, ob und was das eigentlich zu bedeuten hat.
Die Erzählung hat – wie gute Literatur das immer tut – zahlreiche, oft nicht oder nur unzureichend vom Text gedeckte Reaktionen hervorgebracht: Den Anlass dafür, dass ich das Buch nach vielen Jahren wieder zur Hand genommen habe, bilden zwei solche Rezeptionszeugnisse. Das erste entstammt einer kurzen Geschichte der SS:
Dass [Heinrich] Himmler keineswegs – wie Alfred Andersch in seiner bekannten Erzählung Der Vater eines Mörders von 1980 behauptet hat – aus protofaschistischen Verhältnissen kam, hat spätestens Peter Longerich in seiner Biographie von 2008 belegt. Vielmehr war Himmlers Münchner Elternhaus zwar konservativ und streng katholisch, aber bildungs- und nicht kleinbürgerlich.
Bastian Hein: Die SS. Geschichte und Verbrechen. München: C. H. Beck, 2015. S. 15.
Nun ist es einerseits etwas schwierig, dass Andersch in einer Erzählung etwas behauptet haben soll, denn es handelt sich ja eben nicht um einen unmittelbar autobiographischen Text, dem man eventuell mit einigem Recht einen historischen Wahrheitsanspruch unterstellen könnte, sondern um eine Fiktion, die vorerst einmal gar nichts über die Wirklichkeit behauptet, sondern eine Wirklichkeit erfindet. Andererseits verführen uns natürlich der Titel und die von Andersch betonte autobiographische Unterfütterung der sechs Franz-Kien-Erzählungen, diese erfundene Wirklichkeit mit der historischen abzugleichen und sie auf Übereinstimmungen hin zu kontrollieren.
Problematischer aber an dem Zitat von Hein ist, dass selbst wenn man Anderschs Erzählung als autobiographisches Dokument liest, dort nirgends zu finden ist, Heinrich Himmler stamme aus „protofaschistischen Verhältnissen“, was immer das auch sein mag.
Andersch hat die Befürchtung gehabt, dass gerade diese Erzählung eine außergewöhnlich hohe Rate an Missverständnissen hervorbringen würde, und ihr deshalb einen reflektierenden Text mitgegeben, der „Nachwort für Leser“ überschrieben ist. Dort findet sich eine Stelle, in der er explizit über die soziologische Einordnung des Elternhauses von Heinrich Himmler spricht:
Angemerkt sei nur noch, wie des Nachdenkens würdig es doch ist, daß Heinrich Himmler – und dafür liefert meine Erinnerung den Beweis – nicht, wie der Mensch, dessen Hypnose er erlag, im Lumpenproletariat aufgewachsen ist, sondern in einer Familie aus altem, humanistisch fein gebildetem Bürgertum. Schützt Humanismus denn vor gar nichts? Die Frage ist geeignet, einen in Verzweiflung zu stürzen.
Alfred Andersch: Der Vater eines Mörders. Eine Schulgeschichte. detebe 23608. Zürich: Diogenes, 2006. S. 86.
Heins Zitat verweist aber auf eine weitere Auseinandersetzung mit Anderschs Erzählung in der Himmler-Biographie Peter Longerichs. Dabei sollte man Hein nicht dahingehend missverstehen, dass bereits Longerich die Auffassung vertritt, Anderschs Erzählung behaupte, Himmler entstamme „protofaschichstischen Verhältnissen“. Longerichs Biographie liefert Hein bloß die Widerlegung dieser von Andersch nie gemachten Behauptung. Doch Longerich verfügt ersatzweise über ein ganz eigenes Missverständnis. Er fasst die Fabel der Erzählung in gut zehn Zeilen zusammen und beschließt diese Synopse mit folgenden Sätzen:
Nun befiehlt der Rex den Helden der Geschichte, den Andersch Franz Kien genannt hat, an die Tafel und führt nicht nur geradezu genussvoll dessen miserable Griechischkenntnisse vor, sondern macht Kien-Andersch nach allen Regeln der Kunst – zynisch, hämisch, gemein – fertig. […] er muss die Anstalt verlassen.
Peter Longerich: Heinrich Himmler. Biographie. München: Siedler, 2008. S. 17.
Der nicht durch seine eigene Schulerfahrung traumatisierte Leser der Erzählung wundert sich wahrscheinlich über diese Einschätzung des Rex, denn von Zynismus, Häme oder Gemeinheit lässt sich in der Erzählung nichts entdecken. Im Gegenteil lobt der Rektor gleich mehrfach und ohne jegliche Ironie die Intelligenz und Auffassungsgabe Kiens; wenn in dieser Unterrichtsstunde überhaupt jemand fertig gemacht wird, ist es der die Klasse unterrichtende Kandidat Dr. Kandlbinder, den der Rex vor der Klasse scharf dafür zurechtweist, dass es seiner Aufmerksamkeit entgangen ist, dass Franz Kien seit sechs Wochen in seinem Unterricht nicht mehr als gerade einmal das griechische Alphabet gelernt hat. Sicherlich wird Franz’ Unwissen vorgeführt, doch der Grund hierfür ist nicht Zynismus oder Gemeinheit; der Rektor verschafft sich, wie oben bereits gesagt, durch die Inszenierung der Stunde einen Anlass dafür, Franz Kien von der Schule verweisen zu können. Im Widerspruch zu Longerichs Lektüre zeigt der Rex eine außergewöhnliche Sympathie für den Schüler Kien: Er hält ihn für klüger als die meisten seiner Mitschüler, nur eben zu Recht für faul und verwildert. Er nimmt Kiens Antwort, er wolle später Schriftsteller werden, ganz ernst und statt sich über die Ambitionen des Schulversagers lustig zu machen, fragt er ihn, was er denn für Bücher schreiben wolle. Und als Franz antwortet, dass er das noch nicht wisse, hält der Rex das für eine „ganz gescheite Antwort – ich hätte sie dir gar nicht zugetraut“. Natürlich handelt es sich nicht um ein Gespräch auf Augenhöhe, aber das ist bei einer Unterhaltung zwischen einem 14-jährigen Schüler und seinem Rektor und schon gar im Jahr 1928 auch nicht zu erwarten. Doch fertig gemacht wird Franz Kien in der Erzählung keineswegs.
Longerich hätte besser auf eine seiner Quellen hören und den Text Anderschs daraufhin noch einmal lesen sollen:
[Otto] Gritschneder hatte […] als Klassenkamerad neben Andersch gesessen; dieser sei, so seine Auskunft, einfach ein schlechter Schüler gewesen, und seine Schulkarriere am Wittelsbacher Gymnasium sei auf ganz normale Weise beendet worden.
Ebd. S. 18.
Genau das und nichts anderes steht in Anderschs Erzählung.
Die Kunst des genauen Lesens ist zumindest ebenso selten zu finden wie die des guten Schreibens.
Alfred Andersch: Der Vater eines Mörders. Eine Schulgeschichte. detebe 23608. Zürich: Diogenes, 2006. Broschur, 89 Seiten. 8,90 €.
Theodor W. Adorno: Minima Moralia
Keiner glaubt keinem, alle wissen Bescheid.
 Bei der Kleinen Ethik Adornos, die in der Hauptsache zwischen 1944 und 1947 entstanden ist, handelt es sich wahrscheinlich um sein meistgelesenes Buch überhaupt. Die Auflage liegt inzwischen bei über 120.000 Exemplaren, was für ein deutschsprachiges, ernsthaft philosophisches Buch des 20. Jahrhunderts beachtlich ist. Dabei ist zu betonen, dass es Adorno seinen Lesern durchaus nicht einfach macht: Seine Sprache befindet sich überall auf der Höhe der Reflexion, die behandelten Themen werden vor dem Hintergrund einer nirgends ausführlich ausgeführten Gesellschaftstheorie analysiert und viele dieser Analysen sind sehr knapp gehalten; einzig die Gliederung des Materials in 153 Abschnitte, die selten mehr als drei Seiten umfassen, kommt der Lektüre des philosophischen Laien entgegen.
Bei der Kleinen Ethik Adornos, die in der Hauptsache zwischen 1944 und 1947 entstanden ist, handelt es sich wahrscheinlich um sein meistgelesenes Buch überhaupt. Die Auflage liegt inzwischen bei über 120.000 Exemplaren, was für ein deutschsprachiges, ernsthaft philosophisches Buch des 20. Jahrhunderts beachtlich ist. Dabei ist zu betonen, dass es Adorno seinen Lesern durchaus nicht einfach macht: Seine Sprache befindet sich überall auf der Höhe der Reflexion, die behandelten Themen werden vor dem Hintergrund einer nirgends ausführlich ausgeführten Gesellschaftstheorie analysiert und viele dieser Analysen sind sehr knapp gehalten; einzig die Gliederung des Materials in 153 Abschnitte, die selten mehr als drei Seiten umfassen, kommt der Lektüre des philosophischen Laien entgegen.
 Je nach Lektüre lassen sich unterschiedliche Zentren des Buches ausmachen. Adorno selbst hat später die Handreichung gegeben, die „Minima Moralia“ seien ein Buch über das falsche Leben; genau so könnte man behaupten, dass sie ein Buch über die Unmöglichkeit einer Ethik in einer auf den Tauschwert aller Erscheinung geeichten Gesellschaft ist. Man kann es auch als eine differenzierende Fortsetzung der „Dialektik der Aufklärung“ lesen. Neben spezifisch ethischen Themen behandelt Adorno auch Fragen der Ästhetik, insbesondere der Erscheinungen der Massenkultur – sein Lieblingsbeispiel ist der Hollywood-Film, wobei hier zu bedenken ist, dass er die volle Entwicklung dieser Form des Kunstgewerbes zum Zeitpunkt der Niederschrift nicht einmal erahnen konnte.
Je nach Lektüre lassen sich unterschiedliche Zentren des Buches ausmachen. Adorno selbst hat später die Handreichung gegeben, die „Minima Moralia“ seien ein Buch über das falsche Leben; genau so könnte man behaupten, dass sie ein Buch über die Unmöglichkeit einer Ethik in einer auf den Tauschwert aller Erscheinung geeichten Gesellschaft ist. Man kann es auch als eine differenzierende Fortsetzung der „Dialektik der Aufklärung“ lesen. Neben spezifisch ethischen Themen behandelt Adorno auch Fragen der Ästhetik, insbesondere der Erscheinungen der Massenkultur – sein Lieblingsbeispiel ist der Hollywood-Film, wobei hier zu bedenken ist, dass er die volle Entwicklung dieser Form des Kunstgewerbes zum Zeitpunkt der Niederschrift nicht einmal erahnen konnte.
Die bedeutendste Schwierigkeit, die sich einer angemessenen Auseinandersetzung mit Adornos Ethik entgegenstellen dürfte, ist sein eigentümliches Menschenbild, das den Individualismus nahezu vollständig als fehlerhaftes begriffliches Konzept behandelt und mit Ausnahme weniger widerständiger Intellektueller und Künstler nurmehr den bis auf verschwindende Reste mit seiner gesellschaftlichen Funktion identischen Massenmenschen kennt. Man wird unter diesen Massenmenschen auf Anhieb wahrscheinlich nur wenig Bereitschaft finden, diesem anthropologischen Entwurf beizutreten. Die Lebensform der Menschheit ist – wie bereits gesagt – die grundsätzliche Reduzierbarkeit aller Erscheinungen auf ihren Tauschwert, sprich der Kapitalismus, als dessen konsequenteste Form sich der Faschismus erwiesen hat. Angesichts solcher Verhältnisse ist an eine Ethik im emphatischen Sinn nicht zu denken. Was bleibt ist die dialektische Kritik, die stets fortzuentwickeln ist, da das falsche Weltverhältnis die prinzipielle Tendenz hat, jegliche Kritik in sich zu vereinnahmen und aufzuheben. Es wäre für Adorno ein verzweifelter Genuss gewesen, hätte er erleben dürfen, wie sehr er mit seiner Analyse Recht behalten sollte.
Unabhängig davon, ob man dem zugrunde liegenden Weltbild zustimmt oder nicht, bietet das Buch eine Überfülle von präzisen und auf den Punkt formulierten Details. Ich selbst habe Adorno zuletzt in meiner Studienzeit gelesen und bei der erneuten Lektüre einen nicht erinnerten Reichtum an Einzelbeobachtungen und -formulierungen gefunden, die für sich bestehen uneingedenk der konkreten dialektischen Bewegung, der sie entstammen.
Das Leben hat sich in eine zeitlose Folge von Schocks verwandelt, zwischen denen Löcher, paralysierte Zwischenräume klaffen. Nichts aber ist vielleicht verhängnisvoller für die Zukunft, als daß im wörtlichen Sinn bald keiner mehr wird daran denken können, denn jedes Trauma, jeder unbewältigte Schock der Zurückkehrenden ist ein Ferment kommender Destruktion. – Karl Kraus tat recht daran, sein Stück »Die letzten Tage der Menschheit« zu nennen. Was heute geschieht, müßte »Nach Weltuntergang« heißen.
Theodor W. Adorno: Minima Moralia. In: Gesammelte Schriften. Hg. v. Rolf Tiedemann. Digitale Bibliothek Band 97 (CD-ROM). Berlin: Directmedia Publishing, 2004. Digitale Lizenzausgabe der Gesammelten Schriften in 20 Bänden des Suhrkamp Verlages.
Uwe Timm: Rot
Bald […] werden die Herbstbilder Pegasus, Fische und Walfisch gut zu sehen sein. Und in dem Walfisch ist der [τ] Cet, der unserer Sonne so ähnlich sein soll, weil auch er Planeten hat. Vielleicht das wahre Utopia, ohne angemaßte Herrschaft, ohne unnötiges Leid, das würde schon reichen.
 Ein außergewöhnlich gut konstruierter und detailreicher Roman über den Abschied von den Idealen der 68er-Studentbewegung; für die eine oder den anderen dürfte er vielleicht sogar ein wenig zu konstruiert sein. Der Ich-Erzähler Thomas, ein Alt-68er, der im bürgerlichen Leben nie recht Fuß gefasst hat, liegt buchstäblich auf der Straße, die er bei Rot überquert hatte, weshalb er angefahren wurde. Wahrscheinlich stirbt er während des Erzählens und färbt mit seinem Blut die Straße unter sich; neben ihm liegt ein Päckchen Sprengstoff, das gerade aus seiner Aktentasche gefallen ist.
Ein außergewöhnlich gut konstruierter und detailreicher Roman über den Abschied von den Idealen der 68er-Studentbewegung; für die eine oder den anderen dürfte er vielleicht sogar ein wenig zu konstruiert sein. Der Ich-Erzähler Thomas, ein Alt-68er, der im bürgerlichen Leben nie recht Fuß gefasst hat, liegt buchstäblich auf der Straße, die er bei Rot überquert hatte, weshalb er angefahren wurde. Wahrscheinlich stirbt er während des Erzählens und färbt mit seinem Blut die Straße unter sich; neben ihm liegt ein Päckchen Sprengstoff, das gerade aus seiner Aktentasche gefallen ist.
Beruflich ist Thomas Grabredner, einer jener, die gebeten werden, in den Fällen über dem Toten zu sprechen, wenn keine der Konfessionen sich als zuständig betrachtet oder vom Toten gern gesehen würde. Und so hält Thomas in seinen letzten Minuten auf Erden eine Grabrede auf sich und seine ehemaligen Freunde aus der Studentenbewegung: Zum Beispiel Edmond und Vera, die aus der Frankophilie Edmonds einen lukrativen Weinimport gemacht und sich als neureiche Alkoholiker in einer Neubau-Villa niedergelassen haben. Die Ehe kriselt, Vera ist im Entzug, Edmond sitzt im von seiner Frau leergeräumten Haus, säuft Wein aus dem Suppenteller und schlägt seinen Kopf vor die Wand. Oder Krause, der mit Lisa, einer Norwegerin, in Mecklenburg-Vorpommern in ländlicher Idylle mit Streuselkuchen und Schlagsahne lebt. Beide sind Lehrer, und Krause betreibt nebenbei ein Antiquariat, das auf die Theorie der Studentenrevolution spezialisiert ist.
Am wichtigsten aber ist Aschenberger, der gerade verstorben ist und Thomas testamentarisch als seinen Grabredner verpflichtet hat. Auch Aschenberger scheint sich bürgerlich etabliert zu haben – er hat bei seiner Heirat den Namen seiner Frau angenommen und heißt nun Lüders. Er verdient sein Geld mit alternativen Stadtführungen durch Berlin, lebt in einer mit Büchern vollgestopften Wohnung und plant einen letzten großen Coup: Er will die Berliner Siegessäule als Symbol der missratenen deutschen Geschichte in die Luft sprengen und sich anschließend der Polizei stellen. Aus seinem Nachlass stammt der Sprengstoff, der Thomas bei seinem Unfall aus der Tasche gefallen ist.
Die Wiederbegegnung mit Aschenberger setzt Thomas sichtlich zu, der selbst sich vor einigen Jahren nach einer Midlife-Crisis radikal von der eigenen Vergangenheit getrennt hat, in dem er allen persönlich Besitz verkauft oder weggeworfen hat und seitdem in einer kargen Wohnung sein Leben von Tag zu Tag verbringt. Doch sein unreligiöses Mönchstum wird derzeit heftig gestört: Thomas hat eine Affäre mit der verheirateten Iris, die eine Generation jünger ist als er. Iris ist Bühnenbildnerin und Lichtgestalterin, sie lebt also davon, ästhetische Illusionen zu verkaufen. Die Affäre spitzt sich kurz vor Thomas Unfall zu, als Iris schwanger wird, ihren Mann Ben verlässt und mit Thomas eine Familie gründen will. Ihre offene Emotionalität überwältigt Thomas immer mehr, der kurz davor steht, sich auf Iris Pläne einzulassen, als der Unfall all dem ein Ende setzt.
Außer dieser Hauptlinie der Erzählung glänzt der Roman mit zahlreichen weiteren Nebenfiguren und Kleinsterzählungen, etwa der depressiven Animateurin Tessy, der politisch engagierten Türkin Nilgün oder dem Maler Horch – wahrscheinlich der spannendsten Figur im ganzen Roman. Man findet heute nur wenige Erzähler, die tatsächlich soviel zu erzählen haben und denen es gelingt, ihre divergierenden Stoffe dennoch auf die großen literarischen Themen – Tod, Liebe, Geburt – zu fokussieren, ohne dass es peinlich wird. Ein wirklich gelungenes Stück!
Uwe Timm. Rot. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2001/2005. Bedruckter Pappband, 428 Seiten. 15,– Euro. (Auch als dtv-Taschenbuch lieferbar.)
100 Jahre Dada
Alles in unserer Zeit ist Dada, nur die Dadaisten nicht. Wenn die Dadaisten Dadaisten wären, dann wären die Dadaisten keine Dadaisten.
Theo van Doesburg
In diesem Jahr wäre Dada 100 Jahre alt geworden, wenn es nicht bereits unmittelbar vor seiner Zeugung verstorben wäre:
Dada ist tot, bevor es überhaupt angefangen hat. Zum ersten Mal stirbt Dada, als Tzara aus einer Laune eine Kunstrichtung machen will. Dada stirbt seinen Heldentod, als Ball im Juni 1916 Zürich verlässt. Dada dreht sich im Grabe um, als Huelsenbeck, Tzara und Arp versuchen, es in anderen Städten zu etablieren. In der Auseinandersetzung zwischen Picabia, Breton, Tzara und ihren Gesellen stirbt Dada tausend Tode. Aber so darf Dada nicht vertröpfeln, es muss auch einmal ordentlich symbolisch zu Grabe getragen werden.
Banalerweise leben Totgesagte immer länger, besonders dann, wenn zu bezweifeln ist, dass sie überhaupt jemals von selbst geatmet haben. Das alles stört aber Dada und die meisten seiner Vorkämpfer überhaupt nicht. Sich um solch offenbare Widersprüche zu kümmern, hieße die Macht des Paradoxen zu verschwenden. Dada setzt tiefer an, nämlich dort wo sich Vernunft und Unvernunft gute Nacht sagen – an der kargen Oberfläche der bürgerlichen Kultur.
 Natürlich ist der Manesse Verlag mit Sitz in Zürich prädestiniert, Dada zum Jubiläum mit einer Anthologie zu würdigen. Die Textauswahl ist beeindruckend umfassend; sogar Clément Pansaers (1885–1922) und Paul von Ostaijen (1896–1928), zwei belgische Dadaisten, von denen ich bis dato noch nie gehört oder gelesen hatte, sind vertreten. Ansonsten ist alles anwesend, was noch keinen Rang hatte und sich einen Namen machte: Tristan Tzara, Hans Arp, Georg Grosz, Walter Serner, Richard Huelsenbeck, Hugo Ball und Emmy Hennings, Walter Mehring (den ich besonders schätze), Raoul Hausmann, Francis Picabia, André Breton, Paul Éluard und und und. Die Auswahl der Texte ist ebenso gelungen: Weder fehlen die bekannten Klassiker (etwa Balls „Karawane“ oder Schwitters „An Anna Blume“), noch die Überraschungen, wegen derer man einen solchen Almanach kaufen sollte. Auch die Auswahl aus der unendlichen Flut dadaistischer Manifeste, die bekanntlich nichts sagen, dass aber in einer Ausführlichkeit, mit der sich nur politische Reden messen können, ist exzellent. Begleitet werden die Texte durch einen Anhang, der die wichtigsten Dadaisten in biographischen Kurzporträts vorstellt und die wichtigsten Orte der Aufführung präsentiert. Das zusätzliche Spiel mit Schwarz und Rot im Druckbild rundet den Band perfekt ab. Das einzige, was man vermissen könnte, ist, dass Dada nicht ausschließlich eine textbasierte Strömung war, sondern insbesondere auch Graphik, Collage und Musik mit einbezog.
Natürlich ist der Manesse Verlag mit Sitz in Zürich prädestiniert, Dada zum Jubiläum mit einer Anthologie zu würdigen. Die Textauswahl ist beeindruckend umfassend; sogar Clément Pansaers (1885–1922) und Paul von Ostaijen (1896–1928), zwei belgische Dadaisten, von denen ich bis dato noch nie gehört oder gelesen hatte, sind vertreten. Ansonsten ist alles anwesend, was noch keinen Rang hatte und sich einen Namen machte: Tristan Tzara, Hans Arp, Georg Grosz, Walter Serner, Richard Huelsenbeck, Hugo Ball und Emmy Hennings, Walter Mehring (den ich besonders schätze), Raoul Hausmann, Francis Picabia, André Breton, Paul Éluard und und und. Die Auswahl der Texte ist ebenso gelungen: Weder fehlen die bekannten Klassiker (etwa Balls „Karawane“ oder Schwitters „An Anna Blume“), noch die Überraschungen, wegen derer man einen solchen Almanach kaufen sollte. Auch die Auswahl aus der unendlichen Flut dadaistischer Manifeste, die bekanntlich nichts sagen, dass aber in einer Ausführlichkeit, mit der sich nur politische Reden messen können, ist exzellent. Begleitet werden die Texte durch einen Anhang, der die wichtigsten Dadaisten in biographischen Kurzporträts vorstellt und die wichtigsten Orte der Aufführung präsentiert. Das zusätzliche Spiel mit Schwarz und Rot im Druckbild rundet den Band perfekt ab. Das einzige, was man vermissen könnte, ist, dass Dada nicht ausschließlich eine textbasierte Strömung war, sondern insbesondere auch Graphik, Collage und Musik mit einbezog.
 Wer darüber mehr erfahren und Dada im allgemeineren Kontext der Moderne dargestellt haben möchte, kann zu Martin Mittelmeiers Buch greifen (aus dem auch das längere Zitat oben stammt). Mittelmeier versucht, einen Weg zu finden, dem chronologischen, persönlichen, formalen und inhaltlichen Chaos Dadas gerecht zu werden. Wer sich nicht schon ein wenig in der Kulturgeschichte des frühen 20. Jahrhunderts auskennt, könnte im Stakkato einiger Passagen des Buches verlorengehen. Alles in allem und im Großen und Ganzen muss man Mittelmeier zugestehen, dass er diese schwierige Aufgabe gut bewältigt, sind doch zahllose biographische Details, parallele Entwicklungen, Verwerfungen, Verfeindungen und Zweckbündnisse, Widersprüche und Gegensätze darzustellen, deren Anlässe für einen, der nicht tief in den Verwicklungen dieser Zeit steckt, nur schwer nachzuvollziehen sind.
Wer darüber mehr erfahren und Dada im allgemeineren Kontext der Moderne dargestellt haben möchte, kann zu Martin Mittelmeiers Buch greifen (aus dem auch das längere Zitat oben stammt). Mittelmeier versucht, einen Weg zu finden, dem chronologischen, persönlichen, formalen und inhaltlichen Chaos Dadas gerecht zu werden. Wer sich nicht schon ein wenig in der Kulturgeschichte des frühen 20. Jahrhunderts auskennt, könnte im Stakkato einiger Passagen des Buches verlorengehen. Alles in allem und im Großen und Ganzen muss man Mittelmeier zugestehen, dass er diese schwierige Aufgabe gut bewältigt, sind doch zahllose biographische Details, parallele Entwicklungen, Verwerfungen, Verfeindungen und Zweckbündnisse, Widersprüche und Gegensätze darzustellen, deren Anlässe für einen, der nicht tief in den Verwicklungen dieser Zeit steckt, nur schwer nachzuvollziehen sind.
Sehr loben muss man Mittelmeier dafür, dass er den bequemen Ansatz, Dada sei die Reaktion einiger Intellektueller auf den Wahnsinn des Ersten Weltkrieges, als unzureichend begreift und Dada stattdessen in die künstlerischen Umbrüche zu Beginn des 20. Jahrhunderts einstellt: Das Aufgeben der Zentralperspektive in der Malerei, der Harmonik in der Musik – wenn auch seine Rede davon, Schönberg befreie „den einzelnen Ton aus dem Korsett der klassischen Tonalität“ (S. 51) dummes Geschwätz ist –, die Faszination der Geschwindigkeit und die Empfindung der Simultanität sind andere Aspekte desselben grundsätzlichen Zweifels an den tradierten Formsprachen, der sich auch in Dada manifestiert. Auch lässt Mittelmeier keinen Zweifel daran, dass Mangel an konkretem Inhalt, Wiederholung und der Dada notwendig innewohnende Selbstwiderspruch zu nichts anderem als zur baldigen Auflösung von Dada führen konnten, und jede neue Stadt, in die Dada getragen wird, die Agonie nur überdeckt und herauszögert. Ergänzt wird diese sehr klarsichtige Darstellung durch einige dadaistische Zwischenspiele, auf die man sich – wie auf Dada überhaupt – schlicht einlassen sollte.
Ob Mittelmeier aber tatsächlich der Auffassung ist, der Eiffelturm sei 1000 Meter hoch (S. 48), Erich Mühsam habe den Vornamen Ernst geführt (S. 66), moderne Kunst verfüge über „Autonomie“ (S. 102) oder Schwitters Bilder seien „funktional gesehen gotische Dome“ (S. 184), kann man angesichts dessen, was hier gelungen ist, auf sich beruhen lassen.
Dada-Almanach. Vom Aberwitz ästhetischer Kontradiktion. Hg. v. Andreas Puff-Trojan und H. M. Compagnon. Zürich: Manesse, 2016. Bedruckter Pappband, Fadenheftung, 176 Seiten. 39,95 €.
Martin Mittelmeier: Dada. Eine Jahrhundertgeschichte. München: Siedler, 2016. Pappband, 272 Seiten. 22,99 €.
Rene Pfeilschifter: Die Spätantike
Mit aller Macht beförderte Justinian das Heil seiner Untertanen, und sei es mit Gewalt.
Der chronologisch sechste und letzte Band von Becks „Geschichte der Antike“ – der Band zur klassischen Epoche Griechenlands fehlt derzeit noch – behandelt die Zeit von der Herrschaft Diokletians (284–305) bis zum Aufstieg des Islams zur führenden Macht im Nahen Osten, Nordafrika und auf der iberischen Halbinsel. Erst damit ist für ihn auch im oströmischen Reich die Antike endgültig abgeschlossen. Für Westrom bietet sich als Ende der Antike bereits die Mitte des 6. Jahrhunderts an, nachdem Italien durch die Befreiung von den Ostgoten durch Ostrom wirtschaftlich und kulturell weitgehend entkräftet worden ist.
Der Beginn der Spätantike ist im Wesentlichen durch zwei Veränderungen markiert: Dioklektians Reform des Kaisertums – kurzfristig gibt es zwei Augusti und zwei ihnen nachgeordnete Caesaren im römischen Reich –, die den Anfang von Ende der Einheit des römischen Reiches bildet, zum anderen der Aufstieg des Christentums zur römischen Staatsreligion unter Konstantin (306–337), womit zugleich die Verwerfungen des sich entwickelnden Christentums zur Staatsangelegenheit und damit nicht nur innenpolitisch wirksam werden, sondern bei denen auch der Kaiser eine bedeutende Rolle als Schlichter oder Mitstreiter spielt.
Für die weitere Entwicklung erweisen sich zudem die zunehmend militärisch aufholenden Nachbarvölker als entscheidend, die das Reich kontinuierlich unter Druck setzen. Zwar gelingt es immer wieder, die entsprechenden Gruppen durch Ansiedlung und Zahlungen zu befrieden, ja sie sogar in die eigenen Legionen einzubinden, doch erweisen sich solche Konstruktionen immer wieder als instabil. Wenn es den Vandalen, Goten oder Franken zu langweilig wird, ziehen sie erneut auf Raub aus und machen Gallien, Spanien oder den Balkan unsicher. Im Osten droht immer aufs Neue das Sasanidenreich, mit dem Frieden nur sporadisch zu halten ist.
Der eigentliche Zusammenbruch beginnt dann, als 476 der germanische Offizier Odoaker von den Germanen der Legion zum König gewählt wird und den letzten weströmischen Kaiser Romulus schlicht absetzt (nicht einmal mit dessen Ermordung hat er sich aufgehalten.) Als der oströmische Kaiser Zenon dann 488 versucht, die ihm lästigen (Ost-)Goten zu instrumentalisieren, um Odoakers Germanen aus Italien zu vertreiben, ersetzt er nur den Teufel durch Beelzebub, denn Theoderich hat wenig besseres zu tun, als sich das befreite Italien als gotisches Königreich zu eigen zu machen. Und als unter Kaiser Justinian (527–565) versucht wird, das Reich noch einmal zu einen, wird Italien derart gründlich in Grund und Boden befreit, dass es von da an für das Reich keine Rolle mehr spielen und eine leichte Beute der Langobarden werden sollte.
Und auch Ostrom kann sich nur unvollkommen halten: Im 7. (und 8.) Jahrhundert geht der Balkan zum Großteil an die von Norden einfallenden Slawen verloren, während man im Osten und in Nordafrika Besitzungen an die aggressiv expandierenden, islamischen Araber verliert. Das verbleibende byzantinische Reich ist nurmehr ein Schatten Ostroms und verliert auch kulturell zunehmend den Kontakt zum ehemaligen römischen Reich. Mit dem Tod Kaiser Herakleios 641 endet bei Pfeilschifter die Epoche der Antike wohl zum spätestmöglichen Zeitpunkt.
Pfeilschifters Darstellung ist – ebenso wie Eichs im Vorgängerband – gut strukturiert und stellt neben der Chronologie der Ereignisse in systematischen Kapiteln die politische und soziale Struktur insbesondere des oströmischen Reichs sowie die komplexe Genese des Christentums auch für den historischen Laien gut nachvollziehbar dar.
Mit diesem sechsten Band ist die Beck’sche Becks „Geschichte der Antike“ abgeschlossen. Mit der Beschränkung auf die griechische und römische Geschichte folgt man einem eher traditionellen Begriff der Antike; man würde sich zur Ergänzung zumindest einen ähnlich gut gemachten Band auch zum alten Ägypten wünschen, eventuell auch mit Ausblicken auf den aktuellen Forschungsstand zu den Phöniziern. In den selbst gesteckten Grenzen kann diese Geschichte der Antike durchweg nur empfohlen werden; ich warte mit Spannung auf den für dieses Jahr angekündigten Band zur klassischen Epoche Griechenlands.
Rene Pfeilschifter: Die Spätantike. Der eine Gott und die vielen Herrscher. C. H. Beck Paperback 6156. München: Beck, 2014. Klappenbroschur, 304 Seiten. 16,95 €.
Armin Eich: Die römische Kaiserzeit
Auch Becks „Geschichte der Antike“ folgt der klassischen Dreiteilung der Geschichte des römischen Imperiums in die Epoche der Republik, die Kaiserzeit und die Spätantike. Während sich die Grenze zwischen Republik und Kaiserreich mehr oder weniger von selbst versteht, kann von einem Ende der römischen Kaiserzeit nur in einem metaphorischen Sinn die Rede sein, da in der Zeit der Spätantike mehr Kaiser das römische Reich beherrscht haben als je zuvor.
Armin Eichs „Die römische Kaiserzeit“ schließt daher nahezu nahtlos an den Vorgängerband an und endet mit der Regierungszeit Kaiser Carus (282–283), also vor der Reform der Institution des Kaisertums unter Diocletian (284–305), umfasst also eine Spanne von etwa 310 Jahren. Eichs Darstellung besticht in allen Stufen der Entwicklung des Reiches in dieser Zeit durch Klarheit und Strukturiertheit, wobei die Kapitel der chronologischen Abfolge der Ereignisse durch solche der systematischen Analyse der politischen und soziologischen Verhältnisse ergänzt werden. Auch inhaltlich erscheint Eichs Geschichte der Kaiserzeit tadellos, wenn auch wahrscheinlich Kleopatra etwas gegen die Behauptung einzuwenden gehabt hätte, Gaius Iulius Caesar habe keine „direkten männlichen Nachkommen“ gehabt.
Erstaunlich und letztlich nur ansatzweise zu erklären bleibt aber immer die Stabilität des römischen Imperiums trotz massiver innen- und außerpolitischer Verwerfungen. Besonders im dritten Jahrhundert bewähert sich das Reich als Reich auch gegen massive Angriffe durch Germannengruppen im Westen und das Sasanidenreich im Osten und der schnellen Abfolge von Kaisern, die oft nach nur kurzer Regierungszeit ermordert und ersetzt werden. Auch wenn man aus heutiger Sicht die Krise bzw. Krisen des 3. Jahrhunderts als Anfang vom Ende der römischen Herrschaft über den Mittelmerraum und Westeuropa deuten kann, so ist dies für die Zeitgenossen alles andere als klar. Im Gegenteil beginnt der oben schon erwähnte Kaiser Carus, nachdem sich die Lage im Westen wieder einigermaßen beruhigt hat, umgehend einen neuen Krieg im Osten, offenbar in der Überzeugung, dass sich auch dort die Verhältnisse der Blütezeit römischer Herrschaft wieder würden etablieren lassen. Wie sehr er damit das Kräfteverhältnis zwischen Rom und seinen Nachbarn untzerschätzt haben sollte, werden aber erst die kommenden Jahrhunderte erweisen.
Armin Eich: Die römische Kaiserzeit. Die Legionen und das Imperium. C. H. Beck Paperback 6155. München: Beck, 2014. Klappenbroschur, 304 Seiten. 16,95 €.
Wolfgang Blösel: Die römische Republik
Es bleibt immer interessant genug, wie sich da im wilden Westen, in Rom wieder einmal so ein Wolfsstaat (wie damals Sparta) brutal groß frißt.
Arno Schmidt
Der Titel des chronologisch vierten Bandes von Becks „Geschichte der Antike“ bezeichnet ebenfalls den Inhalt bloß pars pro toto, da der Band mit der Frühzeit Roms und der mythischen Königszeit beginnt. Er überschneidet sich natürlich zum Teil mit dem Band zum Hellenismus, was aber aufgrund der auf Rom zentrierten Perspektive nicht weiter stört. Dargestellt wird die Geschichte des römischen Stadtstaates und des aus ihm erwachsenden Reichs von 9. Jahrhundert v.u.Z. bis zur Begründung des monarchischen Prinzipats durch Octavian Anfang 27 v.u.Z.
Dabei setzt Blösel den eigentlichen Untergang der Republik auf das Jahr 43 an, als das 2. sogenannte Triumvirat 300 Senatoren und 2.000 Ritter umbringen lässt, um die eigenen Machtbasis zu stabilisieren. Die verbleibende Oberschicht Roms stellt politisch keine Gefahr für die Triumvirn mehr dar, die wohl alle drei das Bündnis eingegangen sind, um auf diesem Weg letztlich zur Alleinherrschaft nach caesarischem Vorbild gelangen zu können.
Die erste Hälfte des Buches gerät etwas zäh, was sich nicht nur aus der vergleichsweise dünnen Quellenlage ergibt, sondern auch daraus, dass der Autor nicht unbedingt zu den begnadetsten Schriftstellern gehört – „Seine Kontrastierung findet ihre Bestätigung in den Befürchtungen“ lässt sich auf Deutsch auch ein wenig eleganter ausdrücken. Spannender wird es erst mit der Zeit der Gracchen, in der dann auch substanziell über politische Motivationen der Protagonisten spekulieren werden kann. Die Darstellung der Karriere Cäsars, des 1. Triumvirats und seiner Folgen ist untadelig, soweit ich das beurteilen kann, auch wenn Blösels Urteil über Cäsar vielleicht ein wenig negativer ausfällt, als es sein müsste.
Für alle, die sich für die Entstehung des römischen Reichs interessieren, eine knappe und durchweg empfehlenswerte Lektüre, die an den historischen Laien aber – wie auch die Bände zuvor – einige Ansprüche stellt. So werden zum Beispiel die Genese, die Aufgaben- und Machtbereiche der römischen Magistrate (Quästoren, Ädilen, Prätoren und Konsulen) eher beiläufig abgehandelt, so dass sich ein unvorbereiteter Leser über diese Strukturen des römischen Staates wird anderswo systematisch kundig machen wollen.
Was mich bei diesem erneuten Durchgang durch die römische Geschichte vor der Zeitwende mehr als je zuvor erstaunt hat, ist, dass sich das politische System Roms trotz aller Willkür und allen Gewalttaten seiner Mitspieler solange als einigermaßen stabil und – im Sinne der Akteure – funktional erhalten hat. Natürlich erklärt sich das aus einem zufälligen Zusammenspiel von individuellen Eigenschaften der Akteure und unvorhersehbaren Umständen, aber die Idee, dass eine Staatsform ihre Stabilität aus dem Gegeneinander intrinsischer Motivationen Einzelner und der gesellschaftlichen Gruppierungen beziehen kann, solange sich die Gegenspieler wenigstens im Großen und Ganzen an einen bestimmten Satz politischer Regeln halten, ist faszinierend. Das bedeutet nicht, dass das System nicht doch am Ende in ein anderes umschlagen wird, aber was die römische Republik alles aushalten konnte, ohne zu kollabieren, ist und bleibt erstaunlich.
Wolfgang Blösel: Die römische Republik. Forum und Expansion. C. H. Beck Paperback 6154. München: Beck, 2015. Klappenbroschur, 304 Seiten. 16,95 €.
Peter Scholz: Der Hellenismus
Niemand hat das Recht zu tun, was er will, doch alles ist zum Besten geordnet.
Ptolemäischer Rechtsgrundsatz
Der chronologisch dritte Band von Becks „Geschichte der Antike“ – der Band zur Griechischen Klassik soll im kommenden Jahr erscheinen – ist nach dem originellen Band zum archaischen Griechenland eine kleine Enttäuschung. Es ist dem Autor zugutezuhalten, dass es eine undankbare Aufgabe ist, die Geschichte des Hellenismus nachzuzeichnen, da ein Großteil des historischen Stoffs von den Haupt- und Staatsaktionen der Diadochenreiche gebildet wird. In seinem Resümee schreibt Peter Scholz:
Die von Alexander gleichsam begründete, mit seinem Tod einsetzende Epoche des Hellenismus bietet, was die Lektüre der vorangehenden Seiten vermitteln wollte, eine schwer überschaubare Fülle von Herrschern und ihren Familien, von großen Protagonisten und kleinen Akteuren, eine ermüdende Vielzahl kleiner Konflikte und großer Kriege, von Morden an Herrschern und Mitgliedern der jeweiligen Herrscherfamilien, von schwierigen Herrscherwechseln und damit im Zusammenhang stehenden höfischen Intrigen. Aus den zahllosen Einzelereignissen, die kaum Anspruch erheben können, im allgemeinen historischen Gedächtnis zu verbleiben, lassen sich jedoch im Überblick einige besonders charakteristische Merkmale und Errungenschaften des hellenistischen Zeitalters herausarbeiten, die es verdienen, als Merkmale der hellenistischen Geschichte erinnert zu werden. (S. 302 f.)
Leider liegt das Hauptgewicht des Textes nicht auf den „charakteristischen Merkmalen“, die nur zwischendurch auf wenigen Seiten zusammengefasst werden, sondern auf der Auflistung und Nacherzählung eben der „ermüdenden Vielzahl“ jener Daten, die sich in ähnlicher Zusammenstellung auch in jeder anderen Darstellung der Epoche finden lässt.
Scholz beginnt seine Darstellung mit einer ausführlichen Schilderung der Karriere Alexanders III. als Gewaltmensch, wobei das Bild dieses historischen Protagonisten letztlich widersprüchlich bleibt. Während Scholz einerseits bei jeder sich bietenden Gelegenheit Alexanders Egozentrismus betont, kann er es andererseits nicht umgehen, seine innovativen, wenn auch vielleicht ungelenken Versuche zur Vereinigung der griechisch-makedonischen und persischen Kultur zu schildern, die dem Bild des ausschließlich an der Selbststilisierung zum Heros Egomanen widersprechen. Auch Scholz’ These, Alexander habe auf nichtmilitärische Probleme ausschließlich ad hoc und ohne genügendes Gesamtkonzept reagiert, überzeugt nur, wenn man moderne Maßstäbe der Soziologie bzw. politischen Theorie anlegt. Alexanders Gesamtentwurf für sein Reich mag uns unzureichend erscheinen, aber zum einen war etwas ähnliches nie zuvor unternommen worden und zum anderen hatte kein Zeitgenosse jemals auch nur ansatzweise über politische Probleme dieser Größenordnung nachgedacht. Betrachtet man etwa versuchsweise Platons Analyse der Staatsformen als Anhalt für den theoretischen Horizont der Zeit, so kann von Alexander fairerweise kein substantielles Konzept für eine Durchstrukturierung seines Reichs erwartet werden. Reflektiert man gar die Reaktionen von Alexanders Mitstreitern auf seine Annäherung an persische Sitten und Rituale, so kommt man kaum umhin, ihn bei aller Egozentrik immerhin für einen originellen Kopf halten zu müssen, was immer man von seiner allgemeinen Tendenz zu Massenschlächtereien auch sonst halten mag.
Nach Alexanders Tod folgt Scholz all den oben angedeuteten Wirren und Verwicklungen der Geschichte des östlichen Mittelmeerraumes bis zum Aufstieg der Römer als neue Ordnungsmacht. Warum es den Römern gelingt, eine zwar weiterhin fragile, im Vergleich zur Epoche des Hellenismus aber immerhin kontinuierliche Herrschaft im östlichen Mittelmeerraum zu errichten, wird von Scholz nicht mehr im Detail thematisiert. Bei ihm bleibt es bei einer Kritik des wesentlich auf die Person des Königs bezogene Staatsform der hellenistischen Reiche, in der jeder Herrscherwechsel, ja, sogar jeder militärische Erfolg letztlich zu einer immer erneuten Destabilisierung des gesamten internationalen Systems führen. Der Eindruck, der dem Leser bleibt, ist, dass es keinem der Nachfolger Alexanders gelungen ist, auch nur in Ansätzen die Idee zu einer Staatsform zu finden, die nicht wesentlich von dem Individuum an der Spitze und seiner Individualität abhängig ist. Im Primat der staatlichen Struktur über den Herrscher scheint eine der Pointen der Überlegenheit und des Erfolgs der Römer zu bestehen. Mag sein, dass dies die historische Lehre aus dem Chaos des Hellenismus ist.
Peter Scholz: Der Hellenismus. Der Hof und die Welt. C. H. Beck Paperback 6153. München: Beck, 2015. Klappenbroschur, 352 Seiten. 16,95 €.