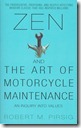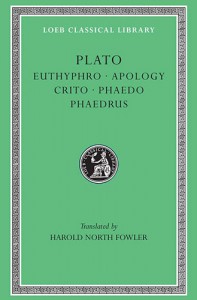[…] an unsere eigene Faulheit, an Gleichgültigkeit und intellektuelle Wirrheit.
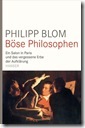 Populär und bewusst parteiisch geschriebener biographischer Essay um einige Figuren der Hauptphase der französischen Aufklärung. Das Hauptgewicht der Darstellung liegt auf Denis Diderot, als eigentliches Zentrum der Darstellung benutzt Blom aber den Salon des Baron Holbach, der seit der Mitte des 18. Jahrhunderts einer der wichtigen Orte der intellektuellen Auseinandersetzung in Paris darstellte. Leider erfährt der Leser zu wenig über die allgemeine Pariser Salonkultur dieser Zeit, so dass er sich kein Bild davon machen kann, wie typisch bzw. außergewöhnlich der Salon der Holbachs war. Aber das ist noch das geringste Manko des Buches.
Populär und bewusst parteiisch geschriebener biographischer Essay um einige Figuren der Hauptphase der französischen Aufklärung. Das Hauptgewicht der Darstellung liegt auf Denis Diderot, als eigentliches Zentrum der Darstellung benutzt Blom aber den Salon des Baron Holbach, der seit der Mitte des 18. Jahrhunderts einer der wichtigen Orte der intellektuellen Auseinandersetzung in Paris darstellte. Leider erfährt der Leser zu wenig über die allgemeine Pariser Salonkultur dieser Zeit, so dass er sich kein Bild davon machen kann, wie typisch bzw. außergewöhnlich der Salon der Holbachs war. Aber das ist noch das geringste Manko des Buches.
Für ein Buch, das über Philosophen und ihre Ideen berichtet, ist es immer schon ein schlechtes Zeichen, wenn sein Autor die Bedeutung grundlegender philosophischer Termini offenbar nicht kennt: So bedeuten transzendent und transzendental sehr unterschiedliches und können nur in ganz seltenen Fällen synonym verwendet werden. Auch sonst bleibt Bloms Darstellung der philosophischen Inhalte meist völlig unkritisch, entweder getragen von einem begeisterten Pathos oder von scharfer Ablehnung, je nachdem wie es dem Geschmack des Autor gerade entspricht. So ist Bloms Kritik der Positionen Rosseaus, so richtig sie in der Sache auch sein mag, stets durchsetzt mit mokanten und polemischen Bemerkungen, die auf die psychische Verfassung oder die persönliche Lebensführung Rousseaus zielen:
Rousseau war fasziniert von der kindlichen Entwicklung (solange sie sich nicht in seinem Haus vollzog, möchte man hinzufügen)
Nein, man möchte es nicht nur hinzufügen, man fügt es hinzu, und das einzig und allein in polemischer Absicht. Im Gegensatz dazu ist alles, was Diderot tut, wohlgetan. Während Rousseaus Gesellschaftsutopie wegen ihrer diktatorischen Konsequenzen scharf angeprangert wird, werden vergleichbare Ansichten Holbachs und Diderots verharmlosend kommentiert: Befürwortung der Todesstrafe durch Diderot? Naja, er hatte eben kein echtes Interesse an der Frage, und ansonsten hat er auch bedauert, dass so etwas notwendig sei. Und sowieso seien 300 Hinrichtungen pro Jahr in Frankreich ja auch keine so bedeutende Sache gewesen. Immerhin wird Friedrich Melchior Grimms These, dass »das Recht des Stärkeren […] die einzige Legitimität« schaffe, zitiert, bleibt aber unkommentiert stehen, anstatt als gesellschaftspolitische Konsequenz jener Ethik der Lust begriffen und kritisiert zu werden, die Blom zuvor seitenweise in den höchsten Tönen als Alternative zur christlichen Tugendlehre gepriesen hat.
Das Buch scheitert letztlich an den atheistischen und antichristlichen Affekten des Autors. Anstatt die historische Lage Mitte des 18. Jahrhunderts als die wichtige Stufe in der Entwicklung der modernen ethischen Theorien zu begreifen, die sie darstellt, versucht er eine einzelne, höchst disparate philosophische Position dieser Zeit zu verabsolutieren. Dabei legt er höchsten Wert auf den Atheismus der Vertreter dieser Position; selbst David Hume, dem er einen gewissen Rang im philosophiegeschichtlichen Prozess nicht abstreiten kann, muss leider abgewertet werden, da er nur Agnostiker gewesen ist und den Atheismus aus erkenntnistheoretischen Bedenken heraus ablehnte. Es ist dann kein Wunder, dass das, was Blom über die kantische Ethik schreibt, blanker Unfug ist und er über Kant und Hegel ansonsten nur anzumerken weiß, sie seien »wie Heilige verehrt« worden. Weder findet sich eine Auseinandersetzung mit der Lessingschen Geschichtsauffassung – einer der wichtigsten deutschen Reaktionen auf die Ideen der Aufklärung – noch mit der Kantischen Bestimmung der Pflicht. Stattdessen wird dem Leser nahegelegt, eines der pornographischen Romänchen Diderots für eine emanzipatorische Kampfschrift
gegen die Verschwendung der Leben der hinter Klostermauern sequestrierten Frauen, gegen die unnatürliche und »nutzlose Tugend« des Zölibats, gegen unterdrückte Leidenschaft und kirchliches Dogma
halten zu sollen. Diderot hätte mit der Leidenschaft der von ihm imaginierten Nonnen sicherlich besseres anzufangen gewusst.
Auch geistesgeschichtlich bleibt Bloms Darstellung naiv: So scheint ihm jeglicher Sinn dafür zu fehlen, dass die im 18. Jahrhundert zum paradigmatischen Referenzbegriff werdende Natur nur eine Metapher mehr ist, aus der die sich emanzipierende bürgerliche Kultur ihre Berechtigung, ja, Überlegenheit abzuleiten versucht. Es handelt sich bei der Natur des 18. und frühen 19. Jahrhunderts eben nicht um einen objektiven Gegenstand empirischer Forschung, sondern um ein inhaltlich höchst flexibles metaphysisches Konzept, das dazu dient, das propagierte neue Menschenbild als unverfälscht und echt auszuzeichnen. In diesem Sinne hätte auch der Terminus Naturwissenschaft bzw. Wissenschaft historisch eingeordnet werden müssen, anstatt stillschweigend so zu tun, als bestehe zwischen unserem Konzept empirischer Forschung und dem des 18. Jahrhunderts eine ungebrochene Kontinuität.
Und nicht zuletzt muss Blom darin widersprochen werden, das Erbe dessen, was er radikale Aufklärung nennt, sei vergessen worden. Das eben ist es nicht, sondern es ist im Prozess der historischen Entwicklung zur Moderne aufgehoben worden. Dass es in seiner kompromisslosen Idealität und Radikalität für die heraufziehende bürgerliche Gesellschaft unbrauchbar war, erkennt sogar Blom an. Und der Glaube, dass die von Blom angepriesene Ethik der Lust praktisch überhaupt geeignet sei, eine funktionierende Gesellschaft zu begründen, setzt ein so illusionäres Menschenbild voraus, dass selbst Blom an jenen Stellen Bedenken zu hegen scheint, an denen sich seine radikalen Aufklärer in allzumenschliche Affären und Streitigkeiten verwickeln.
So bleibt Bloms Darstellung bei aller Detailkenntnis leider polemisch und geschmäcklerisch und kann außer für jene, die darin bestätigt finden wollen, was sie ohnehin schon immer denken, nicht empfohlen werden.
Philipp Blom: Böse Philosophen. Ein Salon in Paris und das vergessene Erbe der Aufklärung. München: Hanser, 2011. Pappband, Lesebändchen, 400 Seiten. 24,90 €.