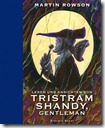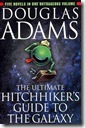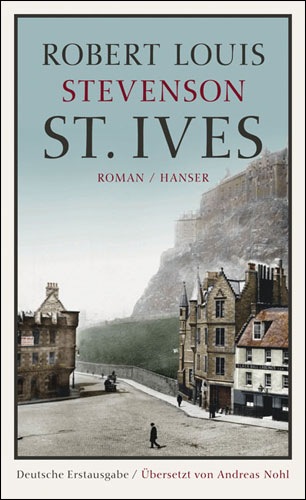… durch Frankreich und Italien. Von Mr. Yorick
… durch Frankreich und Italien. Von Mr. Yorick
Ganz selten hat man heute noch das Vergnügen, ein solches Büchlein in die Hand zu bekommen: Flexibler, bedruckter Leineneinband, abgerundete Ecken, Lesebändchen, exquisite Typographie, eine exzellente Übersetzung, solide Anmerkungen, ein informatives, illustriertes Nachwort. Wenn das Bändchen auch noch fadengeheftet wäre, wäre es vollkommen.
Michael Walter hat seiner ambitionierten Übersetzung des »Tristram Shandy« nun auch eine Übertragung von Sternes zweitem Roman an die Seite gestellt. Leider sind von der »Empfindsamen Reise« nur zwei Bände fertig geworden, bevor Sterne 1768 starb. Und so bleibt der empfindsame Ich-Erzähler Yorick, den der Leser bereits aus dem »Tristram Shandy« kennen konnte, nördlich von Lyon in einem Gasthaus stecken und erreicht nie das im Titel angekündigte Italien.
Das Büchlein war ein beinahe noch größerer Erfolg als der »Tristram Shandy« und besonders in Deutschland einflussreich, da von ihm eine kleine Literaturepoche, die Empfindsamkeit, angeregt wurde. Das Wörtchen »empfindsam« wurde übrigens von Lessing zur Übersetzung des englischen Neologismus »sentimental« erfunden; wer mehr dazu und zu der Geschichte der deutschen Übersetzungen erfahren möchte, lese das wohlgeratene Nachwort.
Auch bei dieser Sterne-Übersetzung wird betont, die Waltersche Neuübersetzung mache die erotische Unterfütterung des Textes deutlicher als alle vorangehenden. Das soll hier nicht bestritten werden, nur möchte ich darauf hinweisen, dass der Autor die sexuellen Beiklänge hier weit gemäßigter gehandhabt hat als in einigen Passagen des »Tristram Shandy«. An dieser Neuübersetzung scheint mir weit interessanter zu sein, wie souverän Michael Walter den Sterneschen Stil insgesamt nachzubilden versteht und dabei einen skurrilen und durch und durch originellen deutschen Text erschafft, der in keinem Moment vergessen lässt, dass wir hier ein Buch vor uns haben, das bereits im 18. Jahrhundert aus der Masse des literarischen Marktes herausgeragt hat.
Wer zuvor noch nichts von Sterne gelesen hat, sei ein wenig vorgewarnt: Es braucht einige Seiten, bis man sich eingelesen hat. Man bringe etwas Geduld mit, denn man wird reichlich dafür belohnt.
Dieses Bändchen ist sicherlich eines der Bücher des Jahres 2010, auch wenn das Jahr noch recht jung ist.
Laurence Sterne: Eine empfindsame Reise durch Frankreich und Italien. Von Mr. Yorick. Neu aus dem Englischen übersetzt von Michael Walter. Berlin: Galiani, 2010. Flexibler, bedruckter Leinenband, Lesebändchen, 359 Seiten. 24,95 €.
 An den Haaren herbeigezogene Schauergeschichte von einem englischen Pärchen, das in Venedig (dessen Name an keiner Stelle fällt) einem psychopathischen Ehepaar in die Hände fällt. Wie für das Genre wohl üblich, passiert lange Zeit nichts, wohl um Spannung zu erzeugen (huuuuu). Antrieb für den ganzen Unfug ist natürlich Sex (oooooh), McEwan bleibt mit diesem dünnen Fähnchen aber so weit hinter etwa Arthur Schnitzlers »Traumnovelle« zurück, dass zumindest ich mit dem Kopfschütteln gar nicht mehr aufhören konnte. Wenigstens ist der Text kurz.
An den Haaren herbeigezogene Schauergeschichte von einem englischen Pärchen, das in Venedig (dessen Name an keiner Stelle fällt) einem psychopathischen Ehepaar in die Hände fällt. Wie für das Genre wohl üblich, passiert lange Zeit nichts, wohl um Spannung zu erzeugen (huuuuu). Antrieb für den ganzen Unfug ist natürlich Sex (oooooh), McEwan bleibt mit diesem dünnen Fähnchen aber so weit hinter etwa Arthur Schnitzlers »Traumnovelle« zurück, dass zumindest ich mit dem Kopfschütteln gar nicht mehr aufhören konnte. Wenigstens ist der Text kurz.