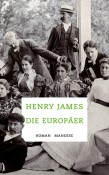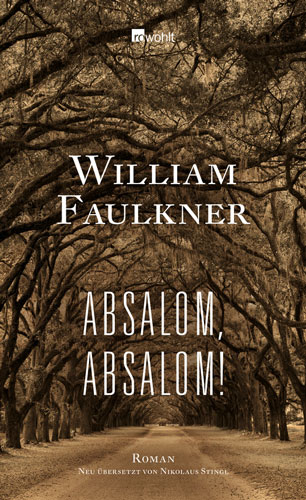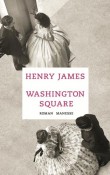Gebt mir Freiheit, sprach Patrick Henry und setze am 1. Mai seinen Strohhut auf, oder gebt mir den Tod. Den hat er dann ja gekriegt.
 Bei „Manhattan Transfer“ (1925) handelt es sich um einen der frühen, großen Romane, die unter dem unmittelbaren Einfluss des Joyceschen „Ulysses“ (1922) entstanden sind. Daraus ergibt sich sein Status als einer der Gründungstexte der US-amerikanischen Moderne. „Manhattan Transfer“ hat sich für einen anspruchsvollen Avantgarde-Roman außergewöhnlich gut verkauft, was auch erklärt, dass er bereits zwei Jahre nach seinem Erscheinen auf Deutsch vorlag – auch Georg Goyerts Übersetzung des „Ulysses“ erschien übrigens im Jahr 1927.
Bei „Manhattan Transfer“ (1925) handelt es sich um einen der frühen, großen Romane, die unter dem unmittelbaren Einfluss des Joyceschen „Ulysses“ (1922) entstanden sind. Daraus ergibt sich sein Status als einer der Gründungstexte der US-amerikanischen Moderne. „Manhattan Transfer“ hat sich für einen anspruchsvollen Avantgarde-Roman außergewöhnlich gut verkauft, was auch erklärt, dass er bereits zwei Jahre nach seinem Erscheinen auf Deutsch vorlag – auch Georg Goyerts Übersetzung des „Ulysses“ erschien übrigens im Jahr 1927.
Nun haben solche raschen Übersetzungen einerseits den Vorteil, dass sie die deutsche Leserschaft darüber auf dem Laufenden halten, was jenseits der Grenzzäune so getrieben wird, andererseits stellen sie an den Übersetzer hohe Ansprüche, denn nicht nur muss er gerade erst im Entstehen begriffene formale Entwicklungen in seiner Sprache nachbilden, sondern er sieht sich auch oft mit der Schwierigkeit konfrontiert, dass er sprachliche Slang-, Alltags- oder Mode-Wendungen nirgends nachschlagen kann und sich aufs Raten oder – wie Baudisch – aufs Weglassen verlegen muss. Andere Produktionshemmnisse mögen hinzugetreten sein.
Wie dem auch immer gewesen sein mag, es kann nur festgestellt werden, dass die Übersetzung von Paul Baudisch, die bislang „Manhattan Transfer“ im Deutschen vertreten musste, ihren Lesern nur ansatzweise einen Eindruck von der Qualität des Originals vermitteln konnte – und das ist noch freundlich formuliert. Schon Kurt Tucholsky fasste 1931 seinen Eindruck von Paul Baudischs Übersetzungen in dem Satz zusammen: „Merkwürdig, aus welchen Händen unsre Übersetzungen kommen!“
Es ist daher nicht nur sehr löblich, sondern es war auch dringend nötig, dass Rowohlt diesen Text hat neu übersetzen lassen. Von Dirk van Gunsteren, der seine Kunst als Übersetzer auch schon an Thomas Pynchon, Philip Roth und T. C. Boyle unter Beweis gestellt hat, liegt nun eine sehr gut lesbare Neuübersetzung vor, von der ich insgesamt den Eindruck habe, dass sie sich auf der Höhe des Originals bewegt. Auch van Gunsteren trifft einige befremdliche Entscheidungen – so lässt er zum Beispiel in den meisten Fällen eine dialektale, soziale oder umgangssprachliche Einfärbung der Dialoge einfach weg und verflacht auf diese Weise den Text –, aber der Gesamteindruck seiner Übersetzung ist der Baudischs so weit überlegen, dass sich ein ernsthafter Vergleich verbietet.
Erzählt wird die Geschichte von ungefähr drei oder vier Hauptfiguren, die in der Hauptsache von 1904 bis in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts verfolgt werden: Ellen, später Elaine und noch später Helena Thatcher, Tochter eines Buchhalters, die früh ihre Mutter verloren hat, wird Schauspielerin, heiratet einen ungeliebten Kollegen, verliebt sich in einen jugendlichen Säufer, dann in einen Journalisten, den sie im Ersten Weltkrieg lieben lernt, und endet als unglückliche Ehefrau eines Staatsanwalts. Jimmy Herf stammt aus besseren Verhältnissen, wird aber früh Waise und schlägt sich als Reporter durch. Er lernt Ellen durch eine ihrer Kolleginnen kennen, verliebt sich in sie, kommt ihr aber erst während des Krieges in Europa näher und kehrt 1918 mit ihr als Ehefrau und mit einem kleinen Sohn nach New York zurück. Jimmy ist der einzige, dem es am Ende des Romans gelingt, aus dem Dunstkreis New Yorks und damit vielleicht auch seinem Unglück zu entkommen. George Baldwin ist ein aufstrebender, junger Anwalt mit einer Schwäche fürs schöne Geschlecht. Er macht berufliche Karriere, endet als Bezirksstaatsanwalt und potenzieller Kandidat für das Amt des Bürgermeisters. Auch er verliebt sich leidenschaftlich in Ellen, verliert zwischenzeitlich sogar einmal die Kontrolle über seine Gefühle so weit, dass er versucht sie zu erschießen, und endet, entgegen jeder Wahrscheinlichkeit aber mit Notwendigkeit als ihr letzter, unglücklicher Ehemann. Stanwood Emery ist ein junger, reicher Taugenichts und Ellens große und wahrscheinlich einzige Liebe. Stan ist ein notorischer Säufer, heiratet im Suff versehentlich die falsche Frau und kommt bei einem von ihm selbst verursachten Brand ums Leben.
Um diese Hauptfabel herum entwickelt Dos Passos ein reiches Panorama von Figuren und Geschichten: Bud Korpenning flieht als Mörder vom Land in die Stadt, fristet dort sein Dasein als Tagelöhner und Bettler und springt von einer der Brücken New Yorks in den Tod. Joe Harland war einst der König der Wall Street, hat sich verspekuliert und versäuft sein restliches Leben. James Merivale, ein Cousin Jimmy Herfs, ist ein opportunistischer Schwachkopf, kommt als Kriegsheld aus dem Ersten Weltkrieg und wird ein erfolgreicher Banker, der seine Schwester an einen Hochstapler verheiratet. Congo Jake ist ein französischer Matrose und Barkeeper, der als Alkoholschmuggler reich wird. John Oglethorpe (Ellens erster Ehemann), Ruth Prynne, Nevada Jones und Tony Hunter sind Schauspieler, die nie so recht den Durchbruch schaffen. Gus McNiel und seine Frau Nellie haben Glück im Unglück und machen aus einem Beinbruch eine Karriere. Joey O’Keefe ist ein Spitzel, der sich später für die Veteranen des Krieges engagiert. Dutch Robertson ist einer dieser Veteranen und macht Karriere als Räuber. Anna Cohen ist eine lebenslustige Jüdin, die gern tanzt und sich als Näherin durchschlägt; auch ihr Leben ist letztlich schicksalhaft mit dem Ellens verbandelt. Rosie und Jake Silverman sind ein Betrügerpärchen, dem kein Erfolg beschieden ist. Man könnte diese Aufzählung problemlos weiter treiben.
Alle diese Geschichten, Kleinsterzählungen und Anekdoten werden in kurzen Abschnitten – von einer halben Seite bis zu einigen Seiten Länge – vorangetrieben, die einander nach einem nur scheinbar zufälligen Muster ablösen. Dazwischen finden sich immer wieder rein impressionistische Abschnitte, aber auch kurze Blitzlichter der sozialen und politischen Verhältnisse New Yorks im frühen 20. Jahrhundert. Das korrupte Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften wird thematisiert, das Elend der Arbeitslosen, die Not der ungewollt Schwangeren, die Abschiebung politisch Unerwünschter, all dies und vieles mehr kommt oft nur wie nebenbei, aber dennoch unübersehbar in dem Gesamtbild vor, das der Roman zeichnet.
Der Roman ist mit seinem inhaltlichen und motivischen Reichtum sowie seiner musivischen Form eines der wichtigen Vorbilder für die Entwicklung des Romans im 20. Jahrhundert. Es ist sehr erfreulich, dass dieses wichtige, historische Musterbuch für deutsche Leser endlich in einer angemessenen Übersetzung vorliegt. Jeder und jedem, die an der Entwicklung der literarischen Moderne interessiert sind, sei die Lektüre dieser Neuübersetzung dringend empfohlen.
John Dos Passos: Manhattan Transfer. Aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren. Reinbek: Rowohlt, 2016. Pappband, Lesebändchen, 540 Seiten. 24,95 €.