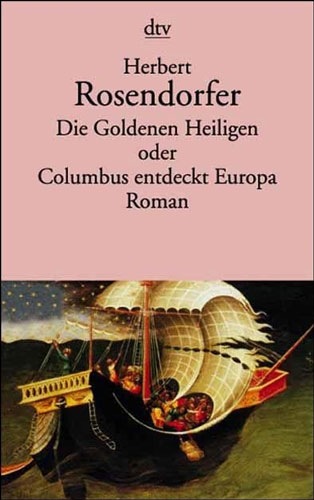Am besten an der Anwendung zu kennen.
Sind ihrer Manche, die vielerlei Reguln und Richtschnuren fertigen, wie der Dichter es solle machen, wenn er dichtet. Sind ihrer aber eben so Wenige, die das Ding mit den Richtschnuren recht inne haben, als klein guter Dichter Zahl ist. Da setzen sich nun die Regulgeber hin, und meinen’s auszugrübeln, was da Natur sey, und kennen doch keine Erfahrung; und ertappen sie ja ’mal was, das nach Natur aussieht, so können sie doch nicht damit umgehn, stellen’s schief hin, werfen’s durch ’nander, und wenn’s nun gar recht zu dem geht, worauf’s allein ankommt, so wissen sie vollends weder aus noch ein. Da sieht man’s wenn sie sich selbst was unterfangen, und mit ihrem Schifflein aufs weite Meer hinausfahren, da bleiben sie auf allen Sandbänken sitzen, und ist kein Fels wo, auf den sie nicht stoßen.
Friedrich Gottlieb Klopstock
Die deutsche Gelehrtenrepublik
Werner Kilian: Adenauers Reise nach Moskau
 Sehr detaillierte Darstellung der Reise Konrad Adenauers nach Moskau im September 1955 einschließlich der Vorgeschichte beginnend mit der sowjetischen Einladung vom 7. Juni des Jahres bis hin zu den ersten Monaten der diplomatischen Beziehungen, die als Folge der Reise etabliert wurden. Kilian konzentriert sich nahezu vollständig auf die politische Ebene der Reise inklusive der Einschätzungen und Reaktionen der drei westlichen Siegermächte. Er macht Adenauers innen- und außenpolitische Taktik und seine Verhandlungsführung in Moskau plausibel durch die unterschiedlichen Erwartungshaltungen und Zielvorstellungen, die er gleichzeitig zu erfüllen suchte: Klärung der Frage der verbliebenen Kriegsgefangenen sowie der Zivilverschleppten, Demonstration der Bündnistreue dem Westen gegenüber, Demonstration einer eigenständigen deutschen, weltpolitischen Position, Durchsetzung seiner Auffassung, dass die Frage der deutschen Einheit Aufgabe der vier Siegermächte sei und letztlich Vermeidung auch nur des Anscheins der Aufgabe des Alleinvertretungsanspruchs der BRD.
Sehr detaillierte Darstellung der Reise Konrad Adenauers nach Moskau im September 1955 einschließlich der Vorgeschichte beginnend mit der sowjetischen Einladung vom 7. Juni des Jahres bis hin zu den ersten Monaten der diplomatischen Beziehungen, die als Folge der Reise etabliert wurden. Kilian konzentriert sich nahezu vollständig auf die politische Ebene der Reise inklusive der Einschätzungen und Reaktionen der drei westlichen Siegermächte. Er macht Adenauers innen- und außenpolitische Taktik und seine Verhandlungsführung in Moskau plausibel durch die unterschiedlichen Erwartungshaltungen und Zielvorstellungen, die er gleichzeitig zu erfüllen suchte: Klärung der Frage der verbliebenen Kriegsgefangenen sowie der Zivilverschleppten, Demonstration der Bündnistreue dem Westen gegenüber, Demonstration einer eigenständigen deutschen, weltpolitischen Position, Durchsetzung seiner Auffassung, dass die Frage der deutschen Einheit Aufgabe der vier Siegermächte sei und letztlich Vermeidung auch nur des Anscheins der Aufgabe des Alleinvertretungsanspruchs der BRD.
Es wird in der Konsequenz klar, dass man Adenauers Reise je nach Perspektive durchaus als Erfolg oder Niederlage werten kann: Sicherlich war sie einerseits innenpolitisch ein unerwartet großer Erfolg, der sich markant im Wahlergebnis von 1957 niedergeschlagen hat, andererseits hatte man in Moskau nur ein einziges Verhandlungsziel überhaupt erreicht – die Gefangenenentlassung, von der wir heute wissen, dass die Sowjetführung sie ohnehin auf der Agenda stehen hatte – und musste dafür im Gegenzug der sowjetischen Seite die Aufnahme normaler diplomatischer Beziehungen einräumen. Damit hatten die Gegenseite ihr einziges Verhandlungsziel vollständig erreicht.
Was bei Kilian etwas zu kurz kommt, ist die gesellschaftliche Ebene, sowohl was die Voraussetzungen der Reise angeht, als auch die euphorische Reaktion der Westdeutschen auf das Eintreffen der letzten 10.000 Kriegsgefangenen. Besonders die doch sehr unterschiedliche Behandlung der Kriegsheimkehrer in West- und Ostdeutschland hätte man sich etwas ausführlicher dargestellt gewünscht. Aber man kann nicht alles haben.
Mir persönlich ist die Darstellung an einigen Stellen zu Adenauer-freundlich, insgesamt steht das Buch aber völlig konkurrenzlos da und muss derzeit als beste Informationsquelle zu diesem wichtigen Abschnitt deutscher Geschichte bezeichnet werden.
Werner Kilian: Adenauers Reise nach Moskau. Freiburg i.B.: Herder, 2005. Broschur, 381 Seiten. 15,– €.
Peter Rüedi: Dürrenmatt
In einer beispiellosen autobiographisch-erzählerisch-essayistischen Mischform, einer Art Ruinenbaumeisterei, stößt er zu einer neuen, multiperspektivischen Form von Literatur vor und entkommt mit ihr selbst dem Scheitern, indem er es akzeptiert.
 Die Auseinandersetzung mit Friedrich Dürrenmatts Werk ist heute alles andere als simpel. Sie scheint gespannt zu sein zwischen zwei Polen: Einerseits ist ein Teil seines Werks offenbar obsolet geworden: »Die Physiker« etwa hat sich thematisch überlebt und ist dramaturgisch zu geradlinig, um außerhalb der Schullektüre noch Spannung zu erzeugen. Das Thema der christlichen Stücke – »Die Wiedertäufer«, »Der Blinde« oder »Ein Engel kommt nach Babylon« – ist zumindest in Europa sehr an den Rand der öffentlichen Diskussion geraten. Anderseits erscheint ein anderer, größerer Teil des Werks vielen Lesern nicht zu Unrecht esoterisch, philosophisch und schwer zugänglich. Einzig die Kriminalromane dürften sich noch einiger, ungebrochener Beliebtheit erfreuen. Dementsprechend dünn fällt die essayistische und germanistische Beschäftigung mit Dürrenmatt aus.
Die Auseinandersetzung mit Friedrich Dürrenmatts Werk ist heute alles andere als simpel. Sie scheint gespannt zu sein zwischen zwei Polen: Einerseits ist ein Teil seines Werks offenbar obsolet geworden: »Die Physiker« etwa hat sich thematisch überlebt und ist dramaturgisch zu geradlinig, um außerhalb der Schullektüre noch Spannung zu erzeugen. Das Thema der christlichen Stücke – »Die Wiedertäufer«, »Der Blinde« oder »Ein Engel kommt nach Babylon« – ist zumindest in Europa sehr an den Rand der öffentlichen Diskussion geraten. Anderseits erscheint ein anderer, größerer Teil des Werks vielen Lesern nicht zu Unrecht esoterisch, philosophisch und schwer zugänglich. Einzig die Kriminalromane dürften sich noch einiger, ungebrochener Beliebtheit erfreuen. Dementsprechend dünn fällt die essayistische und germanistische Beschäftigung mit Dürrenmatt aus.
Vor diesem Hintergrund muss Peter Rüedis Buch über Dürrenmatt gelesen werden, das vom Verlag wohl aus Hilflosigkeit mit dem phantasielosen Etikett Biographie gekennzeichnet worden ist, die damit verbundenen Erwartungen aber nur unvollkommen erfüllt. Sicherlich handelt es sich auch um eine – unvollständig bleibende – Biographie, vielmehr ist es aber ein weit ausholender Essay über Dürrenmatts Werk, der in der bisherigen Literatur über den Autor, wenigstens soweit ich sehe, völlig einzig dasteht. Für Rüedis Lektüre der Werke sind zwei Aspekte zentral: Er analysiert das Werk in weiten Teilen als das eines Christen, der sich Zeit seines Lebens mit dem Glauben seines Vaters auseinandergesetzt hat, und er liest Dürrenmatt wesentlich von der Selbstreflexion der späten »Stoffe« her. Während der erste Aspekt in der Literatur zu Dürrenmatt traditionell breit vertreten ist, scheint der zweite, besonders so, wie er bei Rüedi erscheint, die Möglichkeit einer grundsätzlichen Neuentdeckung und -bewertung Dürrenmatts zu eröffnen. Wenn Dürrenmatt als deutschsprachiger Autor überhaupt eine Zukunft – im Sinne eines Klassiker des 20. Jahrhunderts – hat, so wird sie hier begründet. In diesem Sinn ist Rüedis Buch wahrscheinlich der wichtigste Text der überhaupt bislang über Dürrenmatt geschrieben wurde.
Trotz dieser im Gesamturteil überwiegenden positiven Einschätzung sollen die schwerwiegenden Schwächen des Textes nicht unterschlagen werden: Das Buch macht einen durch und durch unfertigen Eindruck. Rüedi scheint nicht die Kraft oder Übersicht gehabt zu haben, die mehr als 730 Textseiten zu irgendeiner Form von Abrundung oder zu einem Abschluss zu bringen. Der biographische Anteil bleibt wesentlich in den 50er Jahren stecken; zwar werden auch die späteren Jahre erwähnt, aber ihre Behandlung bleibt im Gegensatz zu den ersten gut fünfzehn Nachkriegsjahren flüchtig und oberflächlich, fast als handele es sich um den ersten Teil einer deutlich umfangreicher konzipierten Biographie, die dann unter dem Druck der Ökonomie oder auch der Zeit gewaltsam zu einem Ende gebracht wurde.
Auch beim essayistischen Gehalt bleiben wesentliche Desiderate: Bestimmte Stücke werden gar nicht oder nur marginal behandelt, so etwa »Frank der Fünfte«, zu dem nur das Schlagwort Shakespeare fällt, oder das wichtige, späte »Achterloo«, mit dem Dürrenmatt entgegen seinen Plänen doch noch einmal zur Bühne zurückkehrt und die Irrenhaus-Metapher, die sich durch das gesamte Werk zieht, einmal mehr durchspielt. Was die Dramaturgie angeht, ist es schade, dass »Das Sterben der Pythia« offenbar unterschätzt wird. In diesem einen Stück hätte Rüedi viele wichtige Themen, Motive und Vorbilder der Dürrenmattschen Dramaturgie beieinander gehabt: Shakespeare, Wedekind und Brecht, die Gegenbildlichkeit von Tragödie und Komödie, die Dramaturgien vom Stoff und von der Idee her, sie alle lassen sich an diesem kurzen Stück Prosa exemplarisch vorführen und analysieren.
Was vollständig fehlt, ist ein literarhistorischer Horizont: Zwar gibt es Auseinandersetzungen mit Frisch – dessen schwieriges Verhältnis mit Dürrenmatt Rüedi bereits an anderer Stelle ausführlich gewürdigt hat – und Brecht, aber es findet sich auch nicht der kleinste Ansatz, Dürrenmatt in den Kanon der europäischen Literatur des 20. Jahrhunderts einzuordnen. Nirgends wird zum Beispiel »Der Tunnels« mit den Romanen des französischen Existenzialismus in Beziehung gesetzt, obwohl hier wie dort die Wirkung Kierkegaards und Nietzsches mit Händen zu greifen ist. Nirgends werden Dürrenmatts Stücke in der Geschichte des deutschen oder gar des europäischen Dramas (Sartre, Ionesco, Beckett) verortet. Auch die sehr spezifische Sprache der Bühnenfiguren Dürrenmatts, ihr verknapptes,karges, emotionales und zugleich distanziertes Sprechen wird nur an einer Stelle kurz erwähnt, der Versuch einer Analyse unterbleibt aber. Das alles mag vielleicht verzeihlich erscheinen, da Rüedi offensichtlich ohnehin zu viel für die ihm zur Verfügung stehenden Seiten zu sagen hatte, ein Mangel bleibt es dennoch.
Doch auch entgegen allen Einwänden ist zu betonen, dass dies wahrscheinlich das Wichtigste Buch über Dürrenmatt ist, das bislang erschienen ist, und es steht zu befürchten, dass dies auch lange so bleiben wird. Ein Muss für jeden, der sich ernsthaft mit der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts auseinandersetzt.
Peter Rüedi: Dürrenmatt oder Die Ahnung vom Ganzen. Zürich: Diogenes, 2011. Leinen, Fadenheftung, zwei Lesebändchen, 960 Seiten. 28,90 €.
Allen Lesern ins Stammbuch (49)
Aber nun gar die Schaar der Dilettanten! Wie wenig Sinn und Liebe für die Sache, wie erschreckend der Mangel alles Verständnisses, wie so ganz abhängig von gemachter Mode und prunkendem Schein, – und doch dieser dilettantische Andrang zu den Künsten und Wissenschaften! Das Räthsel löst sich so: nicht um ihrer selbst willen werden die Künste gesucht, sondern als bunter Flittertand, um seine liebe Person damit auszuputzen. Die ebenso unverständigen Beurtheiler sind über den Putz entzückt, wenn ihnen die Person gefällt und verachten ihn, wenn sie keinen sonstigen Grund haben, der Person zu schmeicheln.
Eduard von Hartmann
Philosophie des Unbewußten
Padgett Powell: Roman in Fragen
Sollte ich weggehen? Sie in Frieden lassen? Sollte ich mit meinen Fragen nur mich selbst behelligen?
 Handelt es sich bei dieser mehr als 180 Seiten langen Ansammlung unzusammenhängender Fragen tatsächlich um einen Roman? Ist ein Roman nicht ein Werk der erzählenden Literatur? Wäre es nicht besser gewesen, die Übersetzung des Originaltitels »The Interrogative Mood. A Novel?« zu benutzen? Ist ein Konzept, das auf zehn, vielleicht auch auf zwanzig Seiten witzig ist, auf mehr als 180 Seiten nicht nur noch eine Frage der Ausdauer oder eine Manie? Warum mit 180 Seiten aufhören? Sind dem Autor die Fragen ausgegangen, oder hat ein Controller des Verlages das Buch auf die am Markt am besten zu platzierenden Länge zusammengekürzt?
Handelt es sich bei dieser mehr als 180 Seiten langen Ansammlung unzusammenhängender Fragen tatsächlich um einen Roman? Ist ein Roman nicht ein Werk der erzählenden Literatur? Wäre es nicht besser gewesen, die Übersetzung des Originaltitels »The Interrogative Mood. A Novel?« zu benutzen? Ist ein Konzept, das auf zehn, vielleicht auch auf zwanzig Seiten witzig ist, auf mehr als 180 Seiten nicht nur noch eine Frage der Ausdauer oder eine Manie? Warum mit 180 Seiten aufhören? Sind dem Autor die Fragen ausgegangen, oder hat ein Controller des Verlages das Buch auf die am Markt am besten zu platzierenden Länge zusammengekürzt?
Glauben Autor, Übersetzer und Verlag tatsächlich, dass das witzig ist? Schätzen Sie den Humor von Harry Rowohlt? Glauben Sie nicht auch, dass sich seine Wortspielchen beliebig reproduzieren lassen und seine Gedankenströme eher seichter Natur sind? Ist seine Selbst-Identifikation mit Winnie-the-Pooh nicht vielleicht nur ironisch gemeint? Könnte es sein, dass gerade Sie deshalb dieses Buch schätzen würden, während ich es nach zwanzig Seiten gähnend langweilig fand? Braucht man tatsächlich irgend wofür ein »kindliches Gemüt«? Und besitzt man eines, wenn man es ständig vor sich her trägt? Sollte man als Leser seine wenige und wertvolle Lesezeit nicht besser auf etwas weniger Beliebiges verwenden?
Heißt der Autor des Buches Padgett Powell? Lautet sein Titel »Roman in Fragen«? Wurde es von Harry Rowohlt aus dem amerikanischen Englisch ins Deutsche übersetzt? Ist es im Jahr 2012 in Berlin im Berlin Verlag erschienen? Handelt es sich um einen Pappband mit Lesebändchen und 191 Seiten? Kostet es 17,90 €?
(Wurde diese Besprechung für
Literaturwelt geschrieben?)
Martin Rowson: Tristram Shandy (deutsch)
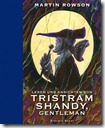 Etwas verspäteter Hinweis auf die kongeniale Umsetzung von Laurence Sternes »Tristram Shandy« als Comic, die hier schon nachdrücklich empfohlen wurde und die im letzten Jahr nun auch auf Deutsch erschienen ist. Die Übersetzung besorgte Michael Walter, der als Übersetzer und Kenner des Romans natürlich eine exzellente Wahl für diese Aufgabe ist. Jedem Sterne-Leser sei der Band dringend ans Herz gelegt.
Etwas verspäteter Hinweis auf die kongeniale Umsetzung von Laurence Sternes »Tristram Shandy« als Comic, die hier schon nachdrücklich empfohlen wurde und die im letzten Jahr nun auch auf Deutsch erschienen ist. Die Übersetzung besorgte Michael Walter, der als Übersetzer und Kenner des Romans natürlich eine exzellente Wahl für diese Aufgabe ist. Jedem Sterne-Leser sei der Band dringend ans Herz gelegt.
Martin Rowson: Leben und Ansichten von Tristram Shandy, Gentleman. Nach Laurence Sterne. Aus dem Englischen von Michael Walter. München: Knesebeck, 2011. Leinenrücken, Fadenheftung, Lesebändchen, 176 unpaginierte Seiten. 24,95 €.
Aloys Winterling: Caligula
Der römischen Aristokratie müssen unter seiner Herrschaft so ungeheuerliche Dinge zugestoßen sein, daß man ihm posthum die höchste denkbare Stigmatisierung zuteil werden ließ: Er wurde als Monster und Wahnsinniger beschimpft und damit gleichsam aus der menschlichen Gesellschaft ausgestoßen.
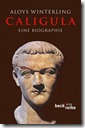 Caligula (12–41) ist einer der bekanntesten römischen Kaiser, da er spätestens seit dem Ende des 19. Jahrhunderts als Musterbeispiel für den größenwahnsinnigen und psychopathischen Diktator dient. Winterlings Darstellung Caligulas widerspricht diesem Bild des Kaisers diametral: Aufgrund einer differenzierten und kritischen Lesart der antiken Quellen erscheint der Kaiser bei ihm als ein rational handelnder Monarch, der nach mehreren Versuchen, ihn zu beseitigen, den stillschweigenden Konsens zwischen Herrscher und Senat, den sein Urgroßvater Augustus etabliert hatte, aufkündigte und versuchte, eine echte Alleinherrschaft zu etablieren. Offensichtlich gelang es ihm aber nicht, in kurzer Zeit ein neues Gleichgewicht und eine den angestrebten Verhältnissen angemessene Kommunikation zu begründen, sondern nutzte die Doppelbödigkeit des früheren Missverhältnisses dazu, die römischen Oberschicht zu demütigen und in Angst und Schrecken zu versetzen. Konsequenterweise führte dies nur zu weiteren Intrigen gegen ihn, von denen eine ziemlich bald durchschlug.
Caligula (12–41) ist einer der bekanntesten römischen Kaiser, da er spätestens seit dem Ende des 19. Jahrhunderts als Musterbeispiel für den größenwahnsinnigen und psychopathischen Diktator dient. Winterlings Darstellung Caligulas widerspricht diesem Bild des Kaisers diametral: Aufgrund einer differenzierten und kritischen Lesart der antiken Quellen erscheint der Kaiser bei ihm als ein rational handelnder Monarch, der nach mehreren Versuchen, ihn zu beseitigen, den stillschweigenden Konsens zwischen Herrscher und Senat, den sein Urgroßvater Augustus etabliert hatte, aufkündigte und versuchte, eine echte Alleinherrschaft zu etablieren. Offensichtlich gelang es ihm aber nicht, in kurzer Zeit ein neues Gleichgewicht und eine den angestrebten Verhältnissen angemessene Kommunikation zu begründen, sondern nutzte die Doppelbödigkeit des früheren Missverhältnisses dazu, die römischen Oberschicht zu demütigen und in Angst und Schrecken zu versetzen. Konsequenterweise führte dies nur zu weiteren Intrigen gegen ihn, von denen eine ziemlich bald durchschlug.
Caligulas kurze Herrschaft markiert somit einen Tiefpunkt in der Entwicklung der frühen, römischen Kaiserzeit. Winterling weist aber darauf hin, dass keine der zeitgenössischen Quellen von einem pathologischen Wahnsinn des Kaisers ausgeht. Dort, wo das Wort fällt – etwa bei Seneca –, wird es in dem Sinne gebraucht, wie auch wir heutzutage von Bauwahn oder ähnlichem reden. Erst Sueton scheint das Konzept vom wahnsinnigen Kaiser erfunden und die Quellen entsprechend tendenziös ausgeschlachtet zu haben. Er verfolgte damit augenscheinlich den Zweck, die Rolle der römischen Oberschicht im 1. Jahrhundert zu schönen und so sein und das Renommee seiner Standeskollegen aufzupolieren.
Winterlings Darstellung ist durchweg überzeugend, gut lesbar und auch für den historischen Laien nachvollziehbar. Ein uneingeschränkt zu empfehlendes Buch.
Aloys Winterling: Caligula. Beck’sche Reihe 6035. München: C. H. Beck, 2012. Broschur, 208 Seiten. 14,95 €.
Thomas Mann: Der Zauberberg
»Siehst Du wohl,« sagte Hans Castorp später zu seinem Vetter, »siehst Du wohl, daß es in der Literatur auf die schönen Worte ankommt? Ich habe es gleich gemerkt.«
 Zuletzt habe ich den »Zauberberg« mit großer Begeisterung 1986 während des Studiums gelesen. Während ich zur gleichen Zeit den Glauben an Thomas Mann als bedeutendem deutschen Intellektuellen endgültig durch die Lektüre der »Betrachtungen eines Unpolitischen« verloren habe, hat dieser Roman die Überzeugung verfestigt, dass er einer der besten deutschsprachigen Erzähler war. In den Jahren dazwischen habe ich immer wieder einmal versucht, Mann zu lesen, bin aber damit nie recht fertig geworden: Im »Doktor Faustus« war mir bei der Zweitlektüre der Erzähler nur schwer erträglich, um »Lotte im Weimar« recht zu goutieren verstand ich wohl noch zu wenig von Goethe – da hat sich erst die dritte Lektüre als vergnüglich erwiesen –, der »Joseph« war eindeutig zu geschwätzig für den in weiten Teilen unerheblichen Stoff und an den »Zauberberg« wollte ich dann nicht noch einmal heran, aus Furcht, ihn mir zu verderben. Erst mit dem Erscheinen der Großen kommentierten Frankfurter Ausgabe stellte sich die Lust wieder ein, es erneut zu versuchen.
Zuletzt habe ich den »Zauberberg« mit großer Begeisterung 1986 während des Studiums gelesen. Während ich zur gleichen Zeit den Glauben an Thomas Mann als bedeutendem deutschen Intellektuellen endgültig durch die Lektüre der »Betrachtungen eines Unpolitischen« verloren habe, hat dieser Roman die Überzeugung verfestigt, dass er einer der besten deutschsprachigen Erzähler war. In den Jahren dazwischen habe ich immer wieder einmal versucht, Mann zu lesen, bin aber damit nie recht fertig geworden: Im »Doktor Faustus« war mir bei der Zweitlektüre der Erzähler nur schwer erträglich, um »Lotte im Weimar« recht zu goutieren verstand ich wohl noch zu wenig von Goethe – da hat sich erst die dritte Lektüre als vergnüglich erwiesen –, der »Joseph« war eindeutig zu geschwätzig für den in weiten Teilen unerheblichen Stoff und an den »Zauberberg« wollte ich dann nicht noch einmal heran, aus Furcht, ihn mir zu verderben. Erst mit dem Erscheinen der Großen kommentierten Frankfurter Ausgabe stellte sich die Lust wieder ein, es erneut zu versuchen.
Erzählt wird bekanntlich die Geschichte des jungen Hamburger Ingenieurs Hans Castorp, der auf drei Wochen nach Davos reist, um seinen kranken Vetter Joachim Ziemßen zu besuchen. Im internationalen Kurhotel Berghof angekommen, verliebt er sich in eine wenige Jahre ältere Russin, Clawdia Chauchat, deren Augen ihn an eine alte, homoerotische Liebe aus seiner Schulzeit erinnern. So ist er mehr als glücklich als der Chefarzt Dr. Behrens auch bei ihm eine Lungenerkrankung diagnostiziert, die ihn zwingt, seinen Aufenthalt auf unbestimmte Zeit zu verlängern. Dies motiviert seinen letztlich siebenjährigen Aufenthalt auf dem Berghof, der unter der Hand zu einem Bildungsgang gerät. Erst der Ausbruch des Ersten Weltkriegs spült Castorp zusammen mit vielen anderen Insassen des Hotels wieder ins Flachland, wo der Erzähler seine Spur im Schlachtgetümmel verliert.
Was mich bei der ersten Begegnung mit diesem umfangreichen Buch fasziniert hat, war der Eindruck der erstaunlich ausgewogenen zeitlichen Beherrschtheit des Textes: Die Beschleunigung des Erzähltempos von der ausführlichen Schilderung der ersten Tage, Wochen und Monate bis zu dem unmerklichen Verfließen ganzer Jahre am Ende erschien mir so mühe- und bruchlos gestaltet, dass dieser Eindruck damals beinahe jede andere Wahrnehmung überlagerte. Dies hat sich bei der erneuten Lektüre nicht wieder im gleichen Maße eingestellt. Besonders im letzten Drittel empfand ich dieses Mal manche Passage als überdehnt und manches Motiv als zu breit ausgewalzt. So etwa die Auseinandersetzungen zwischen den beiden um die Menschwerdung Castorps ringenden Dämonen Settembrini und Naphtha, die Parodie auf die Mode der Geisterbeschwörung, die sich zugleich über die Psychoanalyse lustig macht, die Ausführungen zur Musik – das alles könnte auch kürzer und konziser gefasst werden und enthält viel Geschwätz, das einfach nur der Verarbeitung von eben angefallenem Stoff dient und weniger einer tatsächlichen Notwendigkeit des Erzählens entspringt.
Das ist aber nur die eine Seite; auf der anderen muss ich sagen, dass ich das Buch durchaus wieder mit großem Vergnügen gelesen habe. Wem es gelingt, den Text insgesamt als ein Spiel mit Motiven, Strömungen und Tendenzen seiner Zeit wahrzunehmen, der kann all dem mit vergnügter Distanz folgen. Das Verweben sowohl einer Bildungsroman- als auch einer Liebesroman-Parodie, die einander zudem auch noch erzählerisch bedingen, ist sehr fein und ungezwungen ausgeführt. Und nicht zuletzt habe ich auch den Genuss an Manns sprachlichem Manierismus wieder gefunden, der mir zwischenzeitlich verloren gegangen war. Natürlich kann es auch leicht geschehen, dass einem die letztlich gänzlich substanzlose Haltung des Erzählers auf die Nerven geht, aber mir ist es wenigstens diesmal gelungen, dass das Vergnügen an der Lektüre weit überwogen hat. Ich bin gespannt, wie meine Lesegeschichte mit Thomas Mann weitergehen wird …
Thomas Mann: Der Zauberberg. Frankfurt/M.: S. Fischer, 2002. Leinen, Fadenheftung, Lesebändchen, 1103 Seiten. 42,– €. Zusammen mit dem umfangreichen Kommentarband: 84,– €. Der Text der GkFA erscheint im April 2012 erstmals auch im Taschenbuch.
P. S.: Vielleicht doch noch ein paar Worte zum Kommentarband: Mit gut 520 Seiten ist er fast halb so umfangreich wie der Text des Romans. Neben soliden Kapiteln zur Entstehung und Rezeption enthält er einen umfangreichen Einzelstellenkommentar, der in der Hauptsache den ungeheuer umfangreichen stofflichen Resonanzraum des Romans deutlich macht. Hier lassen sich schöne Funde machen, und es wird deutlich, was für ein außergewöhnlicher Organisator großer Stoffmengen Thomas Mann gewesen ist. Für die genießende Lektüre ist der Kommentar durchaus nicht notwendig, aber er hilft sehr beim Entdecken der hinter dem Gobelin verlaufenden Fäden.
Herbert Rosendorfer: Die Goldenen Heiligen oder Columbus entdeckt Europa
Es schwebte ihm eine Lampe vor, die groß, aber gleichzeitig klein, schwarz lackiert, aber nicht dunkel, zart, aber doch stabil, hoch, aber doch eher niedrig wäre.
»Es ist immer angenehm«, sagte Jessica […], »einen Kunden zu haben, der seine eigene Meinung hat.«
Das Buch ist 1992 zum Anlass der (Wieder-)Entdeckung Amerikas vor 500 Jahren erschienen, worauf schon der Titel verweist. Ihm scheint kein sonderlicher Erfolg beschieden gewesen zu sein, da es im Gegensatz zu anderen Titeln Rosendorfs derzeit nicht lieferbar ist. Allerdings scheint man bei dtv eine Neuauflage zu planen.
Das Buch hat zwei deutlich unterschiedene Teile: Während der erste Teil in der Hauptsache eine Satire auf die esoterische Szene der 80-er Jahre enthält, schildert der zweite Teil das Aussterben der Menschheit innerhalb einer menschlichen Lebensspanne, nachdem Außerirdische zuerst in Europa, dann überall auf der Erde gelandet sind. Außer über die Erzählerfigur Menelik Hichter, der an dem Tag der ersten Landung der Außerirdischen geboren wird und das Buch als Erinnerungen des letzten Menschen niederschreibt, werden die beiden Teile in der Hauptsache dadurch verbunden, dass die Mutter Meneliks die Außerirdischen als Goldene Heilige begrüßt und von ihnen die Erlösung erwartet, was wesentlich dazu beiträgt, dass sich ein Widerstand der Menschheit gegen deren Okkupation erst herausbildet, als es bereits zu spät ist.
Doch der Reihe nach: Am 12. Oktober 1992, also genau 500 Jahre nach der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus (so ganz genau ist es natürlich nicht, da zwischen den beiden Daten die Umschaltung vom julianischen auf den gregorianischen Kalender stattgefunden hat; aber wir wollen nicht zu kleinlich sein) landet in der Nähe von Paderborn ein Raumschiff, das allerdings nach einigen Stunden wieder verschwindet, ohne dass ein First Contact stattgefunden hätte. Nur ein Schaf und ein paar zufällig auf der Landestelle hausende Alternative werden in Mitleidenschaft gezogen. Als die breitere Öffentlichkeit den Vorfall schon wieder vergessen hat, landen drei weitere Schiffe, denen wiederum nach beträchtlicher Zeit eine regelrechte Invasionsflotte folgt, die den Planeten systematisch unter Kontrolle bringt. Menschen, die versuchen, sich den Schiffen zu nähern, werden kurzerhand mit einer Strahlenwaffe eliminiert. Das einzige Interesse, dass die Außerirdischen vorerst zeigen, ist das für holländische Holzschuhe, an denen sie einen ebenso unerklärlichen wie gigantischen Bedarf zu haben scheinen.
Da die Besatzung der Erde durch Außerirdische mit den rasant eintretenden Folgen der Klimaveränderung zusammenfällt, gleitet die menschliche Zivilisation zuerst ins Chaos ab, um dann zu mittelalterlichen Zuständen zurückzukehren. Da dies die Produktion von Holzschuhen nicht wesentlich einschränkt – der einzige relevante Wirtschaftszweig, der noch für eine Weile Bestand hat –, stört es die Außerirdischen nicht weiter. Sorgen macht ihnen nur, dass ihnen offenbar eine weitere, feindlich gesinnte Gruppe von Außerirdischen Konkurrenz macht. Da zufällig Lärm als eine tödliche Überempfindlichkeit der Außerirdischen entdeckt wurde, wirbt die eine Gruppierung der Fremden menschliche Hilfstruppen an, die einen Lärmfeldzug gegen die andere führt. Nachdem die gegenseitigen Interessensphären geklärt sind und die Herstellung von Holzschuhen automatisiert worden ist, besteht keine weitere Notwendigkeit zur Erhaltung der Menschheit. Man verwendet sie noch als Jagdobjekt, treibt die Reste dann in einem Reservat zusammen, wo man sie gegen Eintritt zur Besichtigung freigibt. Als die Menschheit beinahe nur noch eine Erinnerung darstellt, entsteht sogar eine anthropologische Forschung der Außerirdischen, die schließlich auch die Niederschrift der Erinnerungen Meneliks veranlasst, aus denen das Buch besteht.
Die Parallelen zur Eroberung Amerikas durch die Europäer sind ebenso offensichtlich wie dick aufgetragen, wodurch die Erzählung in der Länge etwas zu vorhersehbar wird. Die Satire auf die Esoteriker scheint ein wenig aufgesetzt, ist aber erzählerisch notwendig, um die eher ereignislose Zeit des ersten Auftauchens der Außerirdischen anzureichern. Alles in allem schon ein witziges und gelungenes Buch, wenn Rosendorfer auch sicherlich besseres abgeliefert hat.
Herbert Rosendorfer: Die Goldenen Heiligen oder Columbus entdeckt Europa. München: Nymphenburger, 1992. Leinen, 277 Seiten. Derzeit nicht lieferbar.
Allen Lesern ins Stammbuch (48)
»Höchstes Glück der Erdenkinder?« fragte er haßvoll: »Nennen Sie mir einen anständigen Schriftsteller, der gern geschrieben hätte: lieber zeitlebens Scheiße schippen! –: Sind Sie Ihrer Individualität noch nie müde geworden?« Ich senkte den Kopf; ich nickte; es ging ihn zwar nischt an, aber: ja. Täglich etwa zweimal. »Na sehen Sie,« sagte er versöhnt.
Arno Schmidt
Tina oder über die Unsterblichkeit