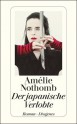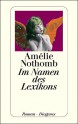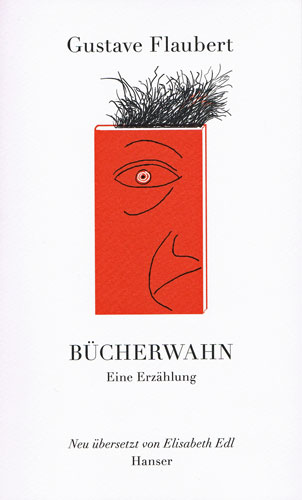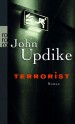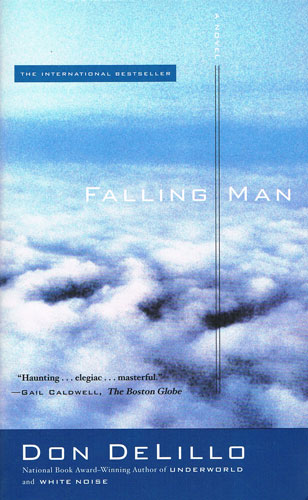»Ach Thilde, was unsereiner auch alles erleben muß. Und das nennen sie dann Fügungen, und man soll sich auch noch bedanken.«
 Fontanes letzter Roman, obwohl er von der Länge her kaum diesen Namen verdient. Fontane ist vor der Endredaktion verstorben, so dass der Text erst 1907 aus dem Nachlass erschienen ist und das zudem in einer starken herausgeberischen Bearbeitung. Erst Ende der 60-er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde erstmals eine sich enger am Manuskript orientierende Edition gedruckt. Das alles bedeutet allerdings nicht, dass es sich um ein Fragment handelt. Man weiß zwar, dass Fontane immer ziemlich lange an seinen Text gefeilt und verändert hat, aber die Fabel ist vollständig aus- und zu Ende erzählt. Sicherlich könnte man spekulieren, dass besonders der in Westpreußen spielende Teil der Fabel noch hätte ausgeweitet werden können, aber wie Fontane gegen Ende deutlich macht, war die Kürze der politischen Karriere der Großmanns beabsichtigt.
Fontanes letzter Roman, obwohl er von der Länge her kaum diesen Namen verdient. Fontane ist vor der Endredaktion verstorben, so dass der Text erst 1907 aus dem Nachlass erschienen ist und das zudem in einer starken herausgeberischen Bearbeitung. Erst Ende der 60-er Jahre des 20. Jahrhunderts wurde erstmals eine sich enger am Manuskript orientierende Edition gedruckt. Das alles bedeutet allerdings nicht, dass es sich um ein Fragment handelt. Man weiß zwar, dass Fontane immer ziemlich lange an seinen Text gefeilt und verändert hat, aber die Fabel ist vollständig aus- und zu Ende erzählt. Sicherlich könnte man spekulieren, dass besonders der in Westpreußen spielende Teil der Fabel noch hätte ausgeweitet werden können, aber wie Fontane gegen Ende deutlich macht, war die Kürze der politischen Karriere der Großmanns beabsichtigt.
Die Titelfigur Mathilde Möhring ist die Tochter eines früh verstorbenen Berliner Exportkaufmanns, die sich zusammen mit ihrer Mutter in kleinbürgerlichen Verhältnissen über Wasser hält, indem sie eines ihrer Zimmer an Studenten vermieten. Als der etwas verbummelte und der schönen Literatur zugeneigte Jura-Student Hugo Großmann bei den Damen Möhring einzieht, wittert Mathilde ihre Chance. Eine Erkrankung Hugos bietet den Anlass zum familiären Anschluss, und der kaum Genesene verlobt sich wie geplant mit Mathilde. Die nimmt daraufhin Hugos Leben in die Hand, treibt ihn systematisch durchs Examen und besorgt ihm anschließend eine Stelle als Bürgermeister in einem Kleinstädtchen in Westpreußen. Dort beginnt sie, mit Hilfe ihres leicht regierbaren Ehemanns erfolgreich Politik zu machen.
Doch natürlich kommt es, wie es kommen muss: Der gesundheitlich empfindliche Hugo erkältet sich gleich beim ersten scharfen Wind und kommt mit einer Lungenentzündung nieder. Zwar erholt er sich noch einmal, aber zu Ostern erleidet er aus heiterem Himmel einen Rückfall und stirbt. Mathilde, nur wenig erschüttert, kehrt zu ihrer Mutter nach Berlin zurück und bessert ihre Witwenpension auf, in dem sie Lehrerin wird.
Von Hugo Großmann wird selten gesprochen, seine Photographie hängt aber mit einer schwarzen Schleife über der Chaiselongue, und zweimal im Jahre kriegt er nach Woldenstein hin einen Kranz. Silberstein legt ihn nieder und schreibt jedesmal ein paar freundliche Zeilen zurück.
Es ist erstaunlich, dass dieser kleine Roman Fontanes nicht viel bekannter ist. Vielleicht liegt es dran, dass der Autor selbst nicht richtig warm geworden ist mit seiner berechnenden, sich kaum je ihren Gefühlen überlassenden Protagonistin. An Mathildes Karriere zeigen sich die Vorurteile, der Standesdünkel und die Enge der preußischen Gesellschaft, ohne dass Mathilde dem Leser dadurch sympathischer wird oder er sich auf sonst einem Wege mit ihr identifizieren kann. Auch jede Tragik verweigert ihr der Autor: Hugos Tod ist zwar bedauerlich, aber nicht das Ende der Welt. Mathilde weiß sich durchzuschlagen und gerät so zu einer Gegenfigur zu Effi Briest, was der Autor durch einige Anspielungen auch deutlich zu machen weiß.
Alles in allem ein kleines Meisterwerk, das ein weiteres, wichtiges Segment in Fontanes Panorama der Rolle der Frau in der preußischen Gesellschaft hinzufügt.
Ich habe hier, da der Hintergrund der Lektüre einmal mehr ein didaktischer ist, aus praktischen Gründen den von Gotthard Erler edierten Text bei dtv zugrunde gelegt, wie er auch in der Hanser-Ausgabe der Werke Fontanes abgedruckt ist. Philologisch orientierten Lesern ist aber natürlich anzuraten, den von Gabrielle Radecke edierten Text in der »Großen Brandenburger Ausgabe« (Bd. 20, Aufbau Verlag, 2008) heranzuziehen, der den Zustand des Fontaneschen Manuskript ungeschönt wiedergibt. Auch ist die Entscheidung des Deutschen Taschenbuch Verlages, die Anmerkungen der Hanser-Ausgabe unbearbeitet zu übernehmen, als eher unglücklich anzusehen, da diese nicht nur an einzelnen Stellen sachlich falsch sind, sondern zum Teil auch auf Kommentare zu anderen Texten innerhalb der Hanser-Ausgabe verweisen, die dem Leser des Taschenbuchs naturgemäß nicht verfügbar sind.
Theodor Fontane: Mathilde Möhring. dtv 13113. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 32005. Broschur, 158 Seiten. 6,50 €.