Das gleiche trifft auf Handkes berühmte Reizwörter zu. Sie bringen jenen Teil des Publikums in Rage, der sich von ihnen in Rage bringen läßt. Dieses Publikum wird nicht über das Reizwort an sich, sondern mit Recht dadurch zornig, weil es das Reizwort von einem Schauspieler auf der Bühne hört. Indem der Schauspieler das Reizwort auf der Bühne spricht, ahmt er einen Provokateur nach, der das Publikum zornig machen will, was ihm erfreulicherweise bei jenem Publikum gelingt, das noch naiv mitgeht – dieses Publikum ist immer noch das dankbarste –, während jenes Publikum, das sich durch die Reizwörter nicht in Rage bringen läßt, sich auch mit Recht nicht in Rage bringen läßt, weil es nicht so naiv ist, zu glauben, die Schauspieler, die es in Rage bringen wollen, seien wirkliche Provokateure. Dieses Publikum müßte, um in Rage zu kommen, jenes Publikum nachahmen, das in Rage kommt, das heißt, die Zuschauer, die nicht in Rage kommen, müssen die Rolle spielen, die ihnen Handke zuschreibt, um in Rage zu kommen; sie müssen die Spießer nachahmen, die sie nicht sind, weil sie nicht in Rage kommen, eine Rolle, die ihnen jedoch nicht liegt, weil sie keine Spießer sein wollen, weshalb sie denn auch klatschen: bei Handke klatschen alle, die nicht Spießer sind oder nicht Spießer sein wollen. Hat sich das einmal herumgesprochen, klatscht alles.
Friedrich Dürrenmatt
Sätze über das Theater
Kategorie: D
Allen Lesern ins Stammbuch (101)
Im Bücherschrank standen die Klassiker. Schiller, Göthe, Wieland, Shakespeare. Die kannte ich ja längst, und sie hatten mir doch nicht geholfen. Ach Gott, ich hatte die Klassiker gelesen, wie früher die Räuberromane, eilfertig, eilfertig, nur das Stoffliche verschlingend.
Im Bücherschrank, in alten, ehrwürdigen Einbänden, standen auch Herder und Lessing. Mit Herder war nichts anzufangen. Schon nach den ersten Seiten schweiften meine Gedanken abseits; für den war ich wohl noch nicht reif. Also Lessing, aber nicht etwa Emilia Galotti oder Minna Barnhelm, nein, etwas Lehrreiches. Der Laokoon, der sollte ja sehr tief und sehr bildend sein. Ich las ihn mit concentrirter Aufmerksamkeit, Satz für Satz, ich machte mir Auszüge. Meine Mutter kam einmal dazu. Ich hätte mich nicht sonderlich gegrämt, wenn sie, wie vor Jahren die Veronika, diesmal den Laokoon conficirt hätte. Ich wagte nicht mir zu gestehen, daß ich ihn langweilig fand. Von Kunst hatte ich nicht den leisesten Schimmer. Ich war noch nicht einmal im Museum gewesen.
Hedwig Dohm:
Schicksale einer Seele
Arthur Conan Doyle: The Complete Sherlock Holmes
Wer was versteckt, der findets auch wieder.
James Joyce
 Ich habe für die zweite vollständige Lektüre der Doyleschen Sherlock-Holmes-Romane und -Erzählungen wohl gute sechs Jahre gebraucht. Es war eines der ersten Bücher, die ich mir für den Kindle gekauft habe, und es war in dieser Zeit mein Vademecum, das immer herhalten musste, wenn unterwegs gerade kein anderes Buch zur Hand war oder ich keine Lust auf anstrengendere Lektüre hatte. Den ersten Durchgang habe ich zu Studienzeiten mit der damals aktuellen Neuausgabe des seligen Haffmans Verlages erledigt, den zweiten nun im englischen Original. Dabei soll betont werden, dass dieser Complete Sherlock Holmes so wie die meisten anderen sogenannten Gesamtausgaben natürlich nicht komplett ist, sondern nur jene Texte enthält, denen die Ehre zuteil wurde, von Doyle selbst in Buchform veröffentlicht zu werden. Für mich und mein Interesse genügte das immer.
Ich habe für die zweite vollständige Lektüre der Doyleschen Sherlock-Holmes-Romane und -Erzählungen wohl gute sechs Jahre gebraucht. Es war eines der ersten Bücher, die ich mir für den Kindle gekauft habe, und es war in dieser Zeit mein Vademecum, das immer herhalten musste, wenn unterwegs gerade kein anderes Buch zur Hand war oder ich keine Lust auf anstrengendere Lektüre hatte. Den ersten Durchgang habe ich zu Studienzeiten mit der damals aktuellen Neuausgabe des seligen Haffmans Verlages erledigt, den zweiten nun im englischen Original. Dabei soll betont werden, dass dieser Complete Sherlock Holmes so wie die meisten anderen sogenannten Gesamtausgaben natürlich nicht komplett ist, sondern nur jene Texte enthält, denen die Ehre zuteil wurde, von Doyle selbst in Buchform veröffentlicht zu werden. Für mich und mein Interesse genügte das immer.
Nun ist Sherlock Holmes im Verlauf des 20. Jahrhunderts deutlich über den Status einer literarischen Figur hinausgewachsen und zu so etwas wie einer kulturellen Ikone geworden. Natürlich ist dieser Prozess nicht ohne Verwerfungen abgelaufen, aber die unzähligen Verwandlungen, Ironisierungen und Neuerfindungen der Figur im Laufe ihrer mehr als hundertjährigen Existenz sind so vielgestaltig, dass sich zwangsläufig die Frage aufdrängt, warum gerade mit ihr eine solche Erfolgsgeschichte geschrieben wurde. An der literarischen Qualität der Texte kann es kaum liegen, denn das immer in ihnen wieder variierte Grundmuster ist sehr eng, die Texte sind sehr offensichtlich von ihrer Auflösung her konstruiert und Holmes’ Scharfsinn daher immer eine Täuschung, auf die nur die naivsten Leser dankbar hereinfallen dürften.
Holmes verkörpert zuerst einmal einen reizvollen und komplexen gesellschaftlichen Außenseiter: Seine unhöfliche Direktheit, seine Arroganz, sein Drogenkonsum bilden die (tolerable) dunkle Seite seines vorgeblichen Genies. Zu seiner intellektuellen Überlegenheit, die sich nicht nur aus seinem ungewöhnlichen Vermögen zum deduktiven Denken, sondern auch aus seiner extrem verfeinerten Beobachtungsgabe besteht, treten seine emotionale Selbstbeherrschung, seine sportliche Fitness, seine Verachtung gesellschaftlicher Konventionen und sein aus all dem resultierendes Einzelgängertum hinzu. Alle diese Aspekte machen die Figur zu einem menschlichen Superhelden, ebenso souverän und überlegen wie verletzlich und leidend – immer eine gute Mischung.
Entscheidend für die Faszination der Figur und ihren Erfolg scheint mir aber noch etwas anderes zu sein: Holmes verkörpert wie kein Zweiter die Illusion, dass sich eine für den alltäglichen Blick undurchschaubar chaotische Welt rational durchdringen und erklären lässt. Holmes weist immer aufs Neue nach, dass sich das irrational oder gar unmöglich erscheinende Material der Welt am Ende doch einer rationalen Ordnung fügt. Insofern ist Holmes der Herakles des aufklärerischen Mythos von der prinzipiellen rationalen Erklärbarkeit der Welt. Und vielleicht ist es gerade die Tatsache, dass dieser Mythos von den Wissenschaften des 20. Jahrhunderts so erfolgreich durch sich selbst dekonstruiert worden ist, die Holmes zu einer Sehnsuchtsfigur nach den guten alten Zeiten des Rationalismus gemacht hat.
Arthur Conan Doyle: The Complete Sherlock Holmes. O.O.: Middleton Classics, 2010. Kindle-Edition, ca. 1560 Seiten. 1,02 €.
Jahresrückblick 2016
Auch für das vergangene Jahr die Höhen und Tiefen der Lektüre in einem kurzen Überblick, wobei ich vorausschicken möchte, dass ich in diesem Jahr keine wirklich durch und durch schlechten Bücher in die Hand bekommen habe. Viel Lesezeit des Jahres war Shakespeare und Jane Austen gewidmet, wobei ich es albern fände, „König Richard III.“ oder „Stolz und Vorurteil“ unter den besten Lektüren aufzulisten. Die beiden laufen daher außer Konkurrenz.
Die drei besten Lektüren des Jahres 2016:
- Giorgio Agamben: Homo sacer – wahrscheinlich die anregendste philosophisch-politische Lektüre seit vielen Jahren! Unbedingt lesenswert.
- John Dos Passos: Manhattan Transfer – eine seit langem fehlende Neuübersetzung, die das Buch zum ersten Mal auf Deutsch erkennbar macht.
- Virginia Woolf: Orlando – auch in diesem Fall erschließt eine Neuübersetzung den Text in seiner sehr feinen formalen und sprachlichen Gearbeitetheit.
Die drei schlechtesten Lektüren des Jahres 2016:
- William Shakespeare: Die Fremden – eine vollständig überflüssige Veröffentlichung, die versucht, aus der Solidarität der Deutschen mit den Flüchtlingen des Jahres 2016 Kapital zu schlagen.
- Michael Krüger: Das Irrenhaus – ein Buch wie aus dem Labor eines Creativ-Writing-Seminars: Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen.
- Alfred Döblin: Die drei Sprünge des Wang-lun – ein Roman, der sich mir überhaupt nicht erschlossen hat. Als historisches Phänomen verständlich, als Romanprojekt zumindest mit komplett unzugänglich.
Alfred Döblin: Die drei Spünge des Wang-lun
 Es passiert einem doch vergleichsweise hartnäckigen und trainierten Leser wie mir selten, dass ich an einem Roman eines Autors, der mich interessiert, vollständig scheitere. Bei „Die drei Sprünge des Wang-lun“ habe ich nach einem Viertel des Romans aufgegeben, noch ein wenig im dritten und vierten Teil gestöbert und das Buch dann zur Seite gelegt mit dem deutlichen Eindruck, dass, was immer nun noch erzählt werden wird, mich einfach nicht interessiert.
Es passiert einem doch vergleichsweise hartnäckigen und trainierten Leser wie mir selten, dass ich an einem Roman eines Autors, der mich interessiert, vollständig scheitere. Bei „Die drei Sprünge des Wang-lun“ habe ich nach einem Viertel des Romans aufgegeben, noch ein wenig im dritten und vierten Teil gestöbert und das Buch dann zur Seite gelegt mit dem deutlichen Eindruck, dass, was immer nun noch erzählt werden wird, mich einfach nicht interessiert.
Dass Unverständnis beginnt schon damit, dass mir in Sekundärtexten gesagt wird, der Roman spiele im China des 18. Jahrhunderts. Das tut er nicht. Der Roman spielt nirgendwo und nirgendwann, in irgendwelchen Städten und Dörfern, Bergen und Tälern, Höhlen und Hütten, die alle vollkommen gesichtslos und einander gleich sind. Seine Charaktere sind flach wie die Hermann Hesses, ihre vorgeblichen Gedanken wuschig wie die Peter Sloterdijks und die Episoden der Handlung so zufällig aufgereiht wie die Lottozahlen. Es mag schon sein, dass das alles zusammen irgendetwas bedeutet, dass die Zahnräder des Romans an irgendeiner Stelle in irgendeine irgendwann existiert habende Wirklichkeit eingegriffen und etwas angetrieben haben, aber falls dem so sein sollte, ist es mir vollständig verschlossen geblieben.
So weit ich es beurteilen kann, wird im Roman die Geschichte Wang-luns erzählt: Sohn eines Fischers, ein wilder und unerzogener Knabe eines eingebildeten Vaters, der zu einem Kerl heranwächst, der stiehlt und sich über andere lustig macht. Dann wird ihm von der Polizei ein Freund erschlagen, er wiederum erwürgt den Polizisten, flieht in die Berge und wird ein frommer Mann. Viele Dummköpfe strömen ihm zu. Er ermordet einen Teil der Dummköpfe. Er geht fort, angeln. Der Kaiser ermordet einen anderen Teil der Dummköpfe. Da wendet sich Wang-lun an der Spitze der verbliebenen Dummköpfe gegen den Kaiser. Und dann lässt er es wieder bleiben. Das alles geschieht vor dem Hintergrund einer chinesisch dekorierten Märchenwelt. Hermann Hesses „Siddharta“ ist ähnlich undeutlich, aber viel, viel kürzer.
Das Buch gehört in die Reihe der China-Bücher vom Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts (Karl May, Elisabeth von Heyking, Klabund, Hans Bethge, Albert Ehrenstein, Bert Brecht), steht aber mit seiner Entstehungszeit 1912/13 relativ früh in dieser Reihe. Es ist für seinen abgehobenen Inhalt erstaunlich gut verkauft und noch vor 1933 ins Dänische und Französische übersetzt worden. Es muss also wohl was dran sein. Nur was, habe ich nicht herausfinden können.
Gelesen habe ich: Alfred Döblin: Die drei Sprünge des Wang-lun. Chinesischer Roman. Olten/Freiburg i.Br.: Walter, 1977. Leinen, Fadenheftung, 502 Seiten.
Lieferbar ist: Dass. Fischer-Tb. 90460. Frankfurt/M.: Fischer, 2013. Broschur, 528 Seiten. 10,99 €.
John Dos Passos: Manhattan Transfer
Gebt mir Freiheit, sprach Patrick Henry und setze am 1. Mai seinen Strohhut auf, oder gebt mir den Tod. Den hat er dann ja gekriegt.
 Bei „Manhattan Transfer“ (1925) handelt es sich um einen der frühen, großen Romane, die unter dem unmittelbaren Einfluss des Joyceschen „Ulysses“ (1922) entstanden sind. Daraus ergibt sich sein Status als einer der Gründungstexte der US-amerikanischen Moderne. „Manhattan Transfer“ hat sich für einen anspruchsvollen Avantgarde-Roman außergewöhnlich gut verkauft, was auch erklärt, dass er bereits zwei Jahre nach seinem Erscheinen auf Deutsch vorlag – auch Georg Goyerts Übersetzung des „Ulysses“ erschien übrigens im Jahr 1927.
Bei „Manhattan Transfer“ (1925) handelt es sich um einen der frühen, großen Romane, die unter dem unmittelbaren Einfluss des Joyceschen „Ulysses“ (1922) entstanden sind. Daraus ergibt sich sein Status als einer der Gründungstexte der US-amerikanischen Moderne. „Manhattan Transfer“ hat sich für einen anspruchsvollen Avantgarde-Roman außergewöhnlich gut verkauft, was auch erklärt, dass er bereits zwei Jahre nach seinem Erscheinen auf Deutsch vorlag – auch Georg Goyerts Übersetzung des „Ulysses“ erschien übrigens im Jahr 1927.
Nun haben solche raschen Übersetzungen einerseits den Vorteil, dass sie die deutsche Leserschaft darüber auf dem Laufenden halten, was jenseits der Grenzzäune so getrieben wird, andererseits stellen sie an den Übersetzer hohe Ansprüche, denn nicht nur muss er gerade erst im Entstehen begriffene formale Entwicklungen in seiner Sprache nachbilden, sondern er sieht sich auch oft mit der Schwierigkeit konfrontiert, dass er sprachliche Slang-, Alltags- oder Mode-Wendungen nirgends nachschlagen kann und sich aufs Raten oder – wie Baudisch – aufs Weglassen verlegen muss. Andere Produktionshemmnisse mögen hinzugetreten sein.
Wie dem auch immer gewesen sein mag, es kann nur festgestellt werden, dass die Übersetzung von Paul Baudisch, die bislang „Manhattan Transfer“ im Deutschen vertreten musste, ihren Lesern nur ansatzweise einen Eindruck von der Qualität des Originals vermitteln konnte – und das ist noch freundlich formuliert. Schon Kurt Tucholsky fasste 1931 seinen Eindruck von Paul Baudischs Übersetzungen in dem Satz zusammen: „Merkwürdig, aus welchen Händen unsre Übersetzungen kommen!“
Es ist daher nicht nur sehr löblich, sondern es war auch dringend nötig, dass Rowohlt diesen Text hat neu übersetzen lassen. Von Dirk van Gunsteren, der seine Kunst als Übersetzer auch schon an Thomas Pynchon, Philip Roth und T. C. Boyle unter Beweis gestellt hat, liegt nun eine sehr gut lesbare Neuübersetzung vor, von der ich insgesamt den Eindruck habe, dass sie sich auf der Höhe des Originals bewegt. Auch van Gunsteren trifft einige befremdliche Entscheidungen – so lässt er zum Beispiel in den meisten Fällen eine dialektale, soziale oder umgangssprachliche Einfärbung der Dialoge einfach weg und verflacht auf diese Weise den Text –, aber der Gesamteindruck seiner Übersetzung ist der Baudischs so weit überlegen, dass sich ein ernsthafter Vergleich verbietet.
Erzählt wird die Geschichte von ungefähr drei oder vier Hauptfiguren, die in der Hauptsache von 1904 bis in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts verfolgt werden: Ellen, später Elaine und noch später Helena Thatcher, Tochter eines Buchhalters, die früh ihre Mutter verloren hat, wird Schauspielerin, heiratet einen ungeliebten Kollegen, verliebt sich in einen jugendlichen Säufer, dann in einen Journalisten, den sie im Ersten Weltkrieg lieben lernt, und endet als unglückliche Ehefrau eines Staatsanwalts. Jimmy Herf stammt aus besseren Verhältnissen, wird aber früh Waise und schlägt sich als Reporter durch. Er lernt Ellen durch eine ihrer Kolleginnen kennen, verliebt sich in sie, kommt ihr aber erst während des Krieges in Europa näher und kehrt 1918 mit ihr als Ehefrau und mit einem kleinen Sohn nach New York zurück. Jimmy ist der einzige, dem es am Ende des Romans gelingt, aus dem Dunstkreis New Yorks und damit vielleicht auch seinem Unglück zu entkommen. George Baldwin ist ein aufstrebender, junger Anwalt mit einer Schwäche fürs schöne Geschlecht. Er macht berufliche Karriere, endet als Bezirksstaatsanwalt und potenzieller Kandidat für das Amt des Bürgermeisters. Auch er verliebt sich leidenschaftlich in Ellen, verliert zwischenzeitlich sogar einmal die Kontrolle über seine Gefühle so weit, dass er versucht sie zu erschießen, und endet, entgegen jeder Wahrscheinlichkeit aber mit Notwendigkeit als ihr letzter, unglücklicher Ehemann. Stanwood Emery ist ein junger, reicher Taugenichts und Ellens große und wahrscheinlich einzige Liebe. Stan ist ein notorischer Säufer, heiratet im Suff versehentlich die falsche Frau und kommt bei einem von ihm selbst verursachten Brand ums Leben.
Um diese Hauptfabel herum entwickelt Dos Passos ein reiches Panorama von Figuren und Geschichten: Bud Korpenning flieht als Mörder vom Land in die Stadt, fristet dort sein Dasein als Tagelöhner und Bettler und springt von einer der Brücken New Yorks in den Tod. Joe Harland war einst der König der Wall Street, hat sich verspekuliert und versäuft sein restliches Leben. James Merivale, ein Cousin Jimmy Herfs, ist ein opportunistischer Schwachkopf, kommt als Kriegsheld aus dem Ersten Weltkrieg und wird ein erfolgreicher Banker, der seine Schwester an einen Hochstapler verheiratet. Congo Jake ist ein französischer Matrose und Barkeeper, der als Alkoholschmuggler reich wird. John Oglethorpe (Ellens erster Ehemann), Ruth Prynne, Nevada Jones und Tony Hunter sind Schauspieler, die nie so recht den Durchbruch schaffen. Gus McNiel und seine Frau Nellie haben Glück im Unglück und machen aus einem Beinbruch eine Karriere. Joey O’Keefe ist ein Spitzel, der sich später für die Veteranen des Krieges engagiert. Dutch Robertson ist einer dieser Veteranen und macht Karriere als Räuber. Anna Cohen ist eine lebenslustige Jüdin, die gern tanzt und sich als Näherin durchschlägt; auch ihr Leben ist letztlich schicksalhaft mit dem Ellens verbandelt. Rosie und Jake Silverman sind ein Betrügerpärchen, dem kein Erfolg beschieden ist. Man könnte diese Aufzählung problemlos weiter treiben.
Alle diese Geschichten, Kleinsterzählungen und Anekdoten werden in kurzen Abschnitten – von einer halben Seite bis zu einigen Seiten Länge – vorangetrieben, die einander nach einem nur scheinbar zufälligen Muster ablösen. Dazwischen finden sich immer wieder rein impressionistische Abschnitte, aber auch kurze Blitzlichter der sozialen und politischen Verhältnisse New Yorks im frühen 20. Jahrhundert. Das korrupte Verhältnis zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften wird thematisiert, das Elend der Arbeitslosen, die Not der ungewollt Schwangeren, die Abschiebung politisch Unerwünschter, all dies und vieles mehr kommt oft nur wie nebenbei, aber dennoch unübersehbar in dem Gesamtbild vor, das der Roman zeichnet.
Der Roman ist mit seinem inhaltlichen und motivischen Reichtum sowie seiner musivischen Form eines der wichtigen Vorbilder für die Entwicklung des Romans im 20. Jahrhundert. Es ist sehr erfreulich, dass dieses wichtige, historische Musterbuch für deutsche Leser endlich in einer angemessenen Übersetzung vorliegt. Jeder und jedem, die an der Entwicklung der literarischen Moderne interessiert sind, sei die Lektüre dieser Neuübersetzung dringend empfohlen.
John Dos Passos: Manhattan Transfer. Aus dem Englischen von Dirk van Gunsteren. Reinbek: Rowohlt, 2016. Pappband, Lesebändchen, 540 Seiten. 24,95 €.
Hans Peter Duerr: Die dunkle Nacht der Seele
Der Optimist glaubt, daß die Menschheit eines Tages den Tod besiegen wird. Und der Pessimist befürchtet, daß ihr dies tatsächlich gelingen könnte.
 Nach seinem Ausflug in die griechische Antike wendet sich Hans Peter Duerr wieder einem eher ethnologischen Thema zu: Nahtod-Erfahrungen und Jenseitsreisen, wobei er an keiner Stelle einen Zweifel daran lässt, dass er beides für innerpsychische Phänomene hält, denen keine wie auch immer geartete transzendente oder metaphysische Bedeutung oder gar Wirklichkeit entspricht. Daher taucht der Terminus Nahtod-Erfahrung – außer im Untertitel des Buches – auch stets in Anführungsstrichen bei ihm auf. Anlass der Beschäftigung mit diesem Thema sind zwei „Nahtod-Erfahrungen“ Duerrs (die erste davon hatte er bereits 1982), die sich so stark von den von Duerr zuvor gemachten Erlebnissen mit Drogen und Halluzinationen unterschieden, dass sein Interesse an dem Phänomen geweckt wurde.
Nach seinem Ausflug in die griechische Antike wendet sich Hans Peter Duerr wieder einem eher ethnologischen Thema zu: Nahtod-Erfahrungen und Jenseitsreisen, wobei er an keiner Stelle einen Zweifel daran lässt, dass er beides für innerpsychische Phänomene hält, denen keine wie auch immer geartete transzendente oder metaphysische Bedeutung oder gar Wirklichkeit entspricht. Daher taucht der Terminus Nahtod-Erfahrung – außer im Untertitel des Buches – auch stets in Anführungsstrichen bei ihm auf. Anlass der Beschäftigung mit diesem Thema sind zwei „Nahtod-Erfahrungen“ Duerrs (die erste davon hatte er bereits 1982), die sich so stark von den von Duerr zuvor gemachten Erlebnissen mit Drogen und Halluzinationen unterschieden, dass sein Interesse an dem Phänomen geweckt wurde.
Wie schon bei seinen früheren Büchern überwiegt bei Duerr die Dokumentation der überlieferten Erfahrungen bei weitem jeden Versuch, eine wie auch immer geartete theoretische Erklärung für die geschilderten Erlebnisse zu liefern. Duerr analysiert zuerst mit unzähligen Belegen die zentralen, „Nahtod-Erfahrungen“ weitgehend gemeinsamen Elemente, wobei sich bei einigen zeigt, dass ihre jeweilige Ausprägung stark durch die Kultur- und Glaubenszugehörigkeit der „Jenseitsreisenden“ geprägt ist. Anschließend nimmt er eine ebenso umfangreich belegte Abgrenzung der „Nahtod-Erfahrungen“ von anderen sogenannten psychischen Grenzerfahrungen vor: Schamanen-Reisen, Ekstasen, Halluzinationen, Träumen, Drogenerfahrungen, Entführungsphantasien, Teufels-Bessenheiten und zuletzt auch den Zuständen bei Herzstillstand. Eine kleine, nicht ganz vollständige Zusammenfassung der möglichen Bedingungen von „Nahtod-Erfahrungen“ liest sich so:
Ein solcher Zustand kann nicht nur bei Entspannung, extremer sensorischer Deprivation, Unfällen, Todesangst oder bei einer Überdosis gewisser pflanzlicher Drogen wie Iboga oder Stechapfel eintreten, sondern ebenfalls, wenn man vom Blitz getroffen wird oder möglicherweise auch, wenn man von einem hohen Felsen in die Tiefe springt. (S. 335)
Zu Ende des Buches findet sich dann doch noch ein eher theoretisches Kapitel, in dem – im umgangssprachlichen Sinne – esoterische Deutungen der „Nahtod-Erfahrungen“ unter Rekurs auf Wittgenstein und einen handfesten Realitätssinn (um es nicht Realismus zu nennen) abgewiesen werden.
Ich kann es nur abschätzen, aber ich vermute, das Buch stellt die umfangreichste Dokumentation von „Nahtod-Erfahrungen“ dar, die je erstellt wurde. Duerrs Belege reichen von der Antike bis in die Gegenwart und entstammen Berichten von sechs der sieben Kontinente. Duerr unterscheidet nicht systematisch zwischen religiös und profan überschriebenen Erlebnissen; überhaupt ist seine Darstellung von einer erfrischenden, vorurteilslosen Distanz gegenüber den meisten gerade gängigen ideologischen Positionen.
Die eine oder den anderen wird das Buch wegen seines nahezu ausschließlich dokumentarischen Ansatzes enttäuschen; selbst dort, wo Duerr bereit ist, sich auf eine eher abstrakte Diskussion des Themas einzulassen, geschieht dies in rein falsifikatorischer Absicht. So werden manche Leser nach der Lektüre zwar mit einem unvergleichbar reicheren Wissen über das Phänomen, aber – soweit sie sich auf Duerrs Argumente einlassen – mit keiner zufriedenstellenden Erklärung zurückbleiben. Und erfahrungsgemäß ist das etwas, was die wenigstens auszuhalten verstehen.
Hans Peter Duerr: Die dunkle Nacht der Seele. Nahtod-Erfahrungen und Jenseitsreisen. Berlin: Insel, 2015. Pappband, 688 Seiten. 29,95 €.
J. J. Abrams / Doug Dorst: S.
Aber so ist es passiert. Dies ist die Wirklichkeit.
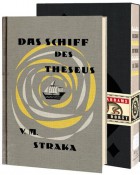 „S.“ ist eines der, vielleicht sogar das aufwendigst gestaltete Buchprojekt, das ich jemals in Händen hatte. Es gibt vor, ein Exemplar eines 1949 gedruckten Romans mit dem Titel „Das Schiff des Theseus“ des (fiktiven) Autors V. M. Straka zu sein, in dem und durch das zwei seiner Leser miteinander kommunizieren. Sie tun dies durch handschriftliche Anmerkungen auf den ungewöhnlich breiten Seitenrändern des Romans und zahlreiche Einlagen wie Briefe, Postkarten, Fotos, Fotokopien, Zeitungsausschnitte und sogar eine Dechifrierscheibe. Es handelt sich bei den Lesern des Buches um Jen, eine Studentin zumindest der Kunstgeschichte und Literaturwissenschaft, die gerade vor dem Abschluss ihres Studiums zu stehen scheint oder besser: mit ihm ringt, und Eric, einem zwangsexmatrikulierten, ehemaligen Doktoranden, der versucht, die wahre Identität des geheimnisvollen Autors V. M. Straka zu enttarnen.
„S.“ ist eines der, vielleicht sogar das aufwendigst gestaltete Buchprojekt, das ich jemals in Händen hatte. Es gibt vor, ein Exemplar eines 1949 gedruckten Romans mit dem Titel „Das Schiff des Theseus“ des (fiktiven) Autors V. M. Straka zu sein, in dem und durch das zwei seiner Leser miteinander kommunizieren. Sie tun dies durch handschriftliche Anmerkungen auf den ungewöhnlich breiten Seitenrändern des Romans und zahlreiche Einlagen wie Briefe, Postkarten, Fotos, Fotokopien, Zeitungsausschnitte und sogar eine Dechifrierscheibe. Es handelt sich bei den Lesern des Buches um Jen, eine Studentin zumindest der Kunstgeschichte und Literaturwissenschaft, die gerade vor dem Abschluss ihres Studiums zu stehen scheint oder besser: mit ihm ringt, und Eric, einem zwangsexmatrikulierten, ehemaligen Doktoranden, der versucht, die wahre Identität des geheimnisvollen Autors V. M. Straka zu enttarnen.
Straka scheint eine wilde Lebensgeschichte gehabt zu haben, die ihn in allerlei politische Affären verstrickt hat. Er hat seine wahre Identität so erfolgreich verborgen, dass es zwar zahlreiche Kandidaten dafür gibt, wer Straka gewesen sein könnte, aber keine auch nur einigermaßen sicheren Anhaltspunkte, ihn zu identifizieren. „Das Schiff des Theseus“ ist sein letzter Roman, nicht vollständig von ihm selbst verfasst, da einige Seiten des letzten Kapitels im Chaos um Strakas mutmaßliche Ermordung verloren gegangen sind. Ergänzt hat das letzte Kapitel des Romans Strakas langjährige Übersetzerin F. X. Caldeira, so dass, was das Ende des Buches angeht, einige Unsicherheit herrscht.
„Das Schiff des Theseues“ ist eine interessante Mischung aus Agenten-Thriller und allegorischem Künstler-Roman: Es beginnt damit, dass zu einer nicht näher bestimmten Zeit in einer nicht näher bestimmten Hafenstadt ein Mann auftaucht, der sein Gedächtnis verloren hat. Ob dies von seinem kurz zuvor geschehenen Sturz ins Wasser verursacht wurde, bleibt unklar. In der ersten Hafenkneipe, in die er sich begibt, wird er, als er eine ihm vage bekannt vorkommende Frau anspricht, betäubt und auf ein Segelschiff verschleppt. Das Schiff erweist sich als ein höchst merkwürdiges Gefährt, vielfach ausgebessert und umgebaut, das von einer Mannschaft bedient wird, deren Mitglieder allesamt den Mund vernäht haben; nur der scheinbare Anführer der Seeleute (er lehnt die Bezeichnung Kapitän ab) spricht, alle anderen verständigen sich nur mit Hilfe kleiner Pfeifen. Außerdem scheinen sie nicht nur das Schiff zu segeln, sondern auch unter Deck einer weiteren, geheimnisvollen Tätigkeit nachzugehen.
Dem Mann ohne Gedächtnis wird ein Name gegeben, der im weiteren Roman stets mit S. abgekürzt wird. Er wird auf dem Schiff zu keinerlei Tätigkeit angehalten, mit mäßiger Kost am Leben und über sein weiteres Schicksal im Ungewissen gehalten. Bei Gelegenheit eines überraschend aufkommenden Sturms springt er von Bord und gerät in der Stadt, die er schwimmend erreicht, sogleich in eine Demonstration von Arbeitern vor einer großen Fabrik. Er wird vom Arbeiterführer aufgelesen, glaubt in der Menge der Demonstranten jene Frau aus der Hafenkneipe wiederzuerkennen (inzwischen hat er auf dem Schiff erfahren, dass sie Sola heißt), verfolgt sie, beobachtet dabei eine Bombenübergabe, versucht die Arbeiter zu warnen und flieht, nachdem die Bombe explodiert ist, mit dem Arbeiterführer und drei weiteten Demonstranten in die Stadt. Am nächsten Tag beschließt diese kleine Gruppe, in die nahegelegenen Berge zu fliehen, um sich dem Zugriff der von der Fabrik angeheuerten Detektive zu entziehen. Auf dieser Flucht werden peu à peu alle Begleiter von S. durch die verfolgenden Detektive ermordet; er selbst kann sich durch einen Sprung ins Meer retten, wo er – welch Überraschung – von dem Schiff, von dem er geflohen ist, wieder aufgesammelt wird.
Mit diesem Ausflug an Land wird S. zu einem Mitstreiter im Kampf gegen den Eigentümer der Fabrik: Vévoda ist ein weltweit agierender Waffenproduzent mit weitreichendem Einfluss auf die Politik. Nach weiteren Drehungen und Wendungen der Schiffs-Erzählung entschließt S. sich, für die Widerstandsbewegung gegen Vévoda, die sich jenes geheimnisvollen Buchstaben S, der S. allenthalben begegnet,

als Erkennungszeichen zu bedienen scheint, als Attentäter zu arbeiten und die derweil zu Agenten mutierten Handlanger Vévodas zu ermorden. In einem als „Zwischenspiel“ bezeichneten Kapitel wird eine ganze Anzahl solcher Morde geschildert; das Kapitel erlaubt außerdem eine zeitliche Einordnung dieses Teils der Romanhandlung zwischen Juni 1914 und etwa 1940. In den Zeiten, in denen S. nicht an Land Agenten jagt, lebt er auf dem Schiff wie dessen andere Matrosen mit vernähtem Mund und als Schriftsteller seiner eigenen Geschichte während der Zeit unter Deck.
S.’ Karriere als Auftragsmörder endet vorläufig mit der Ermordung des Gouverneurs des sogenannten Territoriums, in dem Vévoda im südamerikanischen Dschungel rücksichtslos Rohstoffe (darunter auch eine geheimnisvolle, alles zerstörenden Substanz) abbaut; der Gouverneur erweist sich als einer jener vier Demonstranten, den S. auf der Flucht zu Anfang des Romans ermordet glaubte. Die letzten beiden Kapitel des Buches schildern, wie der inzwischen offensichtlich in einen einsamen und eiskalten Ruhestand versetzte S. noch einmal rekrutiert wird: Sola selbst – die Frau seiner Träume – sucht S. auf und informiert ihn darüber, dass man endlich Vévodas Chateau entdeckt und nun Gelegenheit habe, den Hauptfeind selbst zu ermorden. Der offenbar gealterte S. macht sich zusammen mit Sola auf den Weg, und die beiden können sich bei einer großen Feier im Chateau auch erfolgreich unter das Personal mischen. Der Roman nimmt an dieser Stelle noch einmal eine bemerkenswerte Wendung ins Surreale und Anarchische, wobei – wie oben bereits angemerkt – nicht ganz klar ist, welche Anteile des letzten Kapitels dem fiktiven Autor Straka und welche seiner ebenso fiktiven Übersetzerin Caldeira zuzuschreiben sind.
Dieser Roman aber ist, wie gesagt, nur die Grundlage für eine weitere Geschichte, die sich auf den Seitenrändern des Buches abspielt. Dort lernen sich über das Buch – und für längere Zeit nur über das Buch – zwei seiner Leser kennen: Eric und Jen lesen „Das Schiff des Theseus“ ausschließlich als Schlüsselroman; ihr Ziel ist es, Straka zu identifizieren und sie erreichen in ihrer Zusammenarbeit auch erstaunliche Fortschritte: Nicht nur können Sie F. X. Caldeira als Frau identifizieren, Eric gelingt es sogar, die versteckt in ihrem Heimatland Brasilien Lebende aufzuspüren und mit ihr zu sprechen. Zu einem wirklich abschließenden Ergebnis kommen die beiden Forscher aber nicht. Zwar können sie zahlreiche der möglichen Kandidaten ausschließen, auch zahlreiche Anspielungen im Text des Romans auf reale Personen und Ereignisse zurückführen, doch letztlich bleibt unklar, ob V. M. Straka eine einzelne Person oder ein Autorenkollektiv mit wechselnder Besetzung war. Es erweist sich nämlich, dass sich unter dem Zeichen des S, wie es im „Schiff des Theseus“ verwendet wird, eine Gruppe von Schriftstellern zusammengefunden hat, deren Ziel der – wie auch immer geartete – Widerstand gegen den Rüstungsindustriellen Bouchard gewesen sein soll. Außerdem finden Jen und Eric zahlreiche Hinweise auf Morde, die den im Zwischenspiel beschriebenen auffallend gleichen und sich bis in die Gegenwart hinein erstrecken. Der Kampf zwischen (dem neuen) S und Bouchard mit seiner Firma ARP scheint immer noch fortgeführt zu werden. Neben dem Verlauf dieser Forschungsarbeit dokumentieren die Randglossen noch die Entwicklung einer Liebesgeschichte zwischen Jen und Eric, Jens Kampf mit dem Abschluss ihres Studiums sowie Erics mit seinem ehemaligen Doktorvater und einer alten Geliebten, Jens wachsende Paranoia, die sich vom neuen S beobachtet, verfolgt und bedroht fühlt, und last not least die innerliche Auseinandersetzung der beiden mehr oder weniger jungen Forscher mit den Traumata ihrer Kindheit bzw. Jugend.
All dies wird nur scheinbar ungeordnet präsentiert, denn zum einen erlaubt die Verwendung unterschiedlicher Farben in den handschriftlichen Anmerkungen ihre ungefähre chronologische Einordnung (es sind auf den ersten Blick mindestens fünf chronologische Schichten der Kommentierung erkennbar: Bleistift (Erics früheste Anmerkungen; erstaunlich wenige, wenn er das Buch tatsächlich 15 Jahre lang studiert haben will), blaue/schwarze Tinte, orangefarbene/grüne, violette/rote und als letzte Stufe die Verwendung schwarzer Tinte von beiden Kommentatoren), zum anderen ist diese Erzählebene sorgfältig so konstruiert, dass ein aufmerksamer Leser durchaus in der Lage ist, bereits bei einer ersten Lektüre diese Meta-Erzählung vollständig wahrnehmen und einordnen zu können.
Sieht man von der sehr aufwendigen und im Detail sicherlich liebe- und phantasievollen Umsetzung dieser Buchidee ab, so bleibt leider nicht viel Substanz: Als reizvollstes Element stellt sich überraschenderweise der zugrundeliegende Roman heraus, der auch über die von Jen und Eric betriebene Lektüre hinaus vielfältiges Material für Interpretationen zur Verfügung stellt. Zahlreiche literarische Anspielungen (so wird etwa die zentrale Metapher des Buches, nämlich die des Titels, nirgendwo von den beiden sogenannten Literaturwissenschaftlern erläutert oder in die Interpretation aufgenommen), die Verwendung von Klischees des Abenteuer- und Thriller-Genres, die historische Einordnung der Fabel und vieles mehr bleibt schlicht unerörtert. Dagegen ist die Metaerzählung um Jen und Eric eher dünn und erweist sich als nicht viel mehr als eine weitere literarisch aufgehängte Verschwörungsfabel à la Dan Brown & Co. Auch die den beiden Protagonisten zugeschriebenen Lebensgeschichten sind pseudodramatisch und den Gepflogenheiten der Trivialliteratur zuzuordnen. Die Spiegelungen der beiden Erzählebenen ineinander sind sehr durchschaubar und auffällig konstruiert. Zudem ist der Auftakt der Metaerzählung derartig unglaubwürdig, dass ihm mit dem Wort „unwahrscheinlich“ mehr als geschmeichelt wäre.
Das ästhetisch aber vielleicht Witzigste an diesem Buch, dessen durchgängigstes Thema die Frage nach der Identität ist, ist, dass es selbst vorgibt etwas zu sein, das es nicht ist. „S.“ tut so, als sei es ein bestimmtes und ganz und gar einmaliges Exemplar eines Buches, zu einem Unikat geworden durch die Dokumentation der gemeinsamen Lektüre zweier Leser und Forscher. Dabei ist es in Wirklichkeit nichts anderes als ein weiteres gut gemachtes und geschickt vermarktetes Massenprodukt des Buchmarktes, gepuscht durch eine wirkungsvolle PR-Kampagne, die einmal mehr ein im Kern triviales Produkt in ein Event verwandelt. Und wir alle feiern mit …
J. J. Abrams / Doug Dorst: S. Aus dem amerikanischen Englisch von Tobias Schnettler und Bert Schröder. Köln: Kiepenheuer & Witsch, 2015. Bedruckter Leinenband im Schuber, Fadenheftung, 23 Beilagen, 523 Seiten. 45,– €.
Karlheinz Stierle: Dante Alighieri
Dantes Mythenbricolage aus Altem und Neuem Testament und eigenen visionären oder pseudovisionären Elementen im Einzelnen aufzulösen, ist hier nicht der Ort.
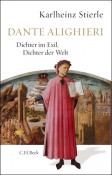 Wieder einmal ein Sachbuch, das zumindest teilweise unter falscher Flagge segelt: Titel und Untertitel – „Dichter im Exil, Dichter der Welt“ – sowie der Umschlagstext lassen eher eine Biographie erwarten, doch den Schwerpunkt des Buches (drei der sechs Kapitel) bildet eine ausführliche, kommentierende Nacherzählung der „Commedia“. Vorangestellt ist eine kurzgefasste Biographie Dantes und eine ebenso knappe Darstellung seiner frühen Schriften; den Abschluss macht ein Kapitel zur Rezeption, wobei auch dieses kaum über einige erweiterte Stichworte hinausgeht.
Wieder einmal ein Sachbuch, das zumindest teilweise unter falscher Flagge segelt: Titel und Untertitel – „Dichter im Exil, Dichter der Welt“ – sowie der Umschlagstext lassen eher eine Biographie erwarten, doch den Schwerpunkt des Buches (drei der sechs Kapitel) bildet eine ausführliche, kommentierende Nacherzählung der „Commedia“. Vorangestellt ist eine kurzgefasste Biographie Dantes und eine ebenso knappe Darstellung seiner frühen Schriften; den Abschluss macht ein Kapitel zur Rezeption, wobei auch dieses kaum über einige erweiterte Stichworte hinausgeht.
Im Rahmen dessen, was das Buch leisten will, ist es, soweit ich das nachvollziehen kann, untadelig, wenn es auch trotz seiner Kürze nicht frei von Redundanzen ist; allerdings sollte man auch nicht zu viel erwarten. Schon den einigermaßen interessierten Laien dürfte kaum etwas an Stierles Nacherzählung überraschen; auch geht er zuverlässig auf alle populären Stereotype zur „Commedia“ ein. Dennoch eignet sich das Buch nur bedingt als erste Einführung, da es dafür zu hohe Ansprüche an die historische Vorbildung des Lesers macht. Wie so häufig bei Sachbüchern ist mir auch bei dieser Lektüre nicht recht klar geworden, für welche Zielgruppe der Autor das Buch verfasst hat. Wer seine Erinnerung an die „Commedia“ auffrischen will, ohne das ganze Buch noch einmal zu lesen, wird hier gut bedient; alle anderen werden das Buch wohl etwas enttäuscht zur Seite legen.
Karlheinz Stierle: Dante Alighieri. Dichter im Exil, Dichter der Welt. München: C. H. Beck, 2014. Pappband, 236 Seiten. 22,95 €.
Bruno Cabanes / Anne Duménil (Hg.): Der Erste Weltkrieg
 Dieser auf Französisch bereits 2007 erschienene großformatige Bildband (28,5 cm × 23 cm) liegt nach seiner deutschen Publikation im vergangenen Jahr nun auch für kurze Zeit in einer unschlagbar preiswerten Ausgabe der Bundeszentrale für politische Bildung vor. Der reich illustrierte Band versammelt knapp 70 relativ kurze, von verschiedenen Historikern verfasste Kapitel, die jeweils einem einzelnen Ereignis des Krieges oder einem kulturhistorischen Aspekt der am Krieg beteiligten Nationen gewidmet sind. Beginnend mit der Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges in den Balkankriegen und bis hinein in die Nachkriegswelt, deren massive Umwälzungen bereits die Grundlagen bilden für den Aufstieg des Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg, entsteht ein gut gewichtetes musivisches Bild der europäischen Welt der ersten beiden Dekaden des 20. Jahrhunderts.
Dieser auf Französisch bereits 2007 erschienene großformatige Bildband (28,5 cm × 23 cm) liegt nach seiner deutschen Publikation im vergangenen Jahr nun auch für kurze Zeit in einer unschlagbar preiswerten Ausgabe der Bundeszentrale für politische Bildung vor. Der reich illustrierte Band versammelt knapp 70 relativ kurze, von verschiedenen Historikern verfasste Kapitel, die jeweils einem einzelnen Ereignis des Krieges oder einem kulturhistorischen Aspekt der am Krieg beteiligten Nationen gewidmet sind. Beginnend mit der Vorgeschichte des Ersten Weltkrieges in den Balkankriegen und bis hinein in die Nachkriegswelt, deren massive Umwälzungen bereits die Grundlagen bilden für den Aufstieg des Nationalsozialismus und den Zweiten Weltkrieg, entsteht ein gut gewichtetes musivisches Bild der europäischen Welt der ersten beiden Dekaden des 20. Jahrhunderts.
Wahrscheinlich genügt die Lektüre dieses Bildbandes allein nicht, um sich ein einigermaßen abgerundetes Bild von den Kriegsjahren zu machen, sondern sie sollte von einer geschlossenen Darstellung der politischen und militärischen Geschichte des Krieges begleitet werden, etwa Wolfgang J. Mommsens „Der Erste Weltkrieg“. Gerade für eine solch kurze Überblicksdarstellung liefert der Bildband die ideale Ergänzung, da hier viele Details zur Sprache kommen, die dort notwendig fehlen müssen: Der Osteraufstand in Dublin, die Geschichte der beiden englischen Schriftsteller Wilfred Owen und Siegfried Sasoon (wozu hier en passant auch auf die Regeneration-Trilogie Pat Barkers hingewiesen sei), die Geschichte Mata Haris, die Entstehung Dadas und vieles andere mehr. Für jeden an der Geschichte des 20. Jahrhunderts Interessierten ein Muss.
Bruno Cabanes / Anne Duménil (Hg.): Der Erste Weltkrieg. Eine europäische Katastrophe. Aus dem Franz. von Birgit Lamerz-Beckschäfer. Lizenzausgabe. Bonn: Bundeszentrale für politische Bildung, 2013. Broschur, Fadenheftung, 480 Seiten Kunstdruckpapier, üppig illustriert. 7,– €.
Bitte beachten Sie, dass die Lizenzausgaben der Bundeszentrale für politische Bildung immer nur für kurze Zeit lieferbar sind.